3959344902 Lp.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
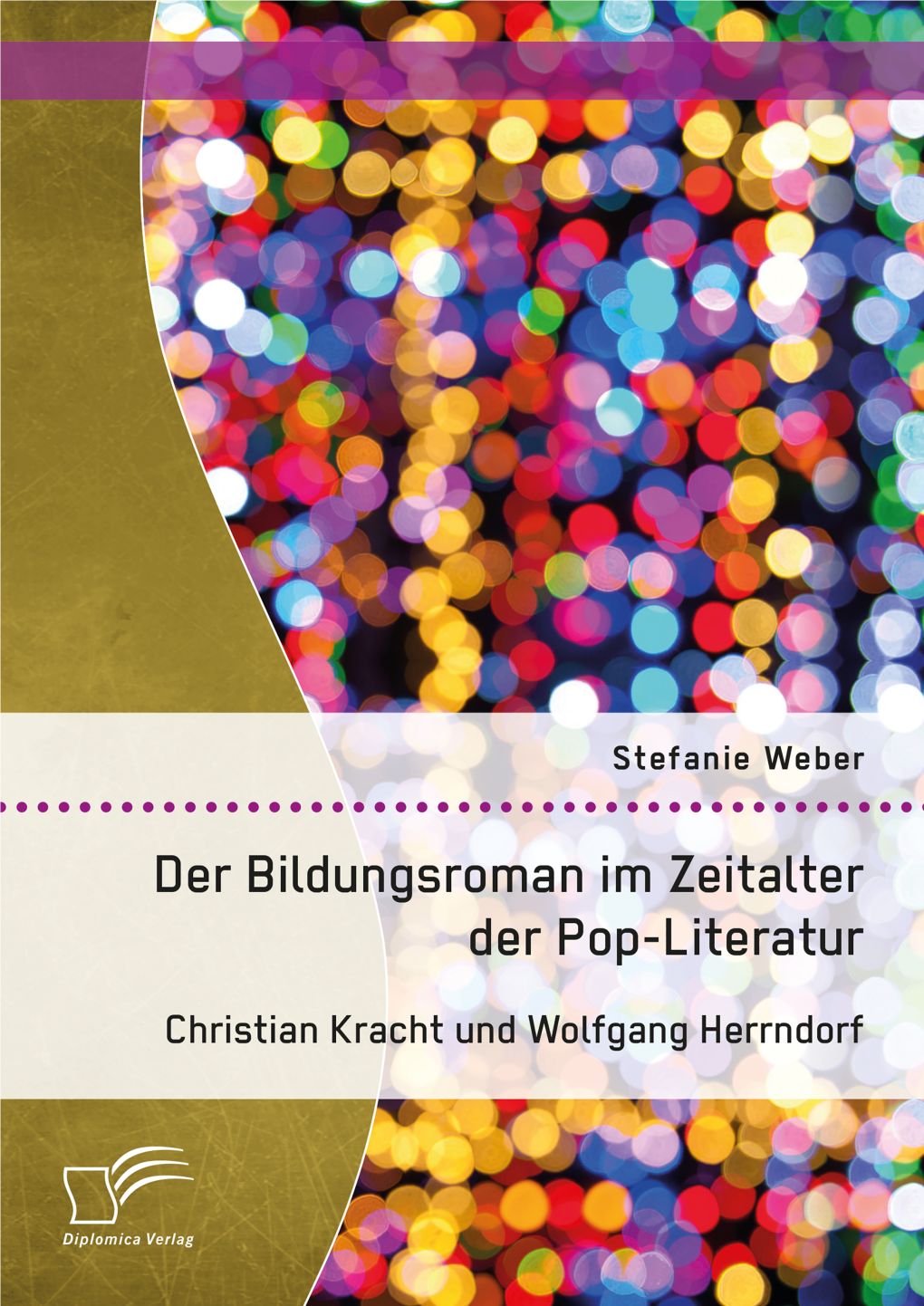
Load more
Recommended publications
-

Sympathy for the Devil: Volatile Masculinities in Recent German and American Literatures
Sympathy for the Devil: Volatile Masculinities in Recent German and American Literatures by Mary L. Knight Department of German Duke University Date:_____March 1, 2011______ Approved: ___________________________ William Collins Donahue, Supervisor ___________________________ Matthew Cohen ___________________________ Jochen Vogt ___________________________ Jakob Norberg Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of German in the Graduate School of Duke University 2011 ABSTRACT Sympathy for the Devil: Volatile Masculinities in Recent German and American Literatures by Mary L. Knight Department of German Duke University Date:_____March 1, 2011_______ Approved: ___________________________ William Collins Donahue, Supervisor ___________________________ Matthew Cohen ___________________________ Jochen Vogt ___________________________ Jakob Norberg An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of German in the Graduate School of Duke University 2011 Copyright by Mary L. Knight 2011 Abstract This study investigates how an ambivalence surrounding men and masculinity has been expressed and exploited in Pop literature since the late 1980s, focusing on works by German-speaking authors Christian Kracht and Benjamin Lebert and American author Bret Easton Ellis. I compare works from the United States with German and Swiss novels in an attempt to reveal the scope – as well as the national particularities – of these troubled gender identities and what it means in the context of recent debates about a “crisis” in masculinity in Western societies. My comparative work will also highlight the ways in which these particular literatures and cultures intersect, invade, and influence each other. In this examination, I demonstrate the complexity and success of the critical projects subsumed in the works of three authors too often underestimated by intellectual communities. -

Bibliographie Zu Christian Kracht
Bibliographie zu Christian Kracht 2011: Ächtler, Norman: Die »Abtreibung« der Popliteratur: Kracht, Krieg, Kulturkritik. In: Kriegsdiskurse in Literatur und Medien nach 1989. Hg. v. Carsten Gansel u. Heinrich Kaulen. Göttingen: V&R uni press 2011, S. 379-401. Bartels, Klaus: Trockenlegung von Feuchtgebieten. Christian Krachts Dandy-Trilogie. In: Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Hg. v. Olaf Grabienski, Till Huber u. Jan-Noël Thon. Berlin: de Gruyter 2011, S. 207-226. Birgfeld, Johannes / Conter, Claude D.: Vorbemerkung. In: Christian Kracht / David Woodard: Five Years. Briefwechsel 2004-2009. Vol. 1: 2004-2007. Hg. v. Johannes Birgfeld u. Claude D. Conter. Hannover: Wehrhahn 2011, S. V-XV. Hermes, Stefan: Tristesse globale. Intra- und interkulturelle Fremdheit in den Romanen Christian Krachts. In: Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Hg. v. Olaf Grabienski, Till Huber u. Jan-Noël Thon. Berlin: de Gruyter 2011, S. 187-206. Krüger, Brigitte: Intensitätsräume. Die Kartierung des Raumes im utopischen Diskurs der Postmoderne: Christian Krachts Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. In: Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung. Hg. v. Gertrud Lehnert. Bielefeld: Transcript-Verlag 2011, S. 259-275. Niermann, Ingo: Oberfläche. In: Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Hg. v. Olaf Grabienski, Till Huber u. Jan-Noël Thon. Berlin: de Gruyter 2011, S. 227-230. Preece, Julian: Christian Kracht’s Faserland (Frayed-Land). In: The Novel in German since 1990. Hg. v. Stuart Taberner. Cambridge: Cambridge University Press 2011, S. ###-###. Seelig, Arnim: Irony and Narrative Subtext in the Novel 1979 by Christian Kracht. -

Christian Kracht, Tristesse Royale Und Die Möbius- Schleife
http://dx.doi.org/10.18778/2196-8403.2008.13 ANDRZEJ KOPACKI Christian Kracht, Tristesse Royale und die Möbius- schleife Przedmiotem artykułu są fenomen i samowiedza generacji pop w niemieckim pejzaŜu kulturalnym, jakie wyłaniają się z autoprzedstawienia „kwintetu popkulturalnego“ w ksiąŜce Tristesse Royale i stanowią tło dwóch powieści Christiana Krachta (Faserland i 1979). Badanie literaturoznawcze przyjmuje za punkt wyjścia konstrukcję narracyjnego Ja i usiłuje (m.in. sięgając do pojęć teorii znaków Rolanda Barthesa) określić literacki charakter prozy Krachta. Wykorzystanie w analizie ‚wstęgi Möbiusa‘ jako figury inte- lektualnej kwintetu oraz jako modelu narracyjnego pozwala ukazać i zgłębić strukturę, dynamikę i sposoby działania (np. ironię) omawianych narracji. Der Beitrag ist ein Versuch, das Phänomen und Selbstverständnis der Pop-Generation in der deutschen Kulturlandschaft, wie sie sich bei dem „popkulturellen Quintett“ im Buch Tristesse Royale darstellen und zwei Romane von Christian Kracht (Faserland und 1979) mitprägen, analytisch zu erörtern. Die literaturwissenschaftliche Auseinan- dersetzung geht von der Ich-Konstruktion des Erzählers aus und bemüht sich (u. a. unter Hinzuziehung der Begriffe aus der Zeichentheorie Roland Barthes’), das Literarische der Prosa Krachts zu erfassen. Indem die ‚Möbiusschleife‘ als Denkfigur des Quintetts und narratives Modell auf die Erzählweise Krachts angewandt wird, werden deren Struktur, Dynamik und Modi (z. B. Ironie) aufgezeigt und ergründet. The subject of the essay is the phenomenon and self-consciousness of the pop genera- tion in German cultural landscape, as depicted in the „popcultural quintet’s“ self-repre- sentation in Tristesse Royale and used as background of two novels by Christian Kracht (Faserland and 1979). The starting point of the analysis which, (referring to the concepts of Roland Barthes’ theory of signs) undertakes to define the nature of Kracht’s literariness in the construction of the first person narrative in Faserland. -

Julin D-Aufsatz Schlussversion 20200828
Selbständige Arbeit „Alle Wege führen hier immer hin zur Ironie.“ Verbale Ironie als Gestaltungsmittel des Dandytums in Christian Krachts ‚Faserland‘ und Per Hagmans ‚Att komma hem ska vara en schlager‘. Ein Vergleich. Autor: Hanna Julin Betreuerin: Bärbel Westphal Examinatorin: Corina Löwe Datum: 25. Juni 2020 Fach: Germanistik Niveau: Avanciertes Kurs: 4TY01E Abstract Title: “All roads here always lead to irony”. Verbal irony as a mean of presenting dandyism in the novels ‘Faserland’, by Christian Kracht and ‘Att komma hem ska vara en schlager’, by Per Hagman. A contrastive analysis. Author: Hanna Julin Supervisor: Bärbel Westphal Examinator: Corina Löwe Summary: The aim of this study is to investigate how verbal irony is used in fiction to indicate dandyism in pop-modern literature. It is a contrastive study based on Christian Kracht’s novel Faserland (1995), which is considered to be a romana à clef in the German popliterature. Att komma hem ska vara en schlager (2004), by Per Hagman is a Swedish novel comparative to the German „pop-novel“. The analysis has shown that the verbal irony primarily has three functions: social criticism, distancing and self-criticism. These elements correspond with distinctive features which are typical of the dandy. Irony itself, according to Barbey (1987), Schickedanz (2000) and Rauen (2010) among others, is a distinctive feature of the classical dandy figure, as well as of the pop-modern one. However, further research consisting of both synchronic, diachronic and contrastive analysis is relevant, as the dandy, according to Hörner (2008) and Tietenberg (2012) among others, always renews himself – so that his image always appears elegant, modern, original and rebellious in his contemporary society. -

Moushira SUELEM Christian Krachts Roman "Imperium"
Moushira SUELEM ROMANTISCHE TOPOI IN CHRISTIAN KRACHTS ROMAN „IMPERIUM“1 These und Vorgehensweise Christian Krachts Roman "Imperium" erregte gleich nach seinem Erscheinen im Jahr 2012 großes Aufsehen in Deutschland. Von einigen Kritikern, insbesondere von Georg Diez, wurde er scharf abgelehnt und als demokratiefeindliches Machwerk gebrandmarkt, das von seinem Autor in ein pseudo-romantisches Gewand gehüllt worden sei. Ich möchte untersuchen, ob man an diesen Vorwurf der „Pseudo- Romantik“ festhalten sollte oder sich Mittel finden lassen, ihn zu destruieren. Dabei gehe ich von der These aus, dass es sich tatsächlich um ein romantisches bzw. neu-romantisches Werk handelt. Um die These zu stützen werde ich meine Aufmerksamkeit auf einen Topos richten, den ich für aussagekräftig halte: die Kindheit. Ich werde untersuchen, ob in Krachts Roman "Imperium" von Kindern die Rede ist, und wenn ja, wie sie gezeichnet und dargestellt werden. Auf diese Weise hoffe ich genug Material zu Tage zu fördern, um die gestellte Frage beantworten zu können. Biographisches Christian Kracht wurde am 29. Dezember 1966 in Saanen im Kanton Bern in der Schweiz geboren. Sein Vater war Verlagsmanager und viele Jahre Generalbevollmächtigter des Axel Springer-Konzerns. Christian Kracht wuchs im Berner Oberland auf. Mit elf Jahren verließ er die Schweiz, "verlor die Mundart und auch das Gefühl hier (in der Schweiz) ganz daheim zu sein." (Siehe Interview mit der Badischen Zeitung vom 04.08.2014) 1 Ich möchte hiermit kurz darauf hinweisen, dass dieser Artikel als Ergebnis meines durch Alexander von Humboldt-Stiftung gewährten Forschungsaufenthalts im Sommer 2018 zustande gekommen ist. 356 Moushira SUELEM Von da an wächst er in den USA auf, in Kanada, Deutschland und Südfrankreich. -
Christian Kracht
Leseprobe Matthias N. Lorenz (Hg.) Christian Kracht Werkverzeichnis und kommentierte Bibliografie der Forschung AISTHESIS VERLAG Bielefeld 2014 Abbildung auf dem Umschlag: Christian Kracht. © 2014 Frauke Finsterwalder. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Aisthesis Verlag Bielefeld 2014 Postfach 10 04 27, D-33504 Bielefeld Satz: Germano Wallmann, www.geisterwort.de Druck: docupoint GmbH, Magdeburg Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-8498-1062-7 www.aisthesis.de Inhaltsverzeichnis Matthias N. Lorenz „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“. Eine Berner Bibliografie zum Werk Christian Krachts ....................... 7 * Teil 1: Werkverzeichnis ................................................................................... 21 1.1 Selbständige Veröffentlichungen ............................................. 21 1.2 Herausgeberschaft ...................................................................... 42 1.3 Facebook ....................................................................................... 43 1.4 Unselbständige Veröffentlichungen ........................................ 43 1.4.1 In Te mpo (1991-1995) .................................................... 43 1.4.2 In Schlagloch resp. ruprecht (1991/1992) ................... 47 1.4.3 In Der Spiegel (1994-1998) ........................................... 47 1.4.4 -

Die Methode Kracht Seit „Faserland“ Gilt Christian Kracht Als Wichtige Stimme Der Gegenwart
Kultur Literatur Die Methode Kracht Seit „Faserland“ gilt Christian Kracht als wichtige Stimme der Gegenwart. Sein neuer roman „imperium“ zeigt vor allem die Nähe des autors zu rechtem Gedankengut. Von Georg Diez as will Christian Kracht? am im roman, „würde gottgleich, würde un - 16. Februar 2012 erscheint sein sterblich werden“. Wneuer roman, er heißt „impe - aber noch einmal: Was will Christian rium“, das Cover ist bunt und schaut ei - Kracht mit dieser kruden Geschichte er - nen fast kindlich an wie ein Comic. eine zählen? er ist ja nicht irgendwer. er ist in Südseeinsel und das blaue Meer sind dort Deutschland einer der wenigen Schrift - zu sehen, ein paar Möwen, ein rauchen - steller seiner Generation, die ihre Bedeu - der Dampfer, eine eidechse auf einem tung nicht ein paar von Kritikern erdach - Baum und ein totenschädel unter einem ten und vergebenen Buchpreisen oder Busch. Stipendien verdanken, sondern tatsäch - „unter den langen weißen Wolken“, so lich wichtig sind, weil es Menschen gibt, beginnt „imperium“, „unter der prächti - die das Leben anders sehen, weil sie seine gen Sonne, unter dem hellen Firmament, romane gelesen haben. Kracht wurde da war erst ein langgedehntes tuten zu groß gegen die Literatur-Claqueure. Das hören, dann rief die Schiffsglocke ein - macht ihn nicht zum guten Menschen. dringlich zum Mittag, und ein malay - Sein Debüt „Faserland“ von 1995 war sischer Boy schritt sanftfüßig und leise ein Meilenstein der bundesrepublikani - Schriftsteller Kracht, Kolonialisten, Einheimische in das Oberdeck ab, um jene -

Christian Kracht
Bibliographien zur deutschen Literatur 21 Christian Kracht Werkverzeichnis und kommentierte Bibliografie der Forschung von Matthias N. Lorenz 1. Auflage Christian Kracht – Lorenz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Einzelne Autoren: Monographien & Biographien Aisthesis 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 8498 1062 7 Leseprobe Matthias N. Lorenz (Hg.) Christian Kracht Werkverzeichnis und kommentierte Bibliografie der Forschung AISTHESIS VERLAG Bielefeld 2014 Abbildung auf dem Umschlag: Christian Kracht. © 2014 Frauke Finsterwalder. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Aisthesis Verlag Bielefeld 2014 Postfach 10 04 27, D-33504 Bielefeld Satz: Germano Wallmann, www.geisterwort.de Druck: docupoint GmbH, Magdeburg Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-8498-1062-7 www.aisthesis.de Inhaltsverzeichnis Matthias N. Lorenz „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“. Eine Berner Bibliografie zum Werk Christian Krachts ....................... 7 * Teil 1: Werkverzeichnis ................................................................................... 21 1.1 Selbständige Veröffentlichungen ............................................. 21 1.2 Herausgeberschaft ...................................................................... 42 1.3 Facebook ...................................................................................... -

Christian Krachts Abenteuerroman IMPERIUM: Ein Buch Zwischen Postkolonialer Komik Und Rechtslastigem Gedankengut? Eine Untersuchung Aus Afrikanischer Perspektive
FACULTY OF ARTS DEPARTMENT OF LINGUISTICS AND LANGUAGES MASTER OF ARTS GERMAN STUDIES MA-ARBEIT ZUM THEMA: Christian Krachts Abenteuerroman IMPERIUM: Ein Buch zwischen postkolonialer Komik und rechtslastigem Gedankengut? Eine Untersuchung aus afrikanischer Perspektive Vorgelegt von: BOZA HERVE DJAPO C50/13166/2018 [email protected] +254 757590989 / +49 1702585941 4. Semester 2019/2020 Donnerstag, 30. Juli 2020 Unter Betreuung von: 1. Dr. James Orao 2. Dr. Lorna Okoko EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende MA-Forschungsarbeit gar nicht anhand fremder Hilfe angefertigt wurde, sondern wohl die Frucht meiner eigenständigen Überlegungen ist. Alle jeweiligen Textstellen, welche wortwörtlich oder sinngemäß auf Vorträgen oder Veröffentlichungen von anderen Autoren basieren, wurden als solche kenntlich gemacht. Die Thesis wurde bis jetzt keiner anderweitigen Prüfungsbehörde unterbreitet und somit auch noch nicht publiziert. Unterschrift_________________________ Datum____________________06/11/2020 Boza Hervé Djapo C50/13166/2018 Diese Forschungsarbeit wurde als Bestandteil des Germanistik-Masterstudiums an der University of Nairobi mit unserer Einwilligung als wissenschaftliche Betreuer*innen der hingewiesenen Universität vorgelegt. Unterschrift__________________________ Datum___________________08/11/2020 Dr. James Orao Unterschrift___________________________ Datum____________________09/11/2020 Dr. Lorna Okoko DANKSAGUNG Dem Gott den HERREN möchte ich zuallererst meinen herzlichen Dank für die Gesundheit und die -

Erinnern Und Vergessen in Christian Krachts Romanen
Acta Universitatis Wratislaviensis • No 3647 Literatura i Kultura Popularna XX, Wrocław 2014 Paweł Wałowski Universität Zielona Góra (Polen) Erinnern und Vergessen in Christian Krachts Romanen 1. Einleitung Erinnern und Vergessen sind bekanntlich unentbehrliche Leistungen des menschlichen Gedächtnisses, um ein kohärentes Selbstbild schaffen, modifizieren und an die Herausforderungen des Jetzt anpassen zu können. Wenn man die na- menlosen Ich-Erzähler in den ersten drei Romanen von Christian Kracht bedenkt, so sind die naiven, suchenden Erzählfiguren durch einen gestörten Selbst- und Ver- gangenheitsbezug bestimmt. Ihre Erinnerungen sind bruchstückhaft, manipuliert oder gar ausgelöscht. Der Anteil des Vergessens einerseits und die Unfähigkeit der Protagonisten dem Erlebten Sinn und Bedeutung zuzuschreiben andererseits machen die Identitätsarbeit der Erzählfiguren problematisch. Das Faszinosum der Romane von Christian Kracht regt immer wieder literaturwissenschaftliche Dis- kussionen an. Die Verortung des vorliegenden Ansatzes im Dreieck ,Erinnern- Vergessen-Identität‘ erlaubt es, neue Erkenntnisse zur Konstitution der fiktionalen Erzählfiguren von Kracht zu gewinnen. Im folgenden Beitrag kommt es also dar- auf an, die Inszenierung und Ästhetisierung von Erinnern und Vergessen (in ihrem Zusammenspiel) zu untersuchen. Es handelt sich hier in erster Linie um den Fo- kus auf das individuelle Gedächtnis der Ich-Erzähler. Nur im Falle von Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten legt der Roman eine stärkere Beach- tung der strukturellen Meta-Ebene des Romans nahe. Die Analyse der erinnerten Inhalte und des Modus ihrer Darstellung gibt Aufschlüsse über die Identität der Figuren. Ihre (fehlende) Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit soll ebenso beachtet werden. Als nicht weniger relevant erscheinen in diesem Kontext die Inhalte, die bewusst übergangen, nicht erinnert, verdrängt — also vergessen werden.