Der Rhein. Naturgeschichte Eines Deutschen Stromes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
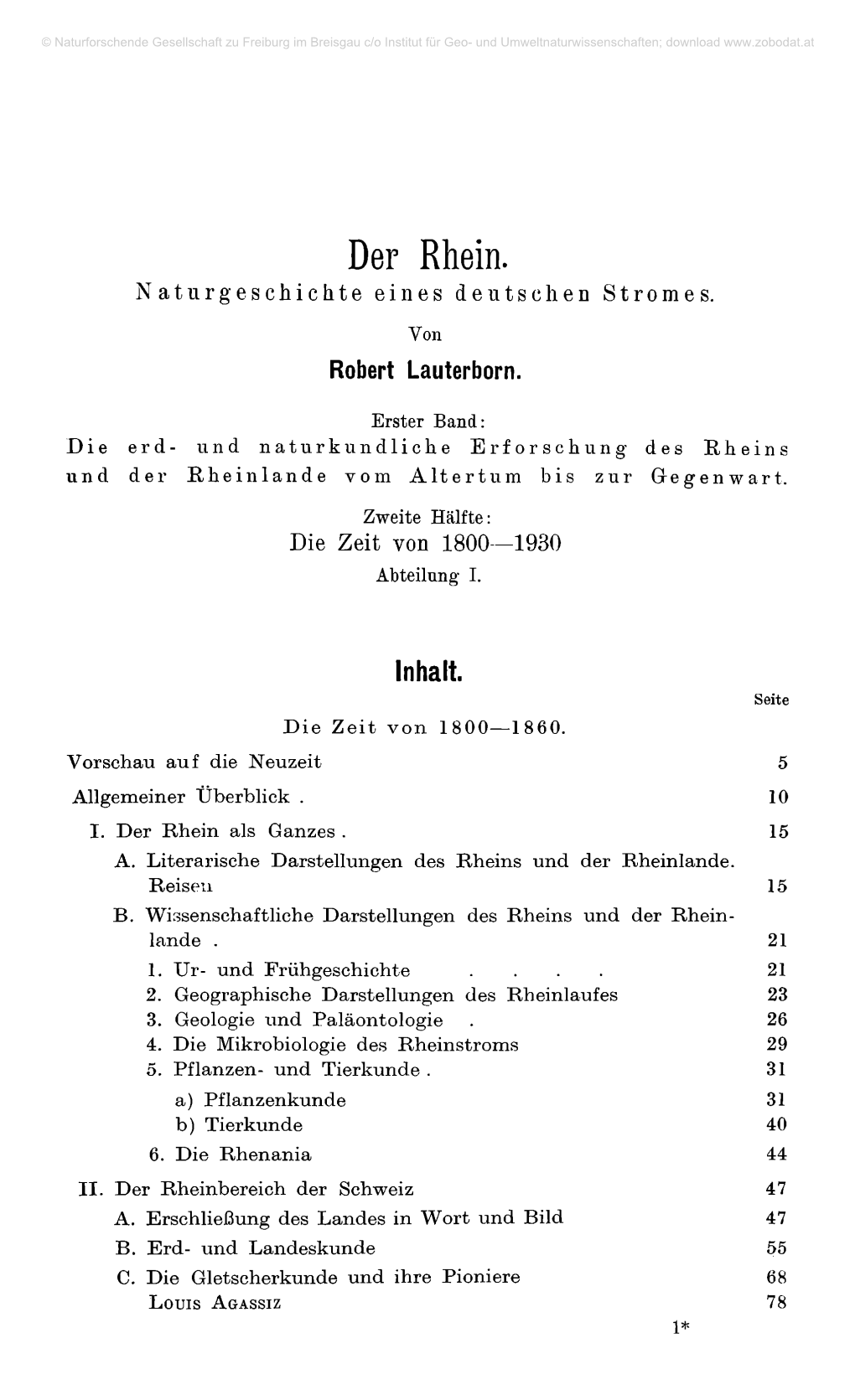
Load more
Recommended publications
-

A Review of the Status of Larger Brachycera Flies of Great Britain
Natural England Commissioned Report NECR192 A review of the status of Larger Brachycera flies of Great Britain Acroceridae, Asilidae, Athericidae Bombyliidae, Rhagionidae, Scenopinidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevidae, Xylomyidae. Species Status No.29 First published 30th August 2017 www.gov.uk/natural -england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background Making good decisions to conserve species This report should be cited as: should primarily be based upon an objective process of determining the degree of threat to DRAKE, C.M. 2017. A review of the status of the survival of a species. The recognised Larger Brachycera flies of Great Britain - international approach to undertaking this is by Species Status No.29. Natural England assigning the species to one of the IUCN threat Commissioned Reports, Number192. categories. This report was commissioned to update the threat status of Larger Brachycera flies last undertaken in 1991, using a more modern IUCN methodology for assessing threat. Reviews for other invertebrate groups will follow. Natural England Project Manager - David Heaver, Senior Invertebrate Specialist [email protected] Contractor - C.M Drake Keywords - Larger Brachycera flies, invertebrates, red list, IUCN, status reviews, IUCN threat categories, GB rarity status Further information This report can be downloaded from the Natural England website: www.gov.uk/government/organisations/natural-england. For information on Natural England publications contact the Natural England Enquiry Service on 0300 060 3900 or e-mail [email protected]. -

The Glarus Alps, Knowledge Validation, and the Genealogical Organization of Nineteenth-Century Swiss Alpine Geognosy
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RERO DOC Digital Library Science in Context 22(3), 439–461 (2009). Copyright C Cambridge University Press doi:10.1017/S0269889709990081 Printed in the United Kingdom Inherited Territories: The Glarus Alps, Knowledge Validation, and the Genealogical Organization of Nineteenth-Century Swiss Alpine Geognosy Andrea Westermann Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Argument The article examines the organizational patterns of nineteenth-century Swiss Alpine geology. It argues that early and middle nineteenth-century Swiss geognosy was shaped in genealogical terms and that the patterns of genealogical reasoning and practice worked as a vehicle of transmission toward the generalization of locally gained empirical knowledge. The case study is provided by the Zurich geologist Albert Heim, who, in the early 1870s, blended intellectual and patrilineal genealogies that connected two generations of fathers and sons: Hans Conrad and Arnold Escher, Albert and Arnold Heim. Two things were transmitted from one generation to the next, a domain of geognostic research, the Glarus Alps, and a research interest in an explanation of the massive geognostic anomalies observed there. The legacy found its embodiment in the Escher family archive. The genealogical logic became visible and then experienced a crisis when, later in the century, the focus of Alpine geology shifted from geognosy to tectonics. Tectonic research loosened the traditional link between the intimate knowledge of a territory and the generalization from empirical data. 1. Introduction In 1878, Albert Heim (1849–1937) published a monograph on the anatomy of folds and the related mechanisms of mountain building based on what he had observed in the Glarus district of Mounts Todi¨ and Windgallen,¨ an area where, in today’s calculation, rocks aged between 250 and 300 million years overlie much younger rocks aged about 50 million years. -

James Hutton's Reputation Among Geologists in the Late Eighteenth and Nineteenth Centuries
The Geological Society of America Memoir 216 Revising the Revisions: James Hutton’s Reputation among Geologists in the Late Eighteenth and Nineteenth Centuries A. M. Celâl Şengör* İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Ayazağa 34469 İstanbul, Turkey ABSTRACT A recent fad in the historiography of geology is to consider the Scottish polymath James Hutton’s Theory of the Earth the last of the “theories of the earth” genre of publications that had begun developing in the seventeenth century and to regard it as something behind the times already in the late eighteenth century and which was subsequently remembered only because some later geologists, particularly Hutton’s countryman Sir Archibald Geikie, found it convenient to represent it as a precursor of the prevailing opinions of the day. By contrast, the available documentation, pub- lished and unpublished, shows that Hutton’s theory was considered as something completely new by his contemporaries, very different from anything that preceded it, whether they agreed with him or not, and that it was widely discussed both in his own country and abroad—from St. Petersburg through Europe to New York. By the end of the third decade in the nineteenth century, many very respectable geologists began seeing in him “the father of modern geology” even before Sir Archibald was born (in 1835). Before long, even popular books on geology and general encyclopedias began spreading the same conviction. A review of the geological literature of the late eighteenth and the nineteenth centuries shows that Hutton was not only remembered, but his ideas were in fact considered part of the current science and discussed accord- ingly. -
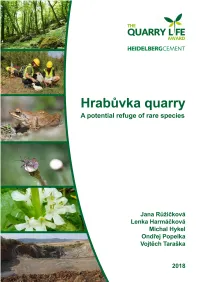
Final Project Report
Contestant profile ▪ Contestant name: Jana Růžičková ▪ Contestant occupation: Postdoctoral fellow ▪ University / Organisation Department of Zoology and Laboratory of Ornithology Faculty of Science, Palacký University Olomouc 17. Listopadu 50, 771 46 Olomouc, Czech Republic MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group Eötvös Loránd University, Biological Institute Pázmány Péter sétány 1/C, 1117 Budapest, Hungary ▪ Number of people in your team: 5 Project overview Title: Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species Contest: (Research/Community) Research Quarry name: Hrabůvka 1/3 Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species Jana Růžičková, Lenka Harmáčková, Michal Hykel, Ondřej Popelka & Vojtěch Taraška Abstract The main aim of this project was to conduct a biological survey in Hrabůvka quarry with an emphasis to south part of the quarry premises called Bobroviště. Specifically, this area is composed of various habitats, including forests, open soils, ruderal habitats and a sewage water body. Based on our findings, we suggest appropriate interventions or changes in management to support and enhance local biodiversity. Our results showed that species composition of plants and animals in the quarry premises is characterized mostly by common species (with only few plant taxa exception) without any specific habitat requirements. We found that the most botanically valuable habitats in Bobroviště are the forest fragment and the spring with its immediate vicinity. Since wetland habitats became valuable in the respect of climate changes in the last few years, we suggest creating new ponds and a littoral zone in the sewage water body to enhance biodiversity of this area and consequently increase water retention in the landscape. Introduction Mining areas are often perceived by the public as a scar on the landscape. -

Proceedings of the United States National Museum
Proceedings of the United States National Museum SMITHSONIAN INSTITUTION . WASHINGTON, D.C. Volume 121 1967 Number 3569 SOLDIER FLY LARVAE IN AMERICA NORTH OF MEXICO ' By Max W. McFadden ^ The Stratiomyidae or soldier flies are represented in America north of Mexico by approximately 237 species distributed through 37 genera. Prior to this study, larvae have been described for only 21 species representmg 15 genera. In addition to the lack of adequate descriptions and keys, classification has seldom been attempted and a phylogenetic treatment of the larvae has never been presented. The present study has been undertaken with several goals in mind: to rear and describe (1) as many species as possible; (2) to redescribe all previously described larvae of North American species; and (3), on the basis of larval characters, to attempt to define various taxo- nomic units and show phylogenetic relationships withm the family and between it and other closely related familes. Any attempt to establish subfamilial and generic lunits must be regarded as tentative. This is especially true in the present study since larvae of so many species of Stratiomyidae remain unknown. Undoubtably, as more species are reared, changes mil have to be made in keys and definitions of taxa. The keys have been prepared chiefly for identification of last mstar larvae. If earher mstars are known, they either have been 1 Modified from a Ph. D. dissertation submitted to the University of Alberta E(hnonton, Canada. ' 2 Entomology Research Division, U.S. Dept. Agriculture, Tobacco Insects Investigations, P.O. Box 1011, Oxford, N.C. 27565. : 2 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL MUSEUM vol. -

Die Gründung Der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft Und Ihre Seitherige Entwicklung
Die Gründung der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft und ihre seitherige Entwicklung Autor(en): Nabholz, Walter K. Objekttyp: Article Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae Band (Jahr): 76 (1983) Heft 1: Zentenarfeier der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-165350 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Eclogae geol. Helv. Vol. 76/1 Seiten 33-45 4 Textfiguren Basel. März 1983 Die Gründung der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft und ihre seitherige Entwicklung Von Walter K. Nabholz1) Als Lukas Hauber 1973-1976 Präsident unserer Gesellschaft war. bat er mich, auf die Hundertjahrfeier hin eine Geschichte unserer Gesellschaft zu schreiben. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Download (760Kb)
b u b UNIVERSITAT BERN UNIVERSITY LIBRARY OF BERNE Special exhibition: July 10, 2007 Cartography over the last 1200 years: Treasures of the Burghers' Library of Berne and the University Library of Berne Treasures of the University Library of Berne | downloaded: 6.10.2021 https://doi.org/10.7892/boris.57711 22nd International Conference on the History of Cartography source: Berne, July 8-13, 2007 Cover illustration Detail of the working plan for the stuccowork by Lorenz Schmid in the Library Hall at the Central Library, 1792 (Location: Burghers' Library Berne). Access to maps, globes and measuring instruments was also included in the plans for the Library Hall. Library Hall The decisive breakthrough leading to the conversion of the Central Library came in 1784. By virtue of his post [Stiftschaffner], Johann Friedrich von Ryhiner (1732-1803) oversaw the Hohe Schule (the forerunner of Berne University) and the Library. The Library was equipped with an anteroom (today the Hallersaal at the Burghers' Library) and a Library Hall (today the Schultheissen Room at the Central Library), which was ready for use in 1794. The portraits of former Schultheissen or mayors, which gave the room its name, were not.transferred to the Library until 1857. The Library Hall in Berne, which is of the type known as a gallery library, has a restrained elegance on account of its narrow width and the lighting from both sides. The ceiling painting by lgnaz Franz Keil (ea. 1744-1814), dated 1789, shows the coronation of Minerva by Apollo. The seven liberal arts are gathered on Mount Parnassus: astronomy (Ptolemy), music (Tubal Cain), geometry (Euclid), arithmetic (Pythagoras), rhetoric (Cicero), dialectics (Aristotle) and grammar (Priscian). -

Bir Bilim Adamının Serüveni "Celâl Şengör Kimbı" Söyleşi: Sefa Kaplan
bir bilim adamının serüveni "Celâl Şengör Kimbı" Söyleşi: Sefa Kaplan TÜRKİYE ^BANKASI Genel Yayın: 2024 sefa kaplan 1956’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun, Konya, Urfa ve Ankara’da tamamladı. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Fakülteyi son sınıfta, Elazığ’da başlayıp İstanbul’da sürdürdüğü öğretmenliği ise 1984’te bırakıp gazeteciliğe ilk adımını attı. Aralarında N okta ve A ktüel’in de yer aldığı çeşitli yayın organlarında çalıştı. 1995 ile 2000 yılları arasında Londra’da yaşadı. Yağmur Gökhan, İlteriş Özhan ve İren Özlem’in babası. Halen Hürriyet gazetesinde görev yapıyor. İlk şiirleri 1978’de Türk Edebiyatı dergisinde yayımlandı. KİTAPLARI: ŞİİR: Sürgün Sevdaları (1984), İnsan Bir Yalnızlıktır (1990, Behçet Necatigil Şiir Ödülü), Seferberlik Şiirleri (1994), Disconnectus Erectus 2+1 (1995), Londra Şiirleri (2001), Mecûsi Şiirleri (2003) d ü z y a z i: Tarih Tereddütten İbarettir (1990), Yahya Kemal Beyatlı (Seçmeler, 1994), Kemal Derviş, Bir Kurtarıcı Öyküsü (2002), İyi Okuma, Sürdürülebilir Bir Eleştiri Teorisi Üzerine Pratik Metinler (2002), Derviş’in Siyaseti, Siyasetin Dervişi (2003), Öyküler Seni Söyler (2003), 19lS’te Ne Oldu ? (2005), Batılı Gezginlerin Gözüyle İstanbul (2005), 99 Sayfada İstanbul Depremi (Prof. Celâl Şengör ile birlikte, 2006) NEHİR SÖYLEŞİ - 42 - BtR BtLtM ADAMININ SERÜVENİ CELÂL ŞENGÖR KİTABI SÖYLEŞİ SEFA KAl’I-AN ©TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, 2010 Sertifika No: 11213 DİZİ EDİTÖRÜ LEVENT CİN EMRE GÖRSEL YÖNETMEN BİROI. BAYRAM düzei.ti/dİzin ŞÖHRET BAI.TAŞ GRAFİK TASARIM UYGULAMA TÜRKÎYE iş BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI I. BASKI: EKİM lOIO ISBN 978-605-360-004-6 BASKI YAYLACIK MATBAACILIK LİTROS YOLU FATİH SANAYİ SİTESİ NO: 11/197-103 TOPKAPI İSTANBUL (0212)612 58 60 Sertifika No: 11931 Bu kitabın tüm yayın haklan saklıdır. -

Table of Contents
Table of Contents John F. Thie Remembering Wellness in Touch For HealthlKinesiology 1 Jenni Beasley Advanced Kinesiology Centres Educating Alternatives 27 Paul Dennison Educational Kinesiology 34 Bruce A. 1. Dewe Professional Kinesiology Practitioner Certification 40 Joan. R. Dewe Programme Carl Ferreri Neural Organization Technique 47 Kerryn Franks The Multi Dimensional Healing Model using 50 Transformational Kinesiology Charles Krebs The Learning Enhancement Advanced Program 58 Philip Maffetone What is Applied Kinesiology? 89 Philip Mafferone Sports Kinesiology: The Use of Complementary 92 Sports Medicine Philip Rafferty Kinergetics: Kinesiology and Healing Energy Workshops 109 Wlter Schmitt, Jr. Heart-Focused Principles and Techniques 126 Jimmy Scott The Health Kinesiology System 133 Rosmarie Sonderegger Integrative Kinesiologie 149 Bernhard Studer Gordon Stokes Three In One Concepts 156 Wayne Topping Wellness Kinesiology 165 Richard Utt The Applied Physiology Approach 180 William Whisenant Psychological Kinesiology: Changing the Body's Beliefs 198 All materiiilSconUUned hereiri are-copynght © 1g-98, 1999 by the authors and the Touch for Health Kinesiology Association. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the authors. REMEMBERING WELLNESS IN TOUCH FOR HEALTHIKINESIOLOGY A History, Context And Vision For Touch For Health, the First 25 Years And The Next Millennium By JOHN F TIDE D.C. We are celebrating the 25th anniversary of the better life. Our concepts of Wellness integrate the publication of the Touch For Health manual holistic world view of the East, as well as the and over 30 years of growth, transition, vitalistic tradition in the West as espoused in the branching out, and reintegration. -

Charles Lyell Talks About, Reads About, and Looks at Loess Ian Smalley, Holger Kels, Tivadar Gaudenyi, Mladjen Jovanovic
Loess encounters of three kinds: Charles Lyell talks about, reads about, and looks at loess Ian Smalley, Holger Kels, Tivadar Gaudenyi, Mladjen Jovanovic Geologos 22, 1 (2016): 71–77 doi: 10.1515/logos-2016-0006 Loess encounters of three kinds: Charles Lyell talks about, reads about, and looks at loess Ian Smalley1,*, Holger Kels2, Tivadar Gaudenyi3, Mladjen Jovanovic4 1Giotto Loess Research Group, Geography Department, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK, e-mail: [email protected] 2Geography Department, RWTH Aachen University, Templergragen 55, 52056 Aachen, Germany, e-mail: [email protected] 3Geographical Institute ‘Jovan Cvijic’, Serbian Academy of Sciences & Arts, 11000 Belgrade, Serbia, e-mail: [email protected] 4Physical Geography, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, 21000 Novi Sad, Serbia, e-mail: [email protected] *corresponding author Abstract Charles Lyell (1797–1875) was an important loess pioneer. His major contribution was to distribute information on the nature and existence of loess via his influential book ‘The Principles of Geology’. He was obviously impressed by loess when he encountered it; the initial encounter can be split into three phases: conversations about loess; confronting the actual material in the field; and reading about loess in the literature. Detail can be added to an important phase in the scientific development of the study of loess. Significant events include conversations with Hibbert in 1831, conversa- tions and explorations with von Leonhard and Bronn in 1832, the opportunity to include a section on loess in vol. 3 of ‘Principles’ for publication in 1833, a substantial Rhineland excursion in 1833, the reporting of the results of this excur- sion in 1834, discussions at the German Association for the Advancement of Science meeting in Bonn in 1835. -

Produced by Unz.Org Electronic Reproduction Prohibited 468 Fellows
•^.,,^^1.1^^ Lj^ii^(iiiffl3J»K-i:^se^* LIST OF THE FELLOWS AND FOREIGN HONOEAEY MEMBEKS. RESIDENT FELLOWS. —194. (Number limited to two liuiidred.) CLASS L — Mathematical and Physical Sciences. — 72. SECTION I. — 6. William P. Dexter, Eoxbury. Mathematics. Amos E. Dolbear, Medford. William E. Byerly, Cambridge. Charles W. Eliot, Cambridge. Moses G. Farmer, Newport. Benjamin A. Gould, Cambridge. Thomas Gaffield, Boston. Gustavus Hay, Boston. Wolcott Gibbs, Cambridge. James M. Peirce, Cambridge. John D. Kunkle, Brookline. Erank A. Gooch, Cambridge. Edwin P. Seaver, Newton. Edwin H. Hall, Cambridge. Henry B. Hill, Cambridge. SECTION II. —13. K". D. C. Hodges, Salem. Practical Astronomy and Geodesy. Silas W. Holman, Boston. J. Ingersoll Bowditoh, Boston. Eben N. Horsford, Cambridge. T. Sterry Hunt, Montreal. Seth C. Chandler, Jr., Cambridge. Charles L. Jackson, Cambridge. Alvan Clark, Cambridgeport. William W. Jacques, Newburyporfc. Alvan G. Clark, Cambridgeport. Leonard P. Kinnicutt, Cambridge. George B. Clark, Cambridgeport. Joseph Levering, Cambridge. John R. Edmands, Cambridge. Charles F. Mabery, Cambridge. Henry Mitchell, Boston. William E. Nichols, Boston. Robert Treat Paine, Brookline. John M. Ordway, Boston. Edward C. Pickering, Cambridge. WilUam H. Pickering, Boston. William. A. Rogers, Cambridge. Robert H. Richards, Boston. Arthur Searle, Cambridge. Edward S. Ritchie, Brookline. Leopold Trouvelot, Cambridge. Stephen P. Sharpies, Cambridge. Henry L. Whiting, Tisbury. Francis H. Storer, Jamaica Plain. SECTION IIL —38. John Trowbridge, Cambridge. Cyrus M. Warren, Brookline. Physics and Chemistry. Charles H. Wing, Boston. A. Graham Bell, Cambridge. Edward S. Wood, Cambridge. Clarence J. Blake, Boston. Francis Blake, Auburndale. SECTION IV. —15. John H. Blake, Boston. Technology and Engineering. Thos. Edwards Clark, WiUiamstown. George R.