Vogelzug Schneifel 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
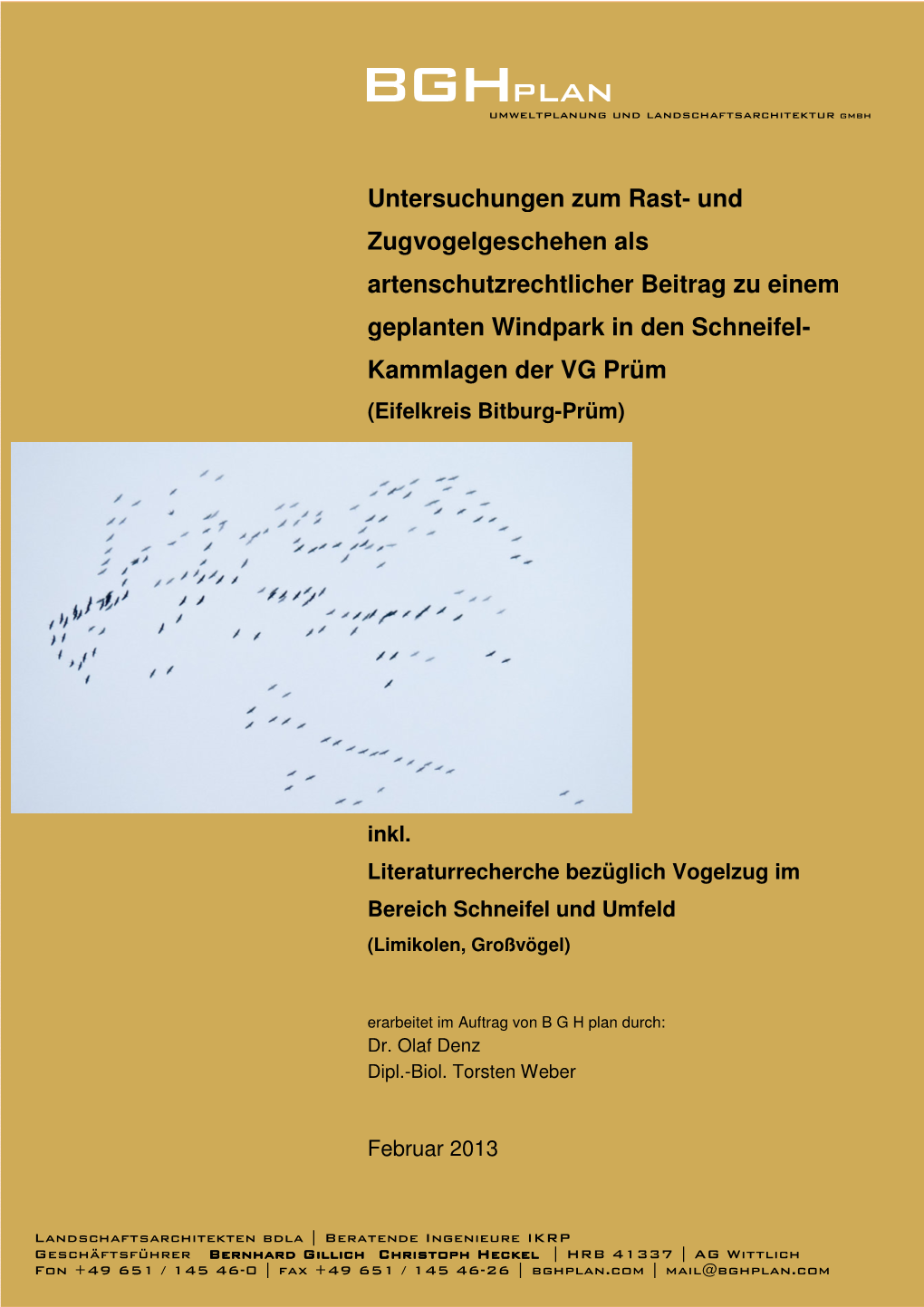
Load more
Recommended publications
-

Verbandsgemeinde Prüm
Verbandsgemeinde Prüm Teilfortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Prüm (6. Fortschreibung) Mit Schreiben/E-Mail vom 25.10.2019 wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Nachbargemeinden und die Nachbarstaaten gem. § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 (2) BauGB, § 2 (2) BauGB und § 4a (V) BauGB erneut am Verfahren beteiligt. Gleichzeitig fand in der Zeit vom 04.11.2019 bis einschließlich 13.12.2019 die erneute Offenlage der Planunterlagen gem. § 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB statt. Die Bekanntmachung der erneuten Offenlage erfolgte in der Prümer Rundschau Ausgabe 43/2019, 44. Jahrgang am Samstag, den 26.10.2019. Während der Beteiligungsverfahren gingen folgende Stellungnahmen gem. § 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB von Privaten ein: Stellungnahme ......................................................................................................................................................................................................................................3 1. Schreiben des Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., Fasanerie 1, 55457 Gensingen, Az: Mail v. 25.10.19; LJV-Nr.: 4/L-496/2019 vom 13.11.2019 ..........3 2. E-Mail der ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden vom 28.11.2019 ......................................................................................................................5 3. Schreiben vom 01.12.2019 (Schweich) ........................................................................................................................................................................................ -

Windpark "Schneifel"
VERBANDSGEMEINDE PRÜM Windpark "Schneifel" FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN Auftraggeber: Windpark TEVEN GmbH & Co.KG Großer Burstah 42 20457 Hamburg Entwurf März 2016 Bearbeitung: Gin ster Landschaft + Umwelt Marktplatz 10a 53340 Meckenheim Tel.: 0 22 25 / 94 53 14 Fax: 0 22 25 / 94 53 15 [email protected] Faunistische Erfassungen: Bearbeitung: Dr. Andreas Blaufuß-Weih I INHALTSVERZEICHNIS 1 Anlass und Aufgabenstellung .............................................................................. 1 2 Übersicht über das Plangebiet ............................................................................. 2 2.1 Lage des geplanten Windparks ............................................................... 2 2.2 Naturräumliche Situation ........................................................................ 3 2.3 Charakterisierung des Untersuchungsraumes ......................................... 4 3 Beschreibung des Vorhabens................................................................................ 5 3.1 Technische Beschreibung ....................................................................... 5 3.2 Mögliche Auswirkungen auf Avifauna und Fledermäuse .......................... 5 3.2.1 Mögliche Auswirkungen auf Vögel .......................................................... 6 3.2.2 Mögliche Auswirkungen auf Fledermäuse ............................................... 7 4 Untersuchungen Vögel ............................................................................................ 9 4.1 Untersuchungsmethodik ....................................................................... -

Prüm – Gondenbrett – Schwarzer Mann – Sellerich Rundwanderung Über Den Höchsten Berg Der Schneifel. Länge, Dauer, Beso
Prüm – Gondenbrett – Schwarzer Mann – Sellerich Rundwanderung über den höchsten Berg der Schneifel. Länge, Dauer, besondere Hinweise: 24 Kilometer, ca. 5 ½ Stunden. 250 Meter Anstieg von Gondenbrett zum Schwarzen Mann, allerdings über eine Strecke von fast 7 Kilometern, gut zu bewältigen. Im letzten Drittel (hinter Sellerich) etwas schwierige Navigation. Auf Wegzeichen achten und Beschreibung genau befolgen. Wanderkarte erforderlich. Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Schneifel, 54595 Gondenbrett, Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Dienstag Ruhetag. Blockhaus „Zum schwarzen Mann“, Telefon 06551 – 32 52, April bis Oktober 10 Uhr bis 20 Uhr, November bis März 9 Uhr bis 20 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag außer bei Skibetrieb. http://www.blockhaus-schwarzer-mann.com/de/index.htm Empfohlene Wanderkarte: Eifelverein Nr. 17, Prümer Land. Anfahrt und Parkmöglichkeiten: Von Norden: Über die A1 bis zum Autobahnende, dann auf der B51 (Anschlussstelle Blankenheim) Richtung Luxemburg. Direkt hinter Dausfeld nach rechts auf die B410 und kurz danach wieder nach rechts nach Prüm hinein. Nach scharf rechts auf die Heldstraße (B265), dann nach links in die Hahnstraße und geradeaus weiter in die Bahnhofstraße. Parkmöglichkeiten am Bahnhof und bei mehreren Supermärkten. Wegbeschreibung: Die Wanderung startet am Hahnplatz vor der Basilika, wo man auch die ersten Wegzeichen des Eifelvereins findet (Weiße Welle auf schwarzem Grund für den Maas-Rhein-Weg und den geschlossenen Keil für den Willibrordusweg). Man geht die Hahnstraße hinauf vorbei an der Touristinformation, dann nach links in die Hillstraße und direkt nach rechts in die Enggasse. Am Ende der Enggasse vor der Schule nach rechts. 200 Meter danach, dort wo sich die Straße gabelt, nach links. -

Auf Entdeckungsreise Zu Den Schätzen Der Eifel Inhalt
präsentiert: Gäste-Journal GÄSTEINFORMATION DER TOURIST-INFORMATIONEN NORDEIFEL SÜDEIFEL VULKANEIFEL OSTEIFEL Herbst/Winter 2019-20 Auf Entdeckungsreise zu den Schätzen der Eifel MET EEN GE Foto: Christoph Gerhartz NEDERLBIAJLNDA SE Wandererlebnis im Schiefer- land Kaisersesch. mehr auf S. 29 Inhalt Vogelsang 2 Tourist-Informationen der Eifel 3 Stadt Jülich 4 Hotel Grafenwald 5 Panorama 6 Partnerregion Moselland 8 Entspannung & Wellness 10 Kultur & Museen 12 Historisches & Orte 14 Mechernich 16 Niederländischer Innenteil präsentiert von Eifel eXclusive 17 Ardenner Cultur Boulevard 25 Bierstadt Bitburg 26 Bitburger Marken-Erlebniswelt 27 Wandern & Co. 28 Weihnachten 31 Spaß & Erleben 32 Ausflugsziele 36 Eifelkarte 37 Veranstaltungen 38 Verbandsgemeinde Prüm 39 Eifel - Wanderurlaub Roman Wagner 40 Feuer, Wasser, Luft & Erde - kaum eine andere Region in Deutschland ist so von den Ele- menten geprägt wie die Eifel. Ein sehenswerter Landstrich, der besonders ausgiebig beim Wandern erkundet werden kann. Der Eifelsteig zählt zu den beliebtesten Wander wegen in Deutschland und punktet in Sachen Wege qualität. Rund Eifelsteig, Butzerbachtal 300 km von Aachen bis nach Foto: Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Trier können in 15 Etappen er- wandert werden. Verschiedene Pauschalen wie z.B. „Pilgerweg des Friedens“ (Prüm - Gerol- stein), machen es möglich, den Eifelsteig in kleineren Touren zu entdecken. Eine Premium- qualität bieten ebenfalls die 23 Rundwanderwege des grenz- überschreitenden NaturWan- derPark delux. Sie führen durch Foto: Hammen und Hammen, Trierweiler Foto: Vogelsang IP Foto: Klangwelle die Südeifel, die Luxemburger Ardennen und durch die Re- Familien-Erlebniskarte Vogelsang Klangwelle gion Müllerthal. Wald, Wasser Ausflugstipps und Sehenswürdig- Das beeindruckende Ausstellungs- Ein Fest für die Sinne - die "Klang- 02657-8090 & Wildnis lautet das Motto des keiten für einen Familienurlaub in und Bildungszentrum Vogel sang welle" in Bad Neuenahr-Ahrweiler. -

Luxemburgischer Naturpark
Radtour Jünkerath – Luxemburgischer Naturpark - Vianden - Jünkerath <> ca. 168 Km: Jünkerath (Start & Ziel) – Stadtkyll – Kerschenbach – Ormont – Forsthaus Schneifel 655 üNN über B 265 (Naturpark Nordeifel) – Schwarzer Mann 697 üNN (Schneifel) – Alferberg – Bleialf – Großlangenfeld links – Rauenheck 588 üNN – Heckhuscheid – Großkampenberg – Lützkampen – Harspelt – Sevenig – Langfuhr – Dahnen – Dasburg (Grenze Luxemburg; Luxemburgischer Naturpark) –entlang der Our- Rodershausen – Kohnenhof - Obereisenbach – Übereisenbach (Grüne Straße Eifel-Ardennen) – Untereisenbach – Gemünd – Keppelshausen – Vianden (Grenze N 17 / B 50 links) – Roth B 50 (Paic Naturel) – Obersgegen – Geichlingen – hinter Niedergeckler B 50 links – Neuerburg rechts – Scheuern – Altscheuern – Uppershausen – Krautscheid 586 üNN – Waxweiler – Lascheid – Gesotz links – Nimsreuland – Schönecken rechts – Hersdorf – Loch – Wallersheim – Büdesheim über B 410 – Oos – Neuoos – Kalenborn -Scheuern – Weihermühle links – Auel – Lissendorf links – Gönnersdorf - Jünkerath Die Schneifel ist ein Gebirgszug in den westlichen Hochlagen der Eifel. Die Schneifel verläuft von Brandscheid bei Prüm nach Nordosten bis Ormont entlang der Grenze zu Belgien. Der Begriff Schneifel hat nichts mit Schnee oder Eifel zu tun: Er leitet sich aus dem früheren Sprachgebrauch dieser Region ab und bedeutet so viel wie Schneise. Diese Schneise wiederum verlief über den Höhenzug. Der Begriff Schneifel wurde dann in der Zeit der Preußen „eingedeutscht“ und der Begriff Schnee-Eifel, welcher allerdings ein größeres Gebiet beschreibt, war geboren. Unmittelbar an der Landesgrenze zum Großherzogtum Luxemburg und mitten im Naturpark Südeifel liegt im romantischen Tal der Our der schöne und beliebte Fremdenverkehrsort Dasburg. In einem kleinen Seitental im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark gelegener Ort mit Grenzübergang. Dasburg war eine Lehnsburg der Grafen von Vianden. 1794 fiel sie in französische Hände und wurde 1811 dem Marschall Oudinot geschenkt, der sie 1813 zum Abbruch verkaufen ließ. -

Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Prüm
Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Prüm Sachliche und räumliche Teilfortschreibung Windenergie Erläuterungsbericht Januar 2016 Auftraggeber: Verbandsgemeinde Prüm Tiergartenstraße 54 54595 PRÜM Tel. 06551-943-0 Landschaftsarchitekten bdla | Beratende Ingenieure IKRP Geschäftsführer: Bernhard Gillich, Christoph Heckel | HRB 41337 | AG Wittlich Posthof am Kornmarkt | Fleischstraße 56 -60 | 54290 Trier Fon +49 651 / 145 46-0 | fax +49 651 / 145 46-26 | bghplan.com | [email protected] Inhalt INHALT Einführung .............................................................................................................................................................. 1 1.1 Begründung der sachlichen und räumlichen Teilfortschreibung ............................................ 1 1.2 Gesetzliche und planerische Vorgaben ............................................................................................. 2 1.3 Verhältnis der Landschaftsplanung zum Umweltrecht ................................................................ 3 1.4 Methodik ....................................................................................................................................................... 3 1.5 Momentaner Zustand und absehbare Entwicklungstendenzen .............................................. 4 Beurteilung des Zustandes und mögliche Beeinträchtigungen durch die Windenergie .......... 6 2.1 Boden ............................................................................................................................................................ -

Eifel-Blicke in Voreifel Und Kalkeifel
Schöne Aussichten im Eifeler Naturpark Vorwort der Autorin EIFEL-BLICKE IN VOREIFEL UND KALKEIFEL... Ceologischer Wanderpfad bei Zülpich-Bürvenich Freilichtmuseum bei Mechernich-Kommern Informationen: Geologischer Wanderpfad bei Zülpich-Bürvenich Informationen: Freilichtmuseum bei Mechernich-Kommern Stadtturm bei Bad Münstereifel Galgennück bei Mechernich-Lorbach Informationen: Stadtturm bei Bad Münstereifel Informationen: Galgennück bei Mechernich-Lorbach Brehberg bei Mechernich-Weyer Michelsberg bei Bad Münstereifel-Mahlberg Informationen: Brehberg bei Mechernich-Weyer Informationen: Michelsberg bei Bad Münstereifel-Mahlberg Königsberg bei Kall-Urft Pferdekopf bei Kall-Rinnen Informationen: Königsberg bei Kall-Urft Informationen: Pferdekopf bei Kall-Rinnen Hagelkreuz bei Nettersheim-Buir Enzenberg bei Nettersheim Informationen: Hagelkreuz bei Nettersheim-Buir Informationen: Enzenberg bei Nettersheim Über den Nettersheimer Erlebnispfad Wanderung zum Eifel-Blick „Enzenberg" (2/7 Kilometer) Kalk und seine Nutzung 48 / Orchideen 50 / Matronenheiligtümer bei Nettersheim 52 Mühlenberg bei Nettersheim-Marmagen Lühbergstraße in Blankenheim http://d-nb.info/1011167921 Informationen: Mühlenberg bei Nettersheim-Marmagen Informationen: Lühbergstraße in Blankenheim Burg Blankenheim und ihre Wasserleitung 62 Nonnenbacher Weg bei Blankenheim Hühnerberg bei Blankenheim-Lommersdorf Informationen: Nonnenbacher Weg bei Blankenheim Informationen: Hühnerberg bei Blankenheim-Lommersdorf Missionskreuz Heidenkopf bei Dahlem Friedhof bei Dahlem Informationen: -

Aussichtspunkte in Der Nordeifel Wanderweg Monschauer Land Und Nationalpark Und Hocheifel Ahrradweg Tälerroute Monschauer Land-Touristik E.V
Die sind unter anderem angebunden Informationen rund um die erhalten Sie bei: an folgende Wander- und Radwege: Alle Panoramafotos der und nützliche Informationen finden Sie im Internet unter Nordeifel Tourismus GmbH Eifelsteig Rur-Ufer-Radweg Bahnhofstraße 13 Alle gibt es mit Panoramaaufnahmen in zwei Büchern: 53925 Kall Wildnis-Trail Eifeler Quellenpfad Tel.: 02441 994570 www.nordeifel-tourismus.de Eifel-Blicke, Band 1 Eifel-Blicke, Band 2 Römerkanal- Die 29 schönsten Panoramen in Rureifel, Die 28 schönsten Panoramen in Kalkeifel Jakobsweg Aussichtspunkte in der Nordeifel Wanderweg Monschauer Land und Nationalpark und Hocheifel Ahrradweg Tälerroute Monschauer Land-Touristik e.V. Autorin: Maria A. Pfeifer . ISBN 978-3-7616-2418-0 Autorin: Maria A. Pfeifer . ISBN 978-3-7616-2493-7 Seeufer 3 52152 Simmerath Eifel-Höhen-Route Erft-Radweg Tel.: 02473 93770 www.eifel-tipp.de www.franke-grafikbuero.de . Kylltalradweg Wasserburgen-Route Das Projekt ist eine Initative vom: Naturpark Nordeifel e.V. im Deutsch-Belgischen Naturpark und an die örtlichen Wanderwege des Eifelvereins. Mechernich Rureifel-Tourismus e.V. Bahnhofstr. 16 . 53947 Nettersheim An der Laag 4 . Premiumwanderung „Eifel-Blicke genießen“ Tel.: 02486 911117 Fax: 02486 911116 Franke, Erleben Sie einen genussvollen Tag bei der kulinarischen 52396 Heimbach . Tel.: 02446 8057911 [email protected] www.naturpark-eifel.de Premiumwanderung (ca. 16 km) auf dem Eifelsteig und Grafikbüro www.rureifel-tourismus.de dem Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel. Information und Gefördert durch: Buchung unter: www.nordeifel-tourismus.de Layout: Eifel-Blick „Schöne Aussicht“ Simmerath A 61 Düren Aachen Im Naturpark Nordeifel bieten zahlreiche Aussichts- Übersicht der 21. Monschau-Mützenich – „Steling“ 42. Nettersheim-Marmagen – „Mühlenberg“ Kornelimünster Ketz A 44 Kreuzau punkte eindrucksvolle Panoramen der abwechs- 1. -

Weg Des Friedens
Die Vulkaneifel-Pfade Der Komm mit erzählen Geschichten Schneifel -Pfad auf den Schneifel-Pfad! Unter dem Motto „Wo Fels und Wasser dich begleiten“ Du wirst einen weg des führt der Eifelsteig als Premiumwanderweg mitten durch die Vulkaneifel. Um die Vielzahl sehens- und er- Friedens beschreiten – lebenswerter Standorte und Abschnitte in der Vulkan- eifel erlebbar zu machen, wurden 14 Vulkaneifel-Pfade aber auch einen des Krieges! Folge den Spuren des Heili- geschaffen, die als Prädikats-Partnerwege gleichsam als Weg gen Jakobus, entdecke Drachenzähne und Bunkerruinen, Zuwege und Bereicherung dienen. Hierzu zählt auch der sieh in Explosionskrater und finstere Höhlen, erblicke Schneifel-Pfad. Orte künstlerischer Anmut und natürlicher Schönheit!“ – des so lädt das Element Feuer ein zu einer mehrtägigen Wan- Eine besondere Aufwertung erfahren einige Vulkan- derung vom Startpunkt nahe des Kronenburger Sees über eifel-Pfade durch Geschichten, die an ausgesuchten Friedens Prüm, Schönecken und Birresborn bis nach Gerolstein. Muße-Plätzen inszeniert und erzählt werden. Dieses Konzept des Geschichtenerzählens ist ein Gemein- Mit 75 km ist der Schneifel-Pfad der längste der Vulkanei- schaftsprojekt der Eifel Tourismus GmbH, der regionalen fel-Pfade. Er führt buchstäblich durch eine Landschaft mit Natur- und Geoparke sowie der örtlichen Tourist-Infor- Höhen und Tiefen. Finstere und lichte Zeiten haben ihre mationen und wird über LEADER und aus Naturparkmit- Spuren hinterlassen, hier wurde Geschichte geschrieben. teln des Landes gefördert. Besondere Plätze widmen sich Episoden dieser Geschich- te. Sie fordern Ihre Achtsamkeit und schenken Ihnen die Darüber hinaus besteht ein großes Angebot geführter Muße, den Zauber der Schneifel für sich zu entdecken und Wanderungen, auf denen qualifizierte Gästeführer die Teil an ihren Geschichten zu haben. -

Extratour:Winterwanderung Am Schwarzen Mann E Ù Ú 9
1 Extratour: Winterwanderung am Schwarzen Mann Extratour:Winterwanderung am Schwarzen Mann e Ù Ú 9 Tour für Schneewanderer (w) õõõ Was liegt in der Schneifel – manche sagen auch Schnee-Eifel – näher als eine Schneewanderung? Am Schwarzen Mann werden im Winter sogar einige Wege speziell für Winterwanderer präpariert. Diese Tour führt durch hohen Winterwald an alten Bunkern des Westwalls entlang. Sie ist kurz genug, um sie mit einem Rodelnachmittag oder ersten Schritten auf Skiern zu kombinieren. P Start/Ziel: Blockhaus Schwarzer Mann, GPS N 50°15.887’ E 006°22.368’ E 6,5 km z 2 Std. é ê 98 m/98 m + 618-694 m = vereinzelte Schilder „Wandern“ P als Winterwanderweg geräumter bzw. verdichteter Schnee, ansonsten breite Wald- wege e Blockhaus „Zum Schwarzen Mann“ (km 6,4) 3 unterwegs keine Gelegenheiten für eine Rast auf Sitzbänken, an Rastplätzen oder in Schutzhütten 5 einige Multis im Umfeld des Rundwegs Ganz ehrlich? Vermutlich werden Ihre Kinder lieber am Blockhaus rodeln, Ski fahren oder schaukeln wollen. Streckenlänge und Beschaffenheit sind schon für Schulan- fänger zu schaffen, gleich zu Beginn lässt sich ein Stück bergab rodeln. Am Block- haus gibt es einige Streicheltiere und einen Spielplatz. W Der Weg wird zwar speziell für Winterwanderer geräumt bzw. verdichtet, Sie benöti- gen dennoch große Räder und einiges an Kraft, um den Weg mit einem Buggy zu meistern. Alternativ bietet sich ein Schlitten an. õ Bitte Wasser im Rucksack mitnehmen. Eine Leine ist nicht nötig, gefährliche Straßen sind weit entfernt. B Der Weg ist nicht mit dem ÖPNV erreichbar. P Parkmöglichkeit gegenüber dem Blockhaus/Skihang o aktueller Schneewetterbericht auf : wordpress.blockhaus-schwarzer-mann.de Extratour: Winterwanderung am Schwarzen Mann 2 Der Weg beginnt am südwestlichen Ende des Parkplatzes, also in der Ecke, die am weitesten vom Blockhaus Schwarzer Mann entfernt ist.