Thomas Bach - Präsident
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
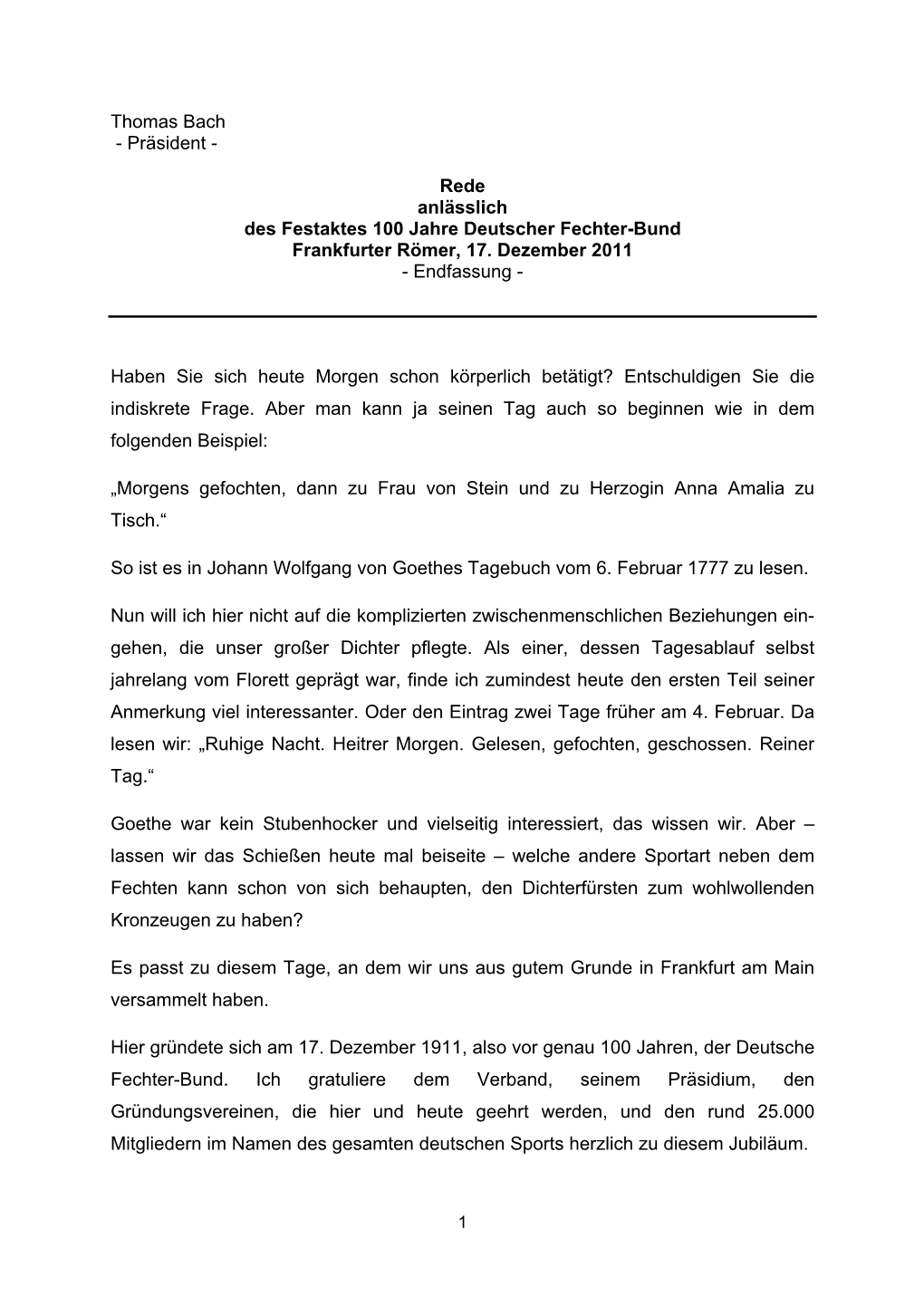
Load more
Recommended publications
-

Mr. Thomas Bach President International Olympic Committee Château De Vidy Case Postale 356 1001 Lausanne, Switzerland
Mr. Thomas Bach President International Olympic Committee Château de Vidy Case postale 356 1001 Lausanne, Switzerland Dear President Bach: Human Rights First welcomed your successful efforts and those of the entire International Olympic Committee to amend Principle 6, the anti-discrimination provision of the Olympic Charter, to include specific reference to sexual orientation. As you know, discrimination and violence against lesbians, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people is of great concern worldwide, and the IOC’s leadership on this issue stands as an example to all. This important advance is now facing a critical test. Kazakhstan, a country that is vying to host the 2022 Winter Olympic Games, is considering legislation patterned on a controversial Russian law that would ban "propaganda of non-traditional sexual relations." The bill has been passed by the Kazakh legislature. If it is signed into law, it will threaten the fundamental freedoms, and indeed the safety, of LGBT people in Kazakhstan. Because of Kazakhstan’s Olympic bid and the clarity of Principle 6, you and the IOC are in a unique position to weigh in on this pending law. We ask you to urge Kazakh President Nursultan Nazabayev to honor his country's international human rights commitments and reject the homophobic bill now awaiting his signature. The situation for members of the LGBT community in Kazakhstan is already precarious. Many LGBT people face discrimination and violence; some remain closeted out of fear. Police have failed consistently to respond to acts of violence against LGBT people, and in some cases police have perpetrated these acts. A recent wave of homophobic rhetoric has included calls for blood tests to identify and root out gay men. -

Welcome to the Issue
Welcome to the issue Volker Kluge Editor It is four years since we decided to produce the Journal triple jump became the “Brazilian” discipline. History of Olympic History in colour. Today it is scarcely possible and actuality at the same time: Toby Rider has written to imagine it otherwise. The pleasing development of about the first, though unsuccessful, attempt to create ISOH is reflected in the Journal which is now sent to 206 an Olympic team of refugees, and Erik Eggers, who countries. accompanied Brazil’s women’s handball team, dares to That is especially thanks to our authors and the small look ahead. team which takes pains to ensure that this publication Two years ago Myles Garcia researched the fate of can appear. As editor I would like to give heartfelt the Winter Olympic cauldrons. In this edition he turns thanks to all involved. his attention to the Summer Games. Others have also It is obvious that the new edition is heavily influenced contributed to this piece. by the Olympic Games in Rio. Anyone who previously Again there are some anniversaries. Eighty years ago believed that Brazilian sports history can be reduced the Games of the XI Olympiad took place in Berlin, to to football will have to think again. The Olympic line of which the Dutch water polo player Hans Maier looks ancestry begins as early as 1905, when the IOC presented back with mixed feelings. The centenarian is one of the the flight pioneer Alberto Santos-Dumont with one of few surviving participants. the first four Olympic Diplomas. -

DOSB L Sportplakette Des Bundespräsidenten Verleihung Am 17
DOSB l Sport bewegt! DOSB l Sportplakette des Bundespräsidenten Verleihung am 17. Dezember 2011 Römer, Frankfurt am Main © picture alliance © picture www.dosb.de www.dsj.de www.twitter.com/dosb www.twitter.com/trimmydosb www.facebook.de/trimmy Inhaltsverzeichnis l PROGRAMM .................................................................................................................... 4 l F ESTANSPRACHEN �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Petra Roth, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt ��������������������������������������������������������������������������������������� 5 Christian Wulff, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland .................................................................. 6 Thomas Bach, Präsident des DOSB ................................................................................................................... 8 l LAUDATIONES .................................................................................................................14 Verleihung an die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e. V. ..........................................................15 Verleihung an den Männer-Turnverein 1861 Schöningen e. V. �������������������������������������������������������������������������16 Verleihung an den Deutschen Fechter-Bund ...................................................................................................17 l STIMMEN .......................................................................................................................19 -

Zuzana Rehák Štefečeková
SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ REVUE .SK OLYMPICJAR / LETO DVAKRÁT STRIEBORNÁ MEDAILISTKA SA PO ROKOCH VRACIA POD PÄŤ KRUHOV AKO DVOJNÁSOBNÁ MAMA ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ 01 Titulka OK.indd 1 25.06.2021 13:34 Danka Barteková ŠPORTOVÁ STREĽBA #pripraveninatokio | www.olympic.sk/tokio Ďakujeme nášmu exkluzívnemu partnerovi 002-003 editorial.indd 2 25.06.2021 9:10 FOTO: JÁN SÚKUP EDITORIAL VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA, počas posledného roka som dostával veľa otázok, či sa budú vôbec konať olympijské hry v Tokiu. Od vlaňajšieho marca, keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prijal po vypuknutí pandémie COVID-19 bezprecedentné rozhodnutie o presune Hier II. olympiády na rok 2021, sa objavilo veľa skeptických hlasov. U nás, i v samotnom Japonsku. Bol som opti- mista, v čom ma utvrdzovali správy od organizátorov. Od začiatku tvrdili, že hry usporiadajú a ich prioritou je predovšet- kým bezpečnosť. Otázka teda nemala znieť, či hry budú, ale ako budú vyzerať. Som presvedčený, že nás čakajú zlo- mové olympijské hry. Počas sedemnás- tich dní medzi 23. júlom a 8. augustom dostane celé ľudstvo novú nádej. Podu- jatie však rozhodne aj o budúcej podobe športu. Ak nevzniknú problémy a nestúp- ne chorobnosť, šport sa na dlhšie obdo- bie neobmedzí a budú sa konať aj ďalšie významné podujatia. Všetci sme zvedaví, ako bude podujatie moríne. Na návštevníkov čakajú dni plné múzeum. Športové srdce na Slovensku tak vyzerať. Pre fanúšikov doma pred obra- športu, zábavy či dobrého jedla. začína biť nanovo. zovkami sa toho veľa nezmení, ale pre Presun Hier II. olympiády o rok ne- Významným naším projektom je športovcov to bude iné. Zažili sme si však skôr zapríčinil, že len pol roka po ich skon- Olympijský odznak všestrannosti. -

SWORD British Fencing Magazine JANUARY 2014
THE SWORD British Fencing Magazine JANUARY 2014 A TRIBUTE TO MATTHEW THOMPSON (1956-2013) P16 FIE CELEBRATES CENTENARY IN LAVISH STYLE P19 NEW LEON PAUL FENCING CENTRE P23 THE SAINSBURY’S SCHOOL GAMES P33 Combative KRUSE Richard Kruse is World Combat Games champion P18 JANUARY 2014 Editor Malcolm Fare Pyndar Lodge, Hanley Swan, Worcs WR8 0DN T: 01684 311197 Welcome to THE sword F: 01684 311250 E: [email protected] Print Warwick Printing Co Ltd Caswell Road, Leamington Spa, Warwickshire CV31 1QD T: 01926 883355 F: 01926 883575 Design and Layout Jon Labram T: 020 7674 7171 E: [email protected] Advertising BFA T: 0208 742 3032 E: [email protected] British Fencing accepts no responsibility for the contents of advertisements and reserves the right to refuse inclusion. NEWS The Sword, a quarterly magazine founded 4-6 AGM – Finances; Growth in the North-East; Open forum; in 1948, is distributed to all individual Olympic fencer chairs IOC Commission; Foil co-ordinator; and club members of British Fencing and its affiliates. It can also be obtained on Navy fencing wins top award; drop in fencing participation; subscription – UK £20 FIE congress decisions Overseas airmail £26 – direct from HQ. MESSAGE FROM THE CHAIR Contributions are welcome. Photographs 8 New year message from David Teasdale should include the names of those pictured and the photographer. REPORTS 10-15 BEAZLEY BRITISH CHAMPIONSHIPS Views expressed in The Sword do not Karim Bashir reports on the senior British championships necessarily reflect those of British Fencing. No part of the magazine may be 16-17 WHEELCAHIR CHAMPIONSHIPS reproduced without permission from the The British Disabled Fencing Association held their national editor/photographer. -

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 44
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 1. November 1999 Betr.: Titel, Big Brother, SPIEGEL ONLINE eder Handgriff hat im deutschen Gesundheitssystem Jseinen Preis, und weil das so ist, verschlingt das Ge- schäft mit der Krankheit immer mehr Geld – allein in die- sem Jahr rund 550 Milliarden Mark.Wochenlang haben die SPIEGEL-Redakteure Jan Fleischhauer, 37, und Alexander Jung, 33, den bürokratischen Wildwuchs des angeblich besten Gesundheitswesens der Welt durchforstet.Am Ende erkannte Fleischhauer: „Das System selbst hängt am Tropf und wird ohne radikale Therapie bald kollabieren.“ Die jetzt anstehende Reform des Gesundheitswesens jeden- falls kuriert allenfalls an Symptomen. Das mag mit an den SPIEGEL 38/1999 beiden Protagonisten des rot-grünen Reformprojektes lie- gen. „Ministerin Andrea Fischer und SPD-Sozialexperte Rudolf Dreßler können einfach nicht miteinander“, sagt SPIEGEL-Autor Hans- Joachim Noack, 59. Sein Kollege Hans Halter, 61, selbst Arzt, liefert für den Titel Beispiele aus dem medizinischen Alltag; Wissenschaftsredakteur Harro Albrecht, 38, ebenfalls Mediziner und vor einigen Jahren als Krankenhausarzt in England tätig, nutzt seine Erfahrungen für einen europäischen Vergleich. SPIEGEL-Korrespon- dentin Michaela Schießl, 37, beschreibt den amerikanischen Weg. Es ist das zweite SPIEGEL-Titelstück zu diesem Thema innerhalb kurzer Zeit, und zweimal stand auch die in Danzig geborene Magdalena Strahl, 26, Modell – in Heft 38/1999 für neue Erkenntnisse bei der Gesundheitsvorsorge, diesmal als Opfer in den Klauen des Me- dizinkartells (Seite 32). eorge Orwells Roman „1984“ Ghat SPIEGEL-Redakteur Claus Christian Malzahn, 36, im Schul- unterricht gelesen – jetzt holte er das vergilbte Stück über den „Big Bro- ther“ aus gegebenem Anlass wieder hervor: In den Niederlanden besuch- te Malzahn eine gleichnamige Reality- Show, bei der sich ein paar junge Leu- te rund um die Uhr von 24 Kameras / HOLLANDSE HOOGTE FLYMEN C. -

August 18, 2020 VIA EMAIL International Olympic Committee Executive Board Château De Vidy P.O. Box 356 1007 Lausanne, Switzerl
Akiva Shapiro Direct: +1 212.351.3830 Fax: +1 212.351.6340 [email protected] August 18, 2020 Client: 23490-00001 VIA EMAIL International Olympic Committee Executive Board Château de Vidy P.O. Box 356 1007 Lausanne, Switzerland [email protected] HRH Prince Feisal Al Hussein Kirsty Coventry Dr. Thomas Bach Ivo Ferriani President Nicole Hoeverts [email protected] Mikaela Cojuangco Jaworski Nenad Lalovic John Coates, AC Robin E. Mitchell Anita L. DeFrantz Nawal El Moutawakel Ser Miang Ng Denis Oswald Zaiqing Yu Gerardo Werthein Vice Presidents Members Re: Religious Accommodation for Beatie Deutsch in Scheduling the Tokyo 2021 Women’s Marathon Dear Dr. Bach and IOC Executive Board Members: I write on behalf of Beatie Deutsch, Israel’s marathon national champion, to request that the Tokyo 2021 Women’s Marathon event be held on a day other than a Saturday.1 Ms. Deutsch is an Orthodox Jewish woman who, due to her religious observance, will be unable to compete if the marathon is held on a Saturday. From sundown on Friday to sundown on Saturday, Ms. Deutsch observes the Jewish Sabbath (the “Shabbat”), a day of rest. During this time, she refrains from running and competing. Ms. Deutsch’s path to the Olympic games has been far from ordinary. Ms. Deutsch ran her first marathon less than five years ago, at the age of 26, after having four children. She ran her second marathon while seven months pregnant with her fifth child. She did not participate in track and field in high school or college. And she only began training with a 1 The Executive Committee has the authority under the Olympic Charter to direct or override scheduling decisions. -

1 July 23, 2021 Thomas Bach President International Olympic
July 23, 2021 Thomas Bach President International Olympic Committee Château de Vidy Case postale 356 1001 Lausanne, Switzerland VIA Fax: +41 21 621 62 16 (Lausanne) Dear President Bach: We are writing to ask the International Olympic Committee (IOC) to postpone the XXIV Olympic Winter Games scheduled to be held in China in February 2022 and to relocate them if the host government does not change its behavior. No Olympics should be held in a country whose government is committing genocide and crimes against humanity. On October 10, 2018, the then-Chairs of the Commission, Senator Marco Rubio and Congressman Christopher H. Smith, sent a letter to you asking you to use the good offices of the IOC to press for human rights improvements in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). We received no reply. Since the 2018 letter, the situation facing Uyghurs and other Muslim ethnic communities in the XUAR has deteriorated further, as documented by the Commission and numerous other governmental and non-governmental entities around the world. Earlier this year, the State Department determined that the Chinese government’s actions constitute genocide and crimes against humanity. We have seen no evidence that the IOC has taken any steps to press the Chinese government to change its behavior. We believe that it would reflect extremely poorly on the Olympic movement, and the international community in general, if the IOC were to proceed with holding the Olympic Games in a country whose government is committing genocide and crimes against humanity as if nothing were wrong. To proceed with business as usual is implied consent and suggests the IOC has learned nothing from the Chinese government’s use of the 2008 Beijing Olympics to score propaganda wins and distract from its appalling human rights record. -

Olympsport Slaví 50
ROČNÍK 49. (2016) ČÍSLO 2 (169) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII HRY XXXI. OLYMPIÁDY 2016 IO DE JANEIRO STARTUJÍ SRPNA R 5. ME v kopané 2016 Francie OOllyymmppssppoorrtt ssllaavvíí 5500 lleett 33 Čas je b ěžec dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si, čas ten bere všechno skokem, za každého po časí. Hlavu máš bílou, pokud nejsi lysý na o čích vrásky nast řádané. Jak stojí psáno, cos nevid ěl kdysi, co už se nestalo, to už se sotva stane Nevím už, který veršotepec má uvedený slovní skvost na sv ědomí, ale pln ě stojím za ním a dávám mu za pravdu. A jako část prózy bych, i když se to nijak zvláš ť nerýmuje, ješt ě na záv ěr p řidal dv ě slova: OLYMPSPORT padesátiletý... Zvu Vás! Pro všechny ty, na které zapomenout nelze, poj ďte a poslyšte pov ěsti dávných čas ů. Poj ďte a vzpome ňte na všechny ty, na které se snad ani zapomenout nedá. Za čátky byly jiho české. T ři jména: Strakonický nikoliv Dudák, ale Bušek, evangelický fará ř, filatelista a skaut, duchovní otec toho, co p řetrvalo již zmín ěnou polovinu století. Jarda Justýn, vyu čený peka ř, pozd ěji kancelá řský technik, filatelistický polyglot a skaut, sezením v Milevsku a kone čně t řetí do party, snad major, snad podplukovník K říž, vždy p řipravený nikoliv k obran ě vlasti, ale k tisku zpravodaje Olympsport. To tedy byli ti t ři první¸otcové zakladatelé. V pr ůběhu n ěkolika málo týdn ů čítala členská základna tém ěř 150 člen ů. -

DE LA Xxrv' Olymptade À Séoul
LES RESULTATS DES f EUX DE LA xxrv' oLYMPTADE À sÉoul DU 17 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 19BB fl eux cent trente-sept épreuves étaient proposées aux athlètes dans vingt-sept disciplines des l-l vi¡'¡9¡-¡¡6is sports inscrits au programme olympique, auxquelles s'ajoutaient deux sports et une épreuve de démonstration ainsi que deux épreuves à l'intention des handicapés. Abréviations utilisées : NRM, nouveau record mondial ; NRMF, nouveau record mondial (finale) ; ERM, égalise le record mondial ; NRO, nouveau record olympique ; NMPO, nouvelle meilleure perfor- mance olympique ; DQ, disqualifié. 493 Les feux de la XXIV" Olympiade Athlétisme Mexico, est bien tombé, avec le bond de 17,61 m du Bulgare Hristo Markov, soit 22 cm de mieux. Athlet¡cs Autre surpr¡se en saut en hauteur féminin, et pas des moindres pour Louise Ritter (USA) elle-même qui Atletismo battit la détentrice du record du monde Stefka Kostadi- nova (BUL) avec un bond de 2,03m. Chez les hommes, Cuennadi Avdeenko IURS) fut /e seu/ à franchir 2,38m alors que la bataille pour la médaille d'argent opposa 1 es épreuves d'athlétisme ont débuté le 23 septem- trois heures durant les tro¡s concurren¿s suivants. Ceux- I bre avec le marathon féminin remporté par Rosa ci franchirent 2,36m tous les trois, Hollis Conway (USA), Mota, première médaille d'or féminine du Portugal aux pour avoir réussi au premier essai, remporta la médaille Jeux d'été. Menant Ia course de bout en bout, /a Portu' d'argent suivi de Roudolf Povarn¡tsyne (URS) et de gaise n'a pas pour autant souffert de la solitude du cou' Pazick Sjoberg (SWE), tous deux à la troisième p/ace. -

Fechtsport Magazin 6 2013.Pdf
Offizielles Organ des Deutschen Fechter-Bundes e. V. Nr. 6 • 2013 • 32. Jahrgang • 5273 CAROLIN DAS GROSSE GOLUBYTSKYI IST INTERVIEW MIT FECHTERIN DES DFB-PRÄSIDENT JAHRES 2013 GORDON RAPP 12/13 | pyruswerbeagentur.de 12/13 Frohe Weihnachten! EDITORIAL INHALT 12/13 | pyruswerbeagentur.de 12/13 Ein erfolgreiches Jahr für die Fechter FECHTFORUM 4 Zum Tod von Paul Gnaier 4 En Garde. Jochen Färber 5 Am Ende des nacholympischen Jahres können wir erneut auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Bei den Europameisterschaften in Zagreb gewannen INTERVIEWS Frohe Weihnachten! Interview mit DFB-Präsident die deutschen Fechter drei Gold- und eine Bronzeme- daille. So ein glänzendes Ergebnis haben wir lange Gordon Rapp 6 nicht erreicht! Ein kämpferisches Herrenflorettteam, Damenflorett-Cheftrainer des DFB ein verletzter Peter Joppich, der einen schweren und des FC Tauberbischofsheim, Schicksalsschlag verkraften musste, und Degen-Old- star Jörg Fiedler haben uns zum Jubeln gebracht. Andrea Magro 18 Außerdem sorgte Carolin Golubytskyi mit EM-Bronze für ein weiteres sportliches Ausrufezeichen. Bei der FECHTER DES JAHRES WM in Budapest hat sich Britta Heidemann mit dem Carolin Golubytskyi Bronze-Gewinn einmal mehr als Medaillengarantin erwiesen. Zudem bestätigte Carolin Golubytskyi als „Fechterin des Jahres 2013“ 10 Vizeweltmeisterin ihre Konstanz und ihren Platz ganz Gordon Rapp oben in der Damenflorett-Weltspitze. SENIOREN Veteranen-WM in Varna 12 Diese Erfolge stehen im Einklang mit unseren sportlichen Zielvorgaben, die 2014 noch eine Stufe höher sind. Positiv ist zu vermerken, dass auch junge Sportler oben angeklopft haben. Deutsche Senioren-Meisterschaften Ob Sebastian Bachmann, Marius Braun oder Falk Spautz: Sie haben alle gezeigt, dass ihre in Bad Dürkheim 14 fechterischen Vorbilder in der Zukunft eine starke Konkurrenz haben werden. -
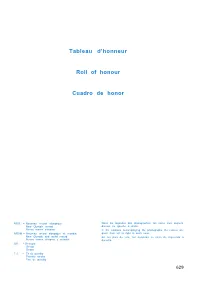
Tableau Dhonneur
Tableau d’honneur Roll of honour Cuadro de honor NRO = Nouveau record olympique Dans les legendes des photographes, les noms sont toujours New Olymplc record donnes de gauche a droite. Nueva marca olimpica. In the captions accompanying the photographs the names are NROM = Nouveau record olympique et mondial given from left to right in each case. New Olymplc and world record En los pies de foto, los nombres se citan de izquierda a Nueva marca olimpica y mundial. derecha. GR = Groupe Group Grupo. T. S. = Tir de penalty Penalty stroke Tiro de penalty 629 ● 5000 m 1. Said Aouita (MAR) (NRO) 13’05”59 Athlétisme 2. Markus Ryffel (SUI) 13’07”54 3. Antonio Leitao (POR) 13’09”20 Athletics 4. Tim Hutchings (GBR) 13’11”50 5. Paul Kipkoech (KEN) 13’14”40 Atletismo 6. Charles Cheruiyot (KEN) 13’18”41 ● 10 000 m 1. Alberto Cova (ITA) 27’47”54 2. Michael Mc Leod (GBR) 28’06”22 3. Mike Musyoki (KEN) 28’06”46 4. Salvatore Antibo (ITA) 28’06”50 1. Hommes - Men - Hombres 5 . Christoph Herle (FRG) 28’08”21 6. Sosthenes Bitok (KEN) 28’09”01 ● 100 m 1. Carl Lewis (USA) 9”99 ● 110 m haies, hurdles, vallas 2. Sam Graddy (USA) 10”19 1. Roger Kingdom (USA) (NRO) 13”20 3. Ben Johnson (CAN) 10”22 2. Greg Foster (USA) 13”23 4. Ron Brown (USA) 10”26 3. Arto Bryggare (FIN) 13”40 5. Michael Mc Farlane (GBR) 10”27 4. Mark McKoy (CAN) 13”45 6. Ray Stewart (JAM) 10”29 5.