Jahresbericht Des Römisch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
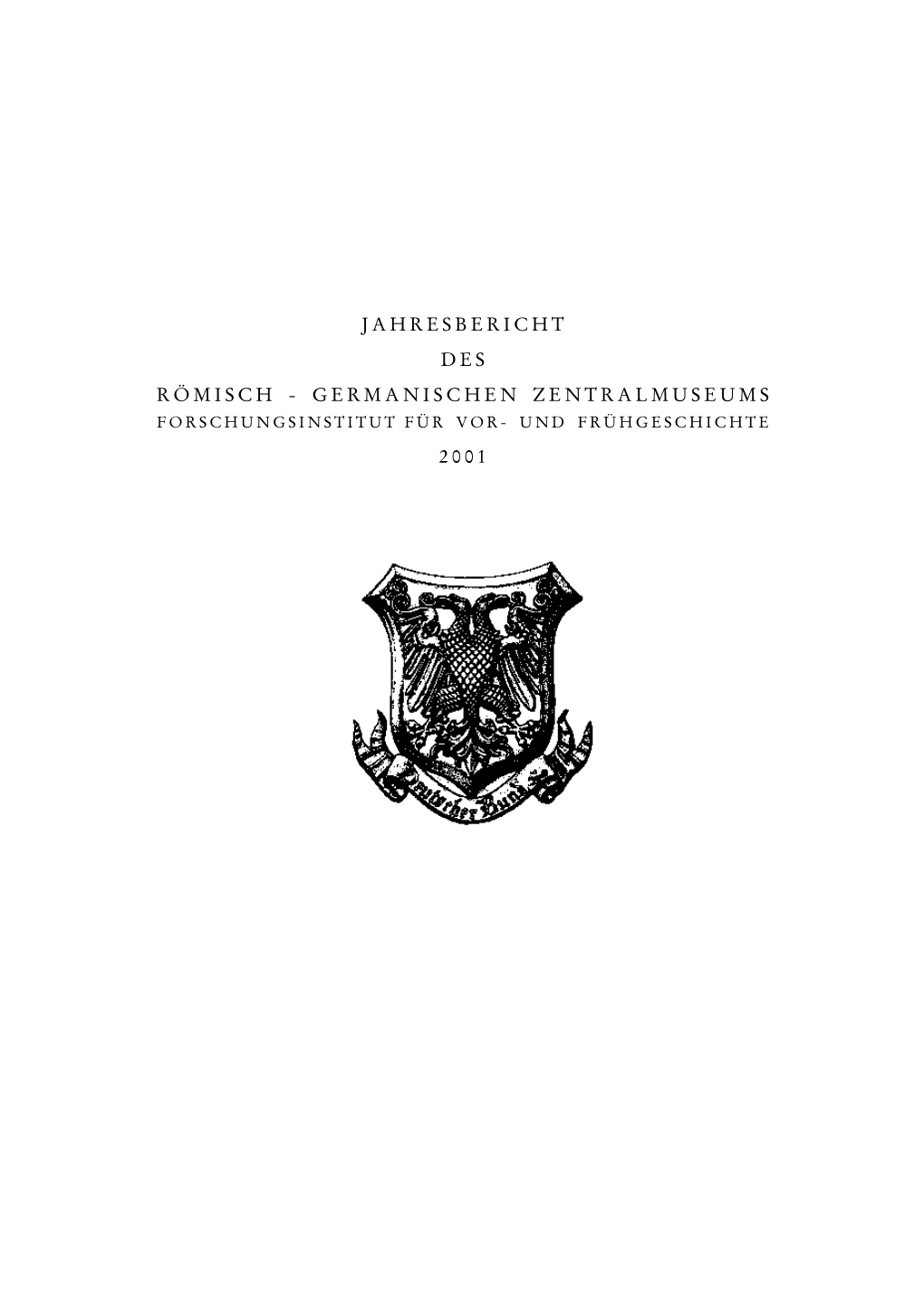
Load more
Recommended publications
-

Zur Mineralogie Und Geologie Des Koblenzer Raumes Des Hunsrücks Und Der Osteifel
Der Aufschluß Sonderband 30 (Koblenz) Heidelberg 1980 Zur Mineralogie und Geologie des Koblenzer Raumes des Hunsrücks und der Osteifel Schriftleitung: BolkoCRUSE, Koblenz Herausgegeben von der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie (VFMG) e. V., Heidelberg Druck: PELLENZ-DRUCKEREI - E. Badock - 5472 Plaidt V INHALT VORWORT (Bolko Cruse) VII MEYER, W.: Zur Erdgeschichte des Koblenzer Raumes 1 CRUSE, B.: Neue Haldenfunde von Corkit im Bad Emser Gangzug im Vergleich zu denen der „Grube Schöne Aussicht" bei Dernbach/Ww. 11 CRUSE, B.; KNOP, H.; RONDORF, E.; TERNES, B.: Mineralvorkommen im nördlichen Rheinland-Pfalz (mit 15 Fundortbeschreibungen und 16, teils färb., Mineralfotos) . 19 BEYER, H.: Eine Magnesium-Mineralgenese als Folge primärer biologi scher Stoffanlage und sekundärem vulkanischem Erhitzungsprozeß am Arensberg/Eifel 45 LEHNEN. O.: Einführung in die Nomenklatur und die Klassifikation der Effusivgesteine des Laacher Vulkangebietes 57 REBSKE, W.: Allgemein-vulkanische Exkursion mit Einführung in die äußere Form der Vulkane, Ergüsse, Maarbildungen, etc. des ter tiären und quartären Vulkanismus 65 KNEIDL, V.: Zur Geologie des Hunsrücks 87 WILL, V.: Haldenfunde im Hunsrückschief er 101 SIMON, W.: Erdgeschichte am Rhein - Historische Anmerkungen .... 109 VII Vorwort Die Grundlage dieses Sonderbandes bildet die Tagungsunterlage der VFMG- Sommertagung 1979 in Koblenz. Die darin enthaltenen Fundortbeschreibungen waren als Exkursionsführer gedacht. Sie stehen auch in diesem Band im Mit telpunkt. Umrahmt werden sie von Beiträgen -

Wandern & Rad Fahren Im Vulkanland Eifel
p tief eingekerbten Liesertal, kurz vor Manderscheid mit Blick auf die Verlauf und Markierung liegendes „V“– um Ruine Wernerseck – Burgquelle am Wanderung 6 Endert-Oberlauf und Ulmen weite Hochflächenaussichten und eine rasante Abfahrt ins Moseltal. Wanderung 1 Von der Mosel zur Vulkaneifel: Dem Vulkanismus Ruine der Oberburg. In Manderscheid zur Hauptstraße und auf Markierung Ortsanfang Plaidt – Rauschermühle – Plaidt Ortsmitte – dem Vulka- Nähe Alflen – Ulmen. 7 km dieser rechts aufwärts bis zum Kreisel, dahinter die Haltestelle. Startpunkt Bahnhof Monreal (Eifel-Pellenz-Strecke) auf der Spur. nius-Zeichen* durchs Krufter Bachtal folgen – Kretz umrunden – In Manderscheid: Endpunkt Bahnhof Treis-Karden (Mosel-Strecke) oder Moselradweg Kurz und knapp Im Gegensatz zur wilden Felsenschlucht im Unterlauf präsentiert sich Vulkanologisch Kobern-Gondorf – Ochtendung. 15 km zum Römerbergwerk – Zentralhaltestelle Kretz. sehenswert Das Maarmuseum. Länge, Höhenm. 44 km, ca. 600 Höhenmeter (addiert) aufwärts, ca. 800 m abwärts Kurzvariante die Endert zu Beginn als zahmes Bächlein in ruhiger Waldumgebung, Kurz und knapp Einfache Halbtageswanderung durch ein Seitental der Mosel hinauf Vom Bahnhof Plaidt oder Bus 335 Industriebahn direkt innerorts bestens geeignet für eine erholsame Wanderung nach Ulmen mit Zus. erlebenswert Die Ruhe und Abgeschiedenheit ohne jegliche Ortschaft im Tal, der Verlauf und Vom Monrealer Bahnhof zunächst Abstecher ins Ortszentrum (500 m), zu den ersten Vulkanen. Der ideale Einstieg in die Vulkaneifel! zur Rauschermühle, dann weiter wie Hauptroute (7 km kürzer). genügend Zeit für das Maar-Idyll. Abwechslungsreichtum der Wege und Pfade, die immer neuen An- Markierung dann zurück zum Bahnhof und am Sportplatz vorbei über Pfad durch die Schildern und Vulkanius-Zeichen folgen. sichten der Lieser und schließlich die steilen Felsen kurz vorm Ziel. -

Wage Es, Es Lohnt Sich! Führer Durch Die Vulkanwelt
Wage es, es lohnt sich! Führer durch die Vulkanwelt INFOZENTRUM VULKANPARK Rauschermühle 6, 56637 Plaidt/Saffig Tel.: 0 26 32 – 98 75 0 · E-Mail: [email protected] www.vulkanpark.com 1 Wage es, es lohnt sich! Führer durch die Vulkanwelt Gewidmet meinem im April 2012 verstorbenen Mann Lorenz Bossau 2 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort der Autorin Regina Pickel-Bossau, Andernach S. 4 Hinweise zu eingesetzten Symbolen/Anmerkungen S. 5 1. Vulkanpark im Landkreis Mayen-Koblenz 1.1. Stadt Andernach S. 6 1.2. Verbandsgemeinde Pellenz S. 10 1.3. Verbandsgemeinde Mendig S. 16 1.4. Verbandsgemeinde Vordereifel S. 19 1.5. Stadt Mayen S. 20 2. Vulkanpark Brohltal/Laacher See 2.1 Laacher See und Umland S. 24 2.2. Brohltal S. 26 2.3. Nettetal S. 31 2.4. Vinxtbachtal S. 33 3. Vulkaneifel (Westeifel) 3.1. Route Kempenich - Ulmen S. 36 3.2. Route Ulmen - Bad Bertrich S. 37 3.3. Route Bad Bertrich - Daun S. 38 3.4. Route Daun - Hillesheim S. 40 3.5. Route Hillesheim - Gerolstein S. 41 3.6. Route Gerolstein - Manderscheid S. 41 Schlusswort S. 43 2 3 Vorwort Sehr verehrte Gäste des Vulkanparks, auf Bitte des Vulkanparks Mayen-Koblenz erhoben mein Mann und ich unter Mitwirkung meines Bruders und einer Freundin die für gehbeeinträchtigte Touristen wichtigen Daten zur Zugänglichkeit der Zielpunkte, die ich bereits im 1. Vulkanparkführer 2006 zusammenfasste. Die zahlreichen Rückmeldungen aus dem In-und Ausland zeigen, dass er inzwischen zu einer wertvollen Informationshilfe auch für den Seniorenkreis und für Familien mit Kleinkindern geworden ist. So erhielten wir viele Anregungen, z.B. -

Stein & Burgfest 2009
zum 58sten mal stein- & burgfest das fest im vulkanpark stein- und burgfest ’09 Auf ein Wort Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste! Herzlich willkommen beim Stein- & Burgfest in Mayen. Seit einem halben Jahrhundert ist das Stein- & Burgfest für die Stadt Mayen ein Tag der Besinnung auf die eigene Geschichte und Kultur. In den Anfangsjahren des Festes standen Erinnerung und Gedenken an die Ereignisse des Krieges und der Dank schungsstelle wesentlich zum Gelin- an den gelungenen Wiederaufbau im gen des Vulkanparkes beigetragen. Vordergrund des Festes. Die vorliegende Festschrift ist ihrer fruchtbaren Arbeit in den zurücklie- Seit nun über 10 Jahren fließt aber genden Jahren gewidmet. auch die Entwicklung des Vulkan- parkes, der die Darstellung der Ich darf Sie zum Besuch von Stadt Geschichte und der Kultur einer und Umland, vor allem aber zu ganzen Region zur Aufgabe hat, in einem attraktiven Volksfest herz- die Gestaltung des Stein- & Burg- lich nach Mayen einladen, wenn es festes ein. Maßgeblichen Anteil an in diesen Tagen wieder heißt: zum seiner Entwicklung und Gestaltung 58sten mal Stein- & Burgfest - das hat der hier in Mayen ansässige Fest im Vulkanpark. Forschungsbereich VAT. Mit seiner Forschung, seiner aktiven Denk- malpflege und seinen Konzepten Veronika Fischer zur touristischer Inwertsetzung der Oberbürgermeisterin Geländedenkmäler hat die For- der Stadt Mayen 1 zum 58sten mal wir wir unterstützen… 2 stein- und burgfest ’09 Termine Freitag, 11. September Bürgerschießen der Mayener Bogenschützen 1978 e.V. Sportlerehrung der Stadt Mayen 11:00 Uhr – 18.00 Uhr 19:00 Uhr – Festzelt – Burggärten Live-Musik mit der Mayener Probeschießen bei den Mayener »Old Star Band« Jungschützen St.-Sebastianus- ca. -

Auf Geht's Zur Bahnhofer Kirmes Kurier
Weißenthurmer KurierLOKALANZEIGER für die VG Weißenthurm 27. Juni 2018 • Woche 26 43. Jahrgang • Auflage 15 638 Rommersdorf Festspiele Statistiker suchen noch Unterwegs im Vulkanpark: Deutscher Eck-Cup: 4500 € Haushalte zum Mitmachen Die nächsten Te rmine für die Initiative Kinderglück 15. Juni bis 12. Juli ckets: Veranstaltungen / Ti ele.de Wanderungen durch das Kottenheimer Winfeld und Abtei Rommersdorf, Neuwied rommersdorf-festspi Jetzt bewerben für Einkommens- und Mannschaft des Fußballverbandes Rheinland Verbrauchsstichprobe 2018 S. 3 7000 Jahre Historie im Mayener Grubenfeld S. 4 verteidigt ihren Titel S. 12 Aus der Region Tr aditionelles Schützenfest in Weißenthurm Gut zu wissen. Infos rund um Das sollten Sie alles in Ihrer die Pflege Reiseapotheke mitführen WEISSENTHURM. Der REGION. Handtuch, Duschgel und Sonnenbrille sind Pflegestützpunkt Wei- schon eingepackt – jetzt kann der Sommerurlaub kom- ßenthurm bietet zwei in- men. Damit die freien Tage auch zur schönsten Zeit teressante Infoveranstal- im Jahr werden, empfiehlt es sich, auch eine Reise- tungen zum Thema Pfle- apotheke mit den wichtigsten Medikamenten dabei zu ge an. Am Donnerstag, 5. haben. Neben Sonnenschutz, Desinfektionsmittel und Juli (16.30 Uhr), gibt es Verbandsmaterial gehören auch Notfallmedikamente „Infos und Tipps rund um in das Gepäck. Insbesondere dann, wenn Unverträg- die Pflegeversicherung“ lichkeiten oder Erkrankungen vorliegen, wie eine Al- und am Donnerstag, 26. lergie gegen Insektengift. Zur Grundausstattung ge- Juli (16.30 Uhr), heißt es hören: Schmerz- und Fiebermittel, Wund- und Heilsal- „Menschen mit Demenz be, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Creme für In- verstehen lernen und be- sektenstiche und Sonnenschutzmittel. Für Insekten- gleiten“. Beide Veranstal- giftallergiker empfiehlt sich ein Notfallset. Als Allergiker tungen finden in den müssen Sie Ihr Notfallset stets dabei haben. -

A Reinvestigation of Mayenite from the Type Locality, the Ettringer Bellerberg Volcano Near Mayen, Eifel District, Germany
Mineralogical Magazine, June 2012, Vol. 76(3), pp. 707–716 A reinvestigation of mayenite from the type locality, the Ettringer Bellerberg volcano near Mayen, Eifel district, Germany 5 E. V. GALUSKIN*, J. KUSZ,T.ARMBRUSTER,R.BAILAU,I.O.GALUSKINA,B.TERNES AND M. MURASHKO 1 Faculty of Earth Sciences, Department of Geochemistry, Mineralogy and Petrography, University of Silesia, Be˛dzin´ska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland 2 Institute of Physics, University of Silesia, Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, Poland 3 Mineralogical Crystallography, Institute of Geological Sciences, University of Bern, Freiestrasse 3, CH-3012 Bern, Switzerland 4 Dienstleistungszentrum la¨ndlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel-Aussenstelle Mayen, Bahnhofstrasse 45, 56727 Mayen, Germany 5 Systematic Mineralogy, 44, 11th line V.O, apt. 76, Saint Petersburg 199178, Russia [Received 28 February 2012; Accepted 19 April 2012; Associate Editor: Edward Grew] ABSTRACT New electron-microprobe analyses of mayenite from the Ettringer Bellerberg volcano near Mayen in the Eifel district, Germany have high Cl contents and Raman spectroscopy indicates the presence of OH groups. Neither of these components is included in the generally accepted chemical formula, Ca12Al14O33. A refinement of the crystal structure by single-crystal X-ray methods reveals a previously unrecognized partial substitution. The O2 site which forms one of the apices of an AlO4 tetrahedron (with 36O1 sites) is replaced by 36O2a sites, which change the coordination of the central Al atom from tetrahedral to octahedral. This substitution is related to partial hydration of Ca12Al14O32Cl2 according to the isomorphic scheme (O2À +ClÀ) $ 3(OH)À. The revised composition of Eifel mayenite is best described by the formula Ca12Al14O32ÀxCl2Àx(OH)3x (x ~0.75); the original formula, Ca12Al14O33, is inadequate. -
Die Erforschungsgeschichte Der Eifel-Geologie -200 Jahre Ein
Die Erforschungsgeschichte der Eifel-Geologie -200 Jahre ein klassisches Gebiet geologischer Forschung- Von der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.- Geol. Sabine Rath aus Aachen Berichter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Werner Kasig, Aachen Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Meyer, Bonn Univ.-Prof. Dr. phil. Gerd Flajs, Aachen Tag der mündlichen Prüfung: 18.12.2003 Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Hochschulbibliothek online verfügbar. Kurzzusammenfassung Kurzzusammenfassung Die vorliegende Arbeit soll dem Leser die über 200 jährige Erforschungsgeschichte der Eifelgeologie näher bringen, bei der auch die Zusammenhänge von der Entwicklung einer Natur- zu einer Kulturlandschaft verdeutlicht werden. Es wird ein Bogen zwischen der historischen und der wissenschaftlichen Erforschungsgeschichte der Geologie für einen regional begrenzten Raum, die Eifel, gespannt. Schwerpunktmäßig ist die Darstellung auf die Anfänge der Erforschung und die wichtigsten klassischen Fakten aus der Eifelregion begrenzt. Dem Leser wird die Vorgeschichte des heutigen Wissenstands und ein Einblick in die lange Erforschung dieser Landschaft vermittelt, die gebietsweise in Zusammenhang mit den bergbaulichen Tätigkeiten steht. Die Eifel spielt national und auch international eine wichtige Rolle in der Entwicklung der geologischen und der paläontologischen Wissenschaft, nicht -

Die Entwicklung Des Siedlungsgefüges Der Eisenzeit Zwischen Mayen Und Mendig Bernd Osterwind, Stefan Wenzel
Die Entwicklung des Siedlungsgefüges der Eisenzeit zwischen Mayen und Mendig Bernd Osterwind, Stefan Wenzel To cite this version: Bernd Osterwind, Stefan Wenzel. Die Entwicklung des Siedlungsgefüges der Eisenzeit zwischen Mayen und Mendig. Martin Schönfelder; Susanne Sievers. L’âge du Fer entre la Champagne et la vallée du Rhin. Actes du 34e colloque international de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer (Aschaffenburg, 13-16 mai 2010), 14, 2012, RGZM - Tagungen. hal-02182648 HAL Id: hal-02182648 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02182648 Submitted on 13 Jul 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Archäologie in Verbindung mit der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts und der Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer TIRÉ-À-PART / SONDERDRUCK Martin Schönfelder · Susanne Sievers (Hrsg.) L’ÂGE DU FER ENTRE LA CHAMPAGNE ET LA VALLÉE DU RHIN 34e colloque international de l’Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer du 13 au 16 mai 2010 à Aschaffenburg DIE EISENZEIT ZWISCHEN CHAMPAGNE UND RHEINTAL 34. -

Gehen Sie Auf Entdeckungstour Und Lüften Sie Die Geheimnisse Der Landschaft Von Maaren Und Vulkanen
Gehen Sie auf Entdeckungstour Entdecken Sie mehr als 500 spannende Orte in der Archäologischen Schatzkammer Rheinland-Pfalz EntdeckenSie mehr als 500 spannendeOrte in derArchäologischen Schatzkammer Rheinland-Pfalz Entdeckungstour Wir machen Geschichte lebendig. Mehr Infos unter www.vorzeiten-austellung.de www.gdke.rlp.de Gehen Sie auf vorZEITEN – Archäologische Schätze an Rhein und Mosel edeutende Funde und archäologische Denkmäler lassen 400 Millionen Jahre Natur- und 800.000 Jahre Kultur- Bgeschichte erlebbar werden und geben gleichzeitig Einblicke in die faszinierenden Aufgabengebiete der Landesarchäologie. Die Spuren, denen die Ausstellung dabei folgt, reichen von den ersten Lebensformen in den Urmeeren, dem Schädelfragment eines Neandertalers, den ersten Kunstwerken eiszeitlicher Jäger bis zum rätselhaften jungsteinzeitlichen Ritualort Herxheim. Kommen Sie mit uns zu den reichen Metallfunden der Bronzezeit und prachtvollen keltischen Prunkgräber, zu den ersten urbanen Zentren, den römischen Städten Mainz und Trier. Verfolgen Sie mit uns aber auch das Ende der Macht Roms am Rhein, den Aufstieg und Prunk der Franken und Alemannen, der sich noch bis ins Mittelalter hinein, auch durch die weitreichenden Handelsbeziehungen der Region, zeigt. Freuen Sie sich auf einen Streif- zug durch die Geschichte unseres SONDERAUSSTELLUNG Landes! Landesmuseum Koblenz Landesarchäologie RLP Festung Ehrenbreitstein www.vorzeiten-ausstellung.de 4 VERANSTALTUNGEN Entdecken Sie die Schätze des Landes ussten Sie, dass Sie in einer großen Schatzkammer leben, oder sie gerade besuchen? Kaum, dass Sie Weinen Fuß auf rheinland-pfälzischen Boden setzen, stehen Sie vor einem seltenen Fossil, einer rätselhaften Kult- stätte oder einem wehrhaften Limes-Turm. Wir sind stolz auf unsere vielen Originalschauplätze, archäologischen Ausgra- bungen und Museen und möchten Sie herzlich zu Ihrer ganz persönlichen archäologischen Entdeckungstour einladen. -

Het Maalsteenproduktiecentrum Bij Mayen in De Eifel
Grondboor pag. 110 Oldenzaal, 3/4 1983 9 fig. en Hamer - 120 juni/aug. 1983 Het maalsteenproduktiecentrum bij Mayen in de Eifel H. Kars* GEOLOGIE Algemeen In dit verhaal gaat de aandacht uit naar het gebied noordelijk van Mayen, in het Laacher See gebied, waar vanaf de nieuwe steentijd tot ver in de middeleeuwen grote hoeveelheden maalstenen zijn geproduceerd uit het plaatselijk voorkomende vulkani• sche gesteente. Het Laacher See gebied wordt ongeveer begrensd door de Rijn en de riviertjes de Brohl en de Nette. Bekende plaatsen zijn Koblenz, Andernach en Mayen (fig. 1). Het Laacher See gebied vormt samen met de verspreid liggende vulkanen van Fig. 2: Vereenvoudigde geologische kaart van het Laacher See gebied (naar AHRENS/SCHMIDT). Ma: Mayen gebied, zie fig. 3; Ni: Oberer Mendiger Strom; Wa: Wasemer Kopf/Hohe Buche; Ve: Veitskopf. * Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort. 110 Fig. 1: Ligging van vulkanen en vulkaangebieden in het Eifelgebergte. De rechthoek geeft het kader aan van fig. 2. Ill Fig. 3: Omtrek van de lavastromen afkomstig uit de Ettringer Bellerberg. De cijfers I, II, III en IV vertegenwoordigen de produktiegebieden in, respektievelijk, de prehistorie, de Romeinse tijd, de vroege middeleeuwen en de middeleeuwen (naar RODER, 1958). K-nummers zijn monsterpunten. 112 de Hohe Eifel en die van de Westeifel het vulkanisch deel van het Eifelgebergte (fig. Geologisch gezien is dit vulkanisme bijzonder jong, de oudste vulkanische activiteiten gaan terug tot in het Tertiair, een groot deel van de erupties vond echter plaats tot laat in het Pleistoceen. Op sommige plaatsen, zoals bij Bad Tönisstein in het dal van de Brohl, zijn nu nog sporen van actief vulkanisme merkbaar in de vorm van koolzuurhou• dende warmwaterbronnen. -

Sharyginite, Ca3tife2o8, a New Mineral from the Bellerberg Volcano, Germany
minerals Article Sharyginite, Ca3TiFe2O8, A New Mineral from the Bellerberg Volcano, Germany Rafał Juroszek 1,* ID , Hannes Krüger 2 ID , Irina Galuskina 1, Biljana Krüger 2 ID , Lidia Jezak˙ 3, Bernd Ternes 4, Justyna Wojdyla 5, Tomasz Krzykawski 1, Leonid Pautov 6 and Evgeny Galuskin 1 ID 1 Department of Geochemistry, Mineralogy and Petrography, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, B˛edzi´nska60, 41-200 Sosnowiec, Poland; [email protected] (I.G.); [email protected] (T.K.); [email protected] (E.G.) 2 Institute of Mineralogy and Petrography, University of Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck, Austria; [email protected] (H.K.); [email protected] (B.K.) 3 Institute of Geochemistry, Mineralogy and Petrology, University of Warsaw, Al. Zwirki˙ and Wigury 93, 02-089 Warszawa, Poland; [email protected] 4 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel-Aussenstelle Mayen, Bahnhofstrasse 45, DE-56727 Mayen, Germany; [email protected] 5 Swiss Light Source, Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Switzerland; [email protected] 6 Fersman Mineralogical Museum RAS, Leninskiy pr, 18/2, 115162 Moscow, Russia; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +48-516-491-438 Received: 27 June 2018; Accepted: 17 July 2018; Published: 21 July 2018 Abstract: The new mineral sharyginite, Ca3TiFe2O8 (P21ma, Z = 2, a = 5.423(2) Å, b = 11.150(8) Å, c = 5.528(2) Å, V = 334.3(3) Å3), a member of the anion deficient perovskite group, was discovered in metacarbonate xenoliths in alkali basalt from the Caspar quarry, Bellerberg volcano, Eifel, Germany. -

Jahresbericht 1999
JAHRESBERICHT 1999 BEIRAT UND VERWALTUNGSRAT Beirat An der Beiratssitzung im Römisch-Germanischen Zentralmuseum am 25. November 1999 nahmen teil: Prof. Dr. Schietzel als Vertreter des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Ltd. Ministerialrat Mentges als Vertreter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Fachwissenschaftler Prof. Dr. Bloemers und Prof. Dr. Lüning. Für das Institut waren anwe- send Generaldirektor Dr. Weidemann, Dir. Dr. Künzl, Dir. Dr. Schaaff, Prof. Dr. Bosinski, Frau Dr. Pfer- dehirt und Frau Dr. Clauß. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Vorbereitung der Jahressitzung des Verwaltungsrates. Verwaltungsrat Am 26. November 1999 fand die Jahressitzung des Verwaltungsrates statt. An der Sitzung nahmen teil: Prof. Dr. Schietzel (Stellvertreter des Vorsitzenden), Ministerialrat Conrad (Bundesinnenministerium), Abt.-Leiterin Schumacher M.A. und Ministerialdirigent Dr. Schacht (Kultusministerkonferenz), Mini- sterialdirigent a. D. Frölich und Ltd. Ministerialrat Mentges (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz), Ltd. Archivdirektor Schütz (Stadt Mainz), Prof. Dr. Kyrieleis (Präsi- dent des Deutschen Archäologischen Instituts), Prof. Dr. von Schnurbein (Erster Direktor der Rö- misch-Germanischen Kommission) sowie als Wissenschaftler der einschlägigen Fachgebiete Prof. Dr. Hellenkemper, Dr. Lüdtke, Prof. Dr. Lüning, Dr. Morel, Prof. Dr. Slotta und Dr. Trier. Außerdem nah- men das Direktorium des RGZM und die Leiter der Forschungsbereiche teil. Verhindert waren: Ministerpräsident a. D. Dr. Wagner (Vorsitzender), Ministerialdirigentin Kisseler (Kultusministerkonferenz), Beigeordneter Krawietz (Stadt Mainz), Direktor Küsgens (Gesellschaft der Freunde des RGZM) und die Fachwissenschaftler Prof. Dr. Bloemers, Prof. Dr. Conard, Prof. Dr. Himmelein und Prof. Mohen. In der Sitzung wurden die Empfehlungen des Wissenschaftsrates diskutiert, u.a. die Kooperation mit der Universität Mainz und die Struktur des Verwaltungsrates.