Diplomarbeit Wilhelm Thoma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Century Historiography of the Radical Reformation
Toward a Definition of Sixteenth - Century habaptism: Twentieth - Century Historiography of the Radical Reformation James R. Coggins Winnipeg "To define the essence is to shape it afresh." - Ernst Troeltsch Twentieth-century Anabaptist historiography has somewhat of the character of Hegelian philosophy, consisting of an already established Protestant-Marxist thesis, a Mennonite antithesis and a recent synthesis. The debate has centred on three major and related issues: geographic origin, intellectual sources, and essence. Complicating these issues has been confusion over the matter of categorization: Just who is to be included among the Anabaptists and who should be assigned to other groups? Indeed, what are the appropriate categories, or groups, in the sixteenth century? This paper will attempt to unravel some of the tangled debate that has gone on concerning these issues. The Protestant interpretation of Anabaptism has the longest aca- demic tradition, going back to the sixteenth century. Developed by such Protestant theologians and churchmen as Bullinger, Melanchthon, Men- ius, Rhegius and Luther who wrote works defining and attacking Ana- baptism, this interpretation arose out of the Protestant understanding of the church. Sixteenth-century Protestants believed in a single universal church corrupted by the Roman Catholic papacy but reformed by them- selves. Anyone claiming to be a Christian but not belonging to the church Joitnlal of Mennonite Stitdies Vol. 4,1986 184 Journal ofMennonite Studies (Catholic or Protestant) was classed as a heretic,' a member of the mis- cellaneous column of God's sixteenth-century army. For convenience all of these "others" were labelled "Anabaptists." Protestants saw the Anabaptists as originating in Saxony with Thomas Muntzer and the Zwickau prophets in 1521 and spreading in subsequent years to Switzerland and other parts of northern Europe. -

The Roots of Anabaptist Empathetic Solidarity, Nonviolent Advocacy, and Peacemaking
The Roots of Anabaptist Empathetic Solidarity, Nonviolent Advocacy, and Peacemaking John Derksen Introduction uch of Mennonite nonviolent advocacy and peacebuild- ing today finds its roots in sixteenth-century Anabaptism. But Msixteenth-century Anabaptists were diverse. In keeping with the polygenesis viewSAMPLE of Anabaptist origins, this paper assumes diversity in the geography, origins, cultures, shaping influences, spiritual orientations, attitudes to violence, and other expressions of Anabaptists.1 We define Anabaptists as those who accepted (re)baptism or believer’s baptism and the implications of that choice. Various Anabaptists had sectarian, ascetic, spiri- tualist, social revolutionary, apocalyptic, rationalistic, or other orientations, and the distinctions between them were often blurred. Geographically, they emerged in Switzerland in 1525, in South Germany-Austria in 1526, and in the Netherlands in 1530. Many agree that the Anabaptists displayed 1. Stayer, Packull, and Deppermann, “Monogenesis,” 83–121; Coggins, “Defini- tion”; Stayer, Sword. Surveys of Anabaptist history that incorporate the polygenesis perspective include Snyder, Anabaptist, and Weaver, Becoming Anabaptist. Works that explore Anabaptist unity beyond polygenesis include Weaver, Becoming Anabaptist, and Roth and Stayer, Companion. 13 © 2016 The Lutterworth Press 14 Historical Conditions of Anabaptist-Mennonite Peacebuilding Approaches both Protestant and Catholic characteristics in different configurations. “Negatively, there was anger against social, economic, and religious abuses . but responses to this discontent varied widely. Positively, the ‘Word of God’ served as a rallying point for all, but differences . emerged over how it was understood and used.”2 While Swiss Anabaptists tended to fa- vor sectarianism after the 1525 Peasants’ War, South German and Austrian Anabaptists tended more toward spiritualism, and early Dutch Anabaptists tended toward apocalyptic thinking. -

Ideological Continuity from the Protestant Reformation to the German Peasants’ War, 1517-1526
THE RADICAL GOSPEL: IDEOLOGICAL CONTINUITY FROM THE PROTESTANT REFORMATION TO THE GERMAN PEASANTS’ WAR, 1517-1526 Cassandra McMurry History 200: Doing History Professor Katherine Smith December 15 2014 1 The rhetoric of the Protestant Reformation, while advocating a new conception of piety and worship that flew in the face of traditional Catholic doctrine, also shaped a new conception of a social group often considered apolitical, simplistic, and passive: the peasantry. To help garner support for their cause, beginning in 1520 Reformation adherents (Reformers) began to represent the peasantry with a fictional peasant they named Karsthans, who frequently appeared in distributed woodcuts as part of Reformation propaganda. Karsthans is commonly depicted standing at the literal center of religious change—at the side of Martin Luther himself—as a powerful and devoted peasant soldier, wielding a flail to defend the word of God.1 Scholars such as R. W. Scriber have termed this new understanding of the peasants’ role in Reform the birth of the ‘Evangelical Peasant’ as a “presiding guardian” over the new religious rhetoric of the Protestant Reformation.2 The Reformers aimed to dismantle the power of the Catholic hierarchical system by advocating that the faithful make direct contact with God rather than going through a priest by means of confession, an egalitarian doctrine based on their new interpretation of the Bible. These theologians imagined that the political impetus of their challenge to hegemonic Catholic tradition would come from the lowest orders of society, the common man was thought to be “closer to God” and therefore distinctly qualified to lead a Protestant movement to defend Scripture.3 In late 1524 and early 1525 the peasants of the region which is now Germany, Austria, and Switzerland rose against their lords, demanding changes to social and political institutions such as the church and the lord-vassal relationship, as well as advocating community governance. -

Zwingliana Beiträge Zur Geschichte Zwinglis Der Reformation Und Des Protestantismus in Der Schweiz Herausgegeben Vom Zwingliverein
ZWINGLIANA BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE ZWINGLIS DER REFORMATION UND DES PROTESTANTISMUS IN DER SCHWEIZ HERAUSGEGEBEN VOM ZWINGLIVEREIN 1988/1 BAND XVII/HEFT 5 Brothers and Neighbors: The Language of Community in Zwingli's Preaching by LEE PALMER WANDEL In the early sixteenth Century, the central themes of the reform were spread not through the printed word alone, but through the personal presence of dozens of preachers throughout the Germanies and Switzerland - through the face-to- face contact of reformers with local communities.1 These preachers shared cer- tain key ideas - the exclusive authority of Scripture, the primacy of faith, the unconditionality of grace - but each also gave to the message of reform a more personal and distinctive stamp. Each preached that message in language which was accessible, immediate, and meaningful within local contexts. For these reformers, Scripture was the source not only for their theology, but also for a new program of Christianity lived, of Christian practice. In the text of Matthew 22 :39, "You should love your neighbor as yourself", many found the new law of Christ, which could serve as the basis for a renewed Christian Com munity. Throughout southwest Germany and Switzerland, Martin Bucer in Strasbourg, Eberlin von Gunzburg in Augsburg, Huldrych Zwingli in Zürich, and Oecolampad in Basel were preaching that love of neighbor, Christian broth- erly love, would make possible the reshaping of all forms of human association in accordance with divine law.2 1 On the impact of preaching, see for example, Robert Scribner, Practice and Principle in the German Towns: preachers and people, in: Reformation Principle and Practice: Es says in Honor of A.G. -

The Reformation and Peasant Unrest in the Swiss Confederation
The Reformation and Peasant Unrest in the Swiss Confederation LAWRENCE P. STRYKER* In the late Middle Ages the subjects of the Holy Roman Empire considered the German cantons of the alpine Confederation unique. Through successful rebellions in the fourteenth and fifteenth centuries these cantons had freed themselves from Habsburg rule, and maintained· independence from foreign princes. For this reason, among others, the Confederation became a symbol for peasant independence and revolt against feudal authority. Popular songs even circulated in the empire that commented on the lack of feudal authorities among the cantons: Nun sind etlich die wend kein Herren han weder dem Bahrt noch keiser sin undertan. and Tuon uns die Swizer jetzt ein widerstand so werden sie zwingen alle land dem adel gar vertringen. 1 The German lords considered the lordless peasants of the Confederation a definite threat to traditional authority, for their successful struggle with the Habsburgs was an example to restless peasants throughout Europe. "We want to become Swiss" was the German phrase used by peasants seeking relief from the burdens of serfdom and seigneurialism. 2 Modern historians have also emphasized the Confederation's unique social and political institutions. In an essay discussing mercenary soldiers in sixteenth century Europe, V.C. Kiernan speaks of the Confederation peasantry as "the mountaineers who had most resolutely defied feudalism ... , and whose revolutionary example had not gone unnoticed in Central Europe." 3 The Swiss historian, Wilhelm Oeschli, remarked that the "democratic and repub- *Mr. Stryler holds an A.B. from Lafayette College and a M.A. from the University of Virginia. -

An Anthropology of Marxism
An Anthropology of Marxism CEDRIC J. ROBINSON University of California at Santa Barbara, USA Ash gate Aldershot • Burlington USA • Singapore • Sydney qzgr;; tr!'W"Ulr:!!PW Wf' I • rtft"lrt ri!W:t!ri:!tlu • nw i!HI*oo · " • , ., © Cedric J. Robinson 2001 Contents All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or othetwise without the prior permission of the publisher. Preface Published by Coming to Terms with Marxian Taxonomy Ashgate Publishing Limited 23 Gower House 2 The Social Origins ofMaterialism and Socialism Croft Road 75 Aldershot 3 German Critical Philosophy and Marx Hampshire GUll 3HR llJ England 4 The Discourse on Economics !51 Ash gate Publishing Company 5 Reality and its Representation 13 I Main Street 161 Burlington, VT 05401-5600 USA Index IAshgate website: http://www.ashgate.com j British Library Cataloguing in Publication Data Robinson, Cedric J. An anthropology of Marxism.- (Race and representation) !.Communism 2.Socialism I. Title 335.4 Library of Congress Control Number: 00-111546 ISBN 1 84014 700 8 Printed and bound in Great Brit~in by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall v qzgr;; tr!'W"Ulr:!!PW Wf' I • rtft"lrt ri!W:t!ri:!tlu • nw i!HI*oo · " • , ., © Cedric J. Robinson 2001 Contents All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or othetwise without the prior permission of the publisher. -

Social Mobility and Noble Rebellion in Early Modern Habsburg Austria1
KARIN J. MACHARDY Social Mobility and Noble Rebellion in Early Modern 1 Habsburg Austria ABSTRACT This paper analyzes changes in the social structure of the Lower Austrian nobility in the decades before the uprising of 1618-20. The author argues that the Habsburg rulers ex.enedconsiderable injluenceon social change but were limited by structu ral forces, notably demographic and economic change. Nevertheless, they managed to turn events to their advantage and manipulate the transformation of the nobility 's internal structure in the hope of creating a pliable instrument of royal absolutism. The Habsburgs were less interested in creating a new nobility than in reestablishing confessional conformity, which they considered essential to strengthen their autho rity. However, they implemented their strategy of promoting the rise of a new Catholic upper nobility at a speed that minimized the possibility of appropriate cultural adjustmentfor Protestant nobles. Their exclusion from the benefitsof status mobility after 1609 represented an attack not only on the religion, culture, and social predominance of the Protestant nobility, but on its continued existence as an elite. This explains, the author concludes, why redefiningthe rules and channels of elite recruitment in favour of a new Catholic nobility became the focal point in the conjlict between Habsburgs and Protestant nobles. The author further suggests that the revolt of the nobility in the Austrian territories provides an excellent case study to show the complexities of social change affecting the early modern European nobility, and to reconsider the long-term social origins of early modern state breakdown. Since World War II the historiography of early modern elite opposition to central govem ments has been dominated by what scholars now classify as the traditional social interpre tation. -

Canadian Contributions to Anabaptist Studies Since the 1960S
Canadian Contributions to Anabaptist Studies since the 1960s jonathan r. seiling1 University of Hamburg Anabaptist studies in Canada have been marked by an exceptional degree of productive, inter- confessional (or non-confessional) engagement, most notably between Mennonites, Baptists, and Lutherans. The institutions making the greatest contributions have been at the University of Waterloo (including, but not exclusively, Conrad Grebel University College), Queen’s University, and Acadia Divinity College. The geographic expansion of Anabaptist studies beyond the traditional Germanic centres into eastern Europe and Italy, and the re-orientation of analysis away from primarily theo- logical or intellectual history toward a greater focus on socio-political factors and networking, have been particular areas in which Canadian scholars have impacted Anabaptist studies. The relation- ship of Spiritualism (and later Pietism) to Anabaptist traditions and the nature of Biblicism within Anabaptism, including the greater attention to biblical hermeneutics with the “Marpeck renaissance,” have also been studied extensively by Canadians. International debates concerning “normative” Anabaptism and its genetic origins have also been driven by the past generations of Canadian schol- ars (monogenesis, polygenesis, post-polygenesis). Les études anabaptistes ont été marquées au Canada par un degré exceptionnel de collaboration productive, interconfessionnelle et non-confessionnelle, en particulier entre les mennonites, les baptistes, et les luthériens. Les institutions qui ont le plus contribué à cette collaboration sont les établissements de Waterloo (y compris, entre autres, le Conrad Grebel University College), la Queen’s University et l’Acadia Divinity College. Les études anabaptistes ont déployé leurs intérêts au-delà des centres germaniques traditionnels vers l’Europe de l’Est et l’Italie. -
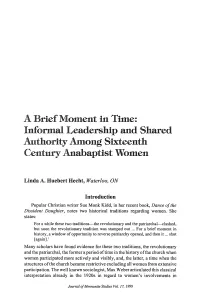
A Bdef Moment In
A Bdef Moment in Lincila A. Huebert Hecht, Waterloo, ON Introduction Popular Christian writer Sue Monk Kidd, in her recent book, Dance of the Dissident Daughter, notes two historical traditions regarding women. She states: For a while these two traditions-the revolutionary and the patriarchal-clashed, but soon the revolutionary tradition was stamped out ... For a brief moment in history, a window of opportunity to reverse patriarchy opened, and then it ... shut [again]. Many scholars have found evidence for these two traditions, the revolutionary and the patriarchal, the former aperiod of time in the history of the church when women participated more actively and visibly, and, the latter, a time when the structures of the church became restrictive excluding all women from extensive participation. The well known sociologist, Max Weber articulated this classical interpretation already in the 1920s in regard to women's involvements in Jot~rnalofMennonite Studies Vol. 17, 1999 A Brief Moment in Time: Informal Leadership and Shared Authority 53 religious movements in general and the AnabaptistIMennonite historian Harold S. Bender expressed it in 1959 in The Mennonite Encyclopedia in the following way: In the early Anabaptist movement women played an important role .... Later, after the creative period of Anabaptism was past, the settled communities and congrega- tions reverted more to the typical patriarchal attitude of European culture.' This cycle of participation evident for women in each of the regions of continental Europe where Anabaptism -

Radicalreformationlookinside.Pdf
Habent sua fata libelli Volume XV of Sixteenth Century Essays & Studies Charles G. Nauert, Jr., General Editor Composed by Paula Presley, NMSU, Kirksville, Missouri Cover Design by Teresa Wheeler, NMSU Designer Printed by Edwards Brothers, Ann Arbor, Michigan Text is set in Bembo II 10/12 Volume XV Sixteenth Century Essays & Studies Copyright© 1992 by Truman State University Press (previously Sixteenth Century Journal Publishers, Inc.), Kirksville, Missouri USA. All rights reserved. This book has been brought to publication with the generous support of Truman State University (previously Northeast Missouri State University). First edition ©1962, Westminster Press, Philadelphia. Second edition, titled La Reforma Radical, ©1983, Fondo de Cultura Económica, Mexico. Permission is gratefully acknowledged by Westminster Press to reprint the Introduction to the first edition and to Fondo de Cultura Económica to reprint the Introducción to the Spanish edition. Cover image: Permission for use of the Siege of Münster by Erhard Schoen granted by Abaris Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Williams, George Huntston, 1914–2000 The radical Reformation / by George Huntston Williams. – 3rd ed., rev. and expanded. p. cm. – (Sixteenth century essays & studies ; v. 15). Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-94354-983-5 (alk. paper; Pbk) — ISBN 978-1-61248-041-1 (ebook) 1. Reformation. 2. Anabaptists. 1. Title. II Series. BR307 W5 270.6-dc20 92-6071 CIP No part of this work may be reproduced or transmitted in any format by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. -

4. Adel, Region, Integration 350 M
349 4. ADEL, REGION, INTEGRATION 350 M. A. Chisholm A QUESTION OF POWER: COUNT, ARISTOCRACY AND BISHOP OF TRENT THE PROGRESS OF ARCHDUKE FERDINAND II INTO THE TYROL IN 15671 Following the death of Emperor Ferdinand I on 25 July, 1564, his son, Archduke Ferdinand II, succeeded him as Count of the Tyrol. The new prince wrote the Upper Austrian Privy Council (Regierung) in Innsbruck three days later from Prague, where he was still Gov- ernor of Bohemia.2 He noted that his arrival would be delayed and or- 1 I would like to take this opportunity to thank Dr. Manfred Rupert of the Ti- roler Landesarchiv (TLA) for the many hours he has helped me to read and deci- pher Old German. 2 The Privy Council was the head of the Upper Austrian government. Its au- thority extended over the territorial complex of the Tyrol and Further Austria. The Privy Council was centred in the Tyrolean capital, Innsbruck; the Further Austrian government, centred in the Alsatian town, Ensisheim, was administra- tively subordinate to the Privy Council. Hence, the archduke, as his father, cor- responded with the Privy Council in regard to both Tyrolean and Further Austri- an affairs. However, contemporaries also referred to the Council loosely as the “Tyrolean Privy Council”, as for example, when the archduke addressed a letter to unsern Tyrolischen Regierung; TLA, Ferdinandea, Position 23, Carton 28, 19 November, 1566. The association of the Privy Council with the Tyrol was no doubt a habit of mind, as it was centred in the Tyrol, dominated by Tyroleans and almost two-thirds of its business was taken up by the Tyrol: TLA, An die Fürstli- che Durchlaucht (AFD), 19 October, 1565, fol. -
I University Microfilms, a XEROX Company, Ann Arbor, Michigan S I
71 - 27,439 BUCK, Lawrence Paul, 1944- THE CONTAINMENT OF CIVIL INSURRECTION: NURNBERG AND THE PEASANTS' REVOLT, 1524-1525. The Ohio State University, Ph.D., 1971 History, medieval i University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan s i :. Q Copyright by Lawrence Paul Buck 1971 THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED THE CONTAINMENT OF CIVIL INSURRECTION: NURNBERG AND THE PEASANTS* REVOLT, 1524-1525 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Lawrence Paul Buck, B.A., M.A, jjg jjg 5*5 The Ohio State University 1971 Approved by Department of History PLEASE NOTE: Some pages have indistinct print. Filmed as received. UNIVERSITY MICROFILMS. ACKNOWLEDGMENTS The research for this dissertation was completed - while I was a Fulbright Graduate Fellow in Germany. I would like to acknowledge my appreciation to Dr. Gerhard Hirschmann, Director of the Nttrnberg City Archive, and to Dr. Otto Puchner, Director of the Bavarian State Archive, Nttrnberg. Both men were very generous in opening to me the vast sources in their care. I also wish to thank my family and my friends for their continual encouragement. I am deeply indebted to my adviser, Professor Harold J. Grimm, who has assisted me in every aspect of this work, and whose example as a scholar and teacher has stood as a constant source of inspiration for me. ii VITA October 6, 1944 Born - Pittsburg, Kansas 1966*......... B.A., Wichita State University, Wichita, Kansas 1966-196 7..... Woodrow Wilson Fellow, Department of History, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1967*..•••••••• M.A., The Ohio State University Columbus, Ohio 1967-1969*••••• NDEA Fellow, Department of History, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1969-1970 ,...