VII. Christandl-Peskoller, H. & Janetschek
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tutela ZBORNÍK SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY a JASKY N I a RST VA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 11
tutela ZBORNÍK SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKY N I A RST VA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 11 NATURAE 2007 1 O B S A H V E D E C K É Š T Ú D I E Jozef Šteffek – Patrícia Danková: Ekologické a ekosozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Spišskej Magury ..................................................................... 5 Oto Majzlan: Chrobáky (Coleoptera) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci .......... 27 Oto Majzlan: Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera: Curculionidae) v NPR Bábsky Predseda redakčnej rady: les pri Nitre .................................................................................................................................... 43 doc. RNDr. Dana Šubová, CSc. Vladimír Straka – Oto Majzlan: Dvojkrídlovce (Diptera) troch lokalít v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy .............................................................................................. 47 Michal Wiezik: Mravce (Hymenoptera: Formicidae) horských a vysokohorských biotopov južnej časti Kráľovohoľských Tatier ............................................................................................ 85 Redakčná rada: Jozef Školek: Sutinové spoločenstvá v NPR Mních ................................................................. 91 prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., RNDr. Miroslav Fulín, CSc., RNDr. Ľudovít Gaál, Stanislav Korenko: Pavúky (Arachnida, Araneae) východnej časti Kozích chrbtov .......... 103 prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., RNDr. Jozef Monika Hatinová – Kristina -

Biodiversität Von Schmetterlingen (Lepidoptera) Im Gebiet Des Naturparks Schlern
Gredleriana Vol. 7 / 2007 pp. 233 - 306 Biodiversität von Schmetterlingen (Lepidoptera) im Gebiet des Naturparks Schlern Peter Huemer Abstract Biodiversity of butterflies and moths (Lepidoptera) of the Schlern nature park (South Tyrol, Italy) The species diversity of Lepidoptera within the Schlern nature park has been explored during the vegetation periods 2006 and 2007. Altogether 1030 species have been observed in 16 sites, covering about one third of the entire fauna from the province of South Tyrol. Fifteen additional species have been collected during the diversity day 2006 whereas further 113 species date back to historical explorations. The species inventory includes 20 new records for South Tyrol which are briefly reviewed. Among these speciesMicropterix osthelderi, Rhigognostis incarnatella and Cydia cognatana are the first proved records from Italy. Further two species from the surroundings of the Park include the first published records ofPhyllonorycter issikii and Gelechia sestertiella for Italy. Site specific characteristics of Lepidoptera coenosis are discussed in some detail. Historical aspects of lepidopterological exploration of the Schlern are briefly introduced. Keywords: Lepidoptera, faunistics, biodiversity, Schlern, South Tyrol, Italy 1. Einleitung Der Schlern übt als einer der klassischen Dolomitengipfel schon weit über 100 Jahre eine geradezu magische Anziehungskraft auf Naturwissenschaftler unterschiedlichster Coleurs aus (Abb. 1). Seine Nähe zum Siedlungsraum und vor allem die damit verbundene relativ leichte Erreichbarkeit haben wohl zur Motivation mehrerer Forschergenerationen beigetragen, das Gebiet näher zu untersuchen. Zusätzlich war wohl die Arbeit von GREDLER (1863) über Bad Ratzes für manchen Entomologen ein Anlass die Fauna des Schlerns näher unter die Lupe zu nehmen. Dies gilt auch für Schmetterlinge, wo erste Aufsammlungen bereits in die Mitte des 19. -

Tag Der Artenvielfalt 2018 in Weißbrunn, Ulten (Gemeinde Ulten, Südtirol, Italien)
Thomas Wilhalm Tag der Artenvielfalt 2018 in Weißbrunn, Ulten (Gemeinde Ulten, Südtirol, Italien) Keywords: species diversity, Abstract new records, Ulten, Val d’Ultimo, South Tyrol, Italy Biodiversity Day 2018 in Weißbrunn, Ulten Valley (municipality of Ultimo, South Tyrol, Italy) The 19 th Biodiversity Day in South Tyrol was held in the municipality of Ulten/Ultimo. A total of 886 taxa were found. Einleitung Der 19. Südtiroler Tag der Artenvielfalt wurde am 30. Juni 2018 im Talschluss von Ulten abgehalten. Wie in den Jahren zuvor oblag dem Naturmuseum Südtirol sowohl die Organisation im Vorfeld als auch die Koordination vor Ort. Begleitend zu den Felderhebungen der zahlreichen Fachleute (siehe einzelne Beiträge) war ein didakti- sches Rahmenprogramm vorgesehen, das eine vogelkundliche und eine naturkundliche Wanderung im Untersuchungsgebiet (Organisation: Nationalpark Stilfserjoch unter der Koordination von Ronald Oberhofer) sowie ein Kinder- und Familienprogramm im Nationalparkhaus Lahnersäge in St. Gertraud umfasste (Organisation und Durchführung durch die Mitarbeiterinnen des Naturmuseums Südtirol Johanna Platzgummer, Elisabeth Waldner und Verena Preyer). Für allgemeine Informationen (Konzept und Organisation) zum Tag der Artenvielfalt und insbesondere zur Südtiroler Ausgabe siehe HILPOLD & KRANEBITTER (2005) und SCHATZ (2016). Adresse der Autors: Thomas Wilhalm Naturmuseum Südtirol Bindergasse 1 I-39100 Bozen thomas.wilhalm@ naturmuseum.it DOI: 10.5281/ zenodo.3565390 Gredleriana | vol. 19/2019 247 | Untersuchungsgebiet Das Untersuchungsgebiet umfasste in seinem Kern die Flur „Weißbrunn“ im Talschluss von Ulten westlich der Ortschaft St. Gertraud, d.h. den Bereich zwischen dem Weißbrunnsee (Stausee) und der Mittleren Weißbrunnalm. Im Süden war das Gebiet begrenzt durch die Linie Fischersee-Fiechtalm-Lovesboden, im Nordwesten durch den Steig Nr. 12 östlich bis zur Hinteren Pilsbergalm. -

Pinus Mugo) Na Biotopovou a Druhovou Diverzitu Arkto-Alpinské Tundry Ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník)
VaV SM/6/70/05 Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů Zpráva o řešení projektu za rok 2006 Řešitel: RNDr. Jan Hošek, Hořovice Spolupracovníci: Marek Banaš Karolína Černá Radim Hédl Jakub Houška Josef Kašák Martin Kočí Marek Křížek Tomáš Kuras Tomáš Kyncl Zdeněk Majkus Martina Lešková Jan Novák Libor Petr Martin Růžička Jiří Souček Jiří Stanovský Václav Treml Ivan H. Tuf Jan Wild Miroslav Zeidler Obsah 1. Úvod .......................................................................................................................6 2. Paleoekologická analýza profilů Mezikotlí a Keprník (L. Petr, V. Treml) ............8 2.1. Úvod............................................................................................................ 8 2.2. Metody ........................................................................................................ 9 Pylová analýza ..................................................................................................... 9 Interpretace vývoje polohy alpinské hranice lesa .............................................. 10 2.3. Výsledky ................................................................................................... 10 Mezikotlí............................................................................................................ 10 Keprník ............................................................................................................. -

Travaux Scientifiques Du Parc National De La Vanoise : BUVAT (R.), 1972
ISSN 0180-961 X a Vanoise .'.Parc National du de la Recueillis et publiés sous la direction de Emmanuel de GUILLEBON Directeur du Parc national et Ch. DEGRANGE Professeur honoraire à l'Université Joseph Fourier, Grenoble Ministère de l'Environnement Direction de la Nature et des Paysages Cahiers du Parc National de la Vanoise 135 rue du Docteur Julliand Boîte Postale 706 F-73007 Chambéry cedex ISSN 0180-961 X © Parc national de la Vanoise, Chambéry, France, 1995 SOMMAIRE COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ........................................................................................................ 5 LECTURE CRITIQUE DES ARTICLES .......................................................................................................................... 6 LISTE DES COLLABORATEURS DU VOLUME ..................................................................................................... 6 EN HOMMAGE : ]V[arius HUDRY (1915-1994) ........................................................................................... 7 CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES M. HUDRY (+). - Vanoise : son étymologie .................................................................................. 8 J. DEBELMAS et J.-P. EAMPNOUX. - Notice explicative de la carte géolo- gique simplifiée du Parc national de la Vanoise et de sa zone périphé- rique (Savoie) ......................................................................................................,.........................................^^ 16 G. NlCOUD, S. FUDRAL, L. JUIF et J.-P. RAMPNOUX. - Hydrogéologie -

Ergebnisse Bei Schmetterlingen (Lepidoptera) Anlässlich Des 33
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Joannea Zoologie Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 14 Autor(en)/Author(s): Habeler Heinz Artikel/Article: Ergebnisse bei Schmetterlingen (Lepidoptera) anlässlich des 33. "Freundschaftlichen Treffens der Entomologen des Alpen-Adria-Raumes" auf der Dachstein-Südseite in der Steiermark 117-137 Joannea Zoologie 14: 117–137 (2015) Ergebnisse bei Schmetterlingen (Lepidoptera) anlässlich des 33. „Freundschaftlichen Treffens der Entomologen des Alpen-Adria- Raumes“ auf der Dachstein-Südseite in der Steiermark Heinz HABELER Zusammenfassung. Es wird über die Ergebnisse des Treffens berichtet, in dessen Ver- lauf 290 Arten mit 781 Funddaten ermittelt werden konnten. Für die Liste des Gebietes kamen 68 Arten als neu hinzu. Insgesamt wurden rund 4.100 Individuen beobachtet und bestimmt. Abstract. The results of the meeting are reported. 290 species of moths and butterflies with 781 sampling data could be found. For the list of the area 68 species would be new. In total around 4.100 specimen have been observed and determined. Key words. Meeting of Entomologists 2013, Styria, Dachstein-Südseite, butterflies, moths. 1. Einleitung Vom 10. bis 14. Juli 2013 hatten 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Berghotel Wal- cher in Schildlehen ober der Ramsau einen wunderschönen Aufenthalt, bestens betreut von der Bergsteiger- und Kletterlegende Hans Walcher und seinem Team. Als Veranstal- ter wollten wir wieder zur ursprünglichen Idee zurückgehen und nur einen überschau- baren Teilnehmerkreis einladen. Dieses Konzept hat sich bewährt, man konnte mit allen Gespräche führen, und von jedem Schmetterlingssammler wurde eine Liste mit Fund- daten zur Verfügung gestellt. In diesem Sinn sei ganz herzlich gedankt Ernst und Grete Arenberger, Dr. -

Kalser Dorfertal, Osttirol)
Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2007 (Kalser Dorfertal, Osttirol) Patrick Gros Wolfgang Dämon Christine Medicus © Patrick Gros - Juli 2007 2007 2 3 Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2007 (Kalser Dorfertal, Osttirol) Endbericht über die Ergebnisse und Diskussion der erhobenen Daten auf der Basis der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern Patrick Gros Wolfgang Dämon Christine Medicus unter Mitarbeit von Heribert Köckinger, Andreas Maletzky, Christian Schröck, Oliver Stöhr, Claudia Taurer-Zeiner, Roman Türk 2007 Gefördert aus Nationalparkmitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie der Länder Salzburg, Kärnten und Tirol. Herausgeber: Haus der Natur Museum für darstellende und angewandte Naturkunde Museumsplatz 5 A-5020 Salzburg, Österreich Auftraggeber: Verein Sekretariat Nationalparkrat Hohe Tauern Kirchplatz 2 A-9971 Matrei in Osttirol, Österreich Zitiervorschlag: GROS, P., DÄMON, W. und MEDICUS C. (2007): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2007 (Kalser Dorfertal, Osttirol). Unveröffentlichter Endbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 66 Seiten. 4 Inhalt Zusammenfassung ....................................................................................... 5 Einleitung ...................................................................................................... 6 Untersuchungsgebiet .................................................................................... 8 Ergebnis – Übersicht -
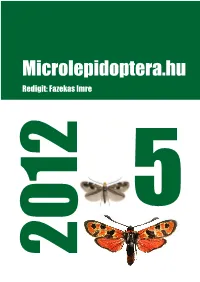
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Beiträge Zur Bayerischen Entomofaunistik 1: 199–265
Dieses PDF wird von der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Entomologen e.V.für den privaten bzw. wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung oder die Bereitstellung in einer öffentlichen Bibliothek oder auf einer website ist nicht gestattet. Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1:199– 265, Bamberg (1995), ISSN 1430-015X Insektenfauna der Gebirge Bayerns: aktueller Kenntnisstand und bemerkenswerte Funde aus den ostbayerischen Grenzgebirgen und den bayerischen Alpen. Ergebnisse der Kartierung der Naturwaldreservate Bayerns (Lepidoptera, Trichoptera, Neuropteroidea, Ephemeroptera, Odonata) von Hermann Hacker Zusammenfassung: Die Hochlagen der bayerischen Mittelgebirge weisen eine montan geprägte Insektenfauna mit zahl- reichen arkto-alpin verbreiteten Arten aus. Da über die Insektenfauna der ostbayerischen Grenzgebirge Oberpfälzer Wald und Bayerischer Wald bisher nur wenig publiziert wurde und aus der montanen bis alpinen Höhenstufe der bayerischen Alpengebieten nur wenige neuere Veröffentlichungen vorliegen, werden bemerkenswerte Funde der Lepidoptera, Tricho- ptera, Neuropteroidea, Ephemeroptera und Odonata, die im Rahmen der Kartierung der bayerischen Naturwaldreservate erfaßt wurden, erstmals publiziert. Die Nachweise, die eine große Zahl von Erstnachweisen und Wiederfunden enthalten, werden, soweit dies im Hinblick auf weiterführende Veröffentlichungen sinnvoll erscheint, kommentiert. Abstract: The higher altitudes of the Bavarian highlands host a montaneous determined insect fauna with numerous species of arcto-alpine distribution. Little data have been published so far from the East Bavarian mountain ranges “Ober- pfälzer Wald” and “Bayerischer Wald”, and only a few publications of recent date exist concerning the insect fauna of the montane and alpine altitudes of the Bavarian Alps. Therefore in this paper remarkable records—comprising a lot of first and again findings—of Lepidoptera, Trichoptera, Neuropteroidea, Ephemeroptera, and Odonata are published. -

Nota Lepidopterologica
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Nota lepidopterologica Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 28 Autor(en)/Author(s): Budashkin Yuri I., Gaedike Reinhard Artikel/Article: Faunistics of the Epermeniidae from the former USSR (Epermeniidae) 123-138 ©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Notalepid. 28 (2): 123-138 123 Faunistics of the Epermeniidae from the former USSR (Epermeniidae) ^ YURIJ 1. BUDASHKIN ^ & REINHARD GaEDIKE ' Kurortnoje Biostantzija 98 / 99, Feodosija, Ukraine; e-mail: [email protected] ^ Florusstraße 5, D-53225 Bonn, Germany; e-mail: [email protected] Abstract. 26 species of Epermeniidae are recorded from the territory of the former USSR. Two of them (Epermenia wockeella und E. vartianae) are recorded for the first time. New distributional data for 1 1 species and new life history data for 5 species are given. The genitalia of the male of E. wockeella and female of E. vartianae are described and illustrated for the first time. Zusammenfassung. Es werden 26 Epermeniidae-Arten für das Gebiet der ehemaligen UdSSR nach- gewiesen, zwei von ihnen {Epermenia wockeella und E. vartianae) sind Erstnachweise. Für 11 Arten werden Neufunde und für 5 Arten neue Angaben zur Lebensweise gemacht. Die Genitalien der Männchen von E. wockeella und der Weibchen von E. vartianae werden erstmals beschrieben und abgebildet. Key words. Lepidoptera, Epermeniidae, former USSR, Epermenia wockeella, E. vartianae. Introduction The family Epermeniidae is the only representative of the superfamily Epermenioidea (sensu Kristensen 1999). The phylogenetic relationships with the other superfamilies of the Apoditrysia are still unknown. -

Endemics and Relicts in the High-Mountain Fauna of Bulgaria
Historia naturalis bulgarica, 23: 109-118, 2016 Endemics and relicts in the high-mountain fauna of Bulgaria Petar Beron Abstract: The orophyte zone in Bulgarian mountains is about 1.37% of Bulgarian territory in eight mountains higher than 2000 m). Rila and Pirin are the only mountains higher than 2400 m and most of the relicts and endemics are centered in these mountains. Key words: Endemics, relicts, high-mountain fauna, Bulgaria The orophyte zone in the Bulgarian mountains uted greatly to the knowledge of these animals (several starts usually at 1900 – 2200 m a.s.l. This is the up- groups). Most animals living on the top of Bulgarian per limit of the closed high forest (the mountain fur (and other) mountains could be considered as neoen- excluded). This high mountain (orophytic) zone demics. of Bulgaria consists of 1.37% of Bulgarian territo- ry (above 2000 m are 1.05% of the total surface of Development of the high mountain environment Bulgaria, the land above 2500 m – 0.18%.) in eight in Bulgaria mountains (Rila – 2925 m a.s.l., Pirin – 2914 m, Stara The development of the fauna is closely related planina – 2386 m, Vitosha – 2290 m, Ossogovska with the development of the plant communities and planina – 2261 m, Slavyanka – 2212 m, Rhodopes – is indeed determined by it. It is justified to consider 2191 m, Belassitsa – 2029 m). Particularly important here only the changes of the vegetation in the last are the mountains exceeding 2400 m a.s.l. (Rila and 15 000 years (the Glacial and Postglacial time, or Pirin). -

The Beetle (Coleoptera) and True Bug (Heteroptera) Species Pool of the Alpine “Pian Di Gembro” Wetland (Villa Di Tirano, Italy) and Its Conservation
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano J. Ent. Acar. Res. 30 April 2011 Ser. II, 43 (1): 7-22 M. MontAGnA, G.c. LoZZIA, c. AnDreIS, A. GIorGI & J. BAuMGÄRTNER The Beetle (Coleoptera) and True bug (Heteroptera) species pool of the alpine “Pian di Gembro” wetland (Villa di Tirano, Italy) and its conservation Abstract - The Coleoptera and Heteroptera species pool was investigated in the “Pian di Gembro” wetland (Villa di Tirano, Sondrio, Italy). The wetland consists of a bog and its surroundings, referred to as wetland components, that are both subjected to a diversified intermediate management regime (DIMr). the application of the DIMr for plant species conservation resulted in the establishment of 11 wetland zones with a characteristic vegetation. In a three year sampling program, 997 Coleoptera and Heteroptera representing 141 species from 14 families were collected. Among these species, 64 species share both wetland components, 11 are restricted to the bog and 63 were found in the surroundings only. Among the species pool there were 23 tyrphophile taxa and only one tyrphobiont. With the exception of one zone, all zones are inhabited by zone-specific species. By taking into account both the general species pool and the pool of species of particular interest to conservationists, only one zone can be considered as redundant since it is inhabited by species that occur also in other zones. Hence, all the zones, with one exception, are effective for species pool conservation. the existing DIMr implemented for plant species conservation is also effective for conserving the species pool of coleoptera and Heteroptera.