Culterra 2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate
Freistaat Sachsen State Chancellery Message and Greeting ................................................................................................................................................. 2 State and People Delightful Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate ......................................................................................... 5 The Saxons – A people unto themselves: Spatial distribution/Population structure/Religion .......................... 7 The Sorbs – Much more than folklore ............................................................................................................ 11 Then and Now Saxony makes history: From early days to the modern era ..................................................................................... 13 Tabular Overview ........................................................................................................................................................ 17 Constitution and Legislature Saxony in fine constitutional shape: Saxony as Free State/Constitution/Coat of arms/Flag/Anthem ....................... 21 Saxony’s strong forces: State assembly/Political parties/Associations/Civic commitment ..................................... 23 Administrations and Politics Saxony’s lean administration: Prime minister, ministries/State administration/ State budget/Local government/E-government/Simplification of the law ............................................................................... 29 Saxony in Europe and in the world: Federalism/Europe/International -

District Heating in Lusatia
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg District Heating in Lusatia Status Quo and Prospects for Climate Neutrality Fernwärme in der Lausitz Status quo und Perspektiven für Klimaneutralität Thesis for the degree of Master of Science in Environmental and Resource Management submitted by Jan Christian Bahnsen 1st Examiner: Prof. Dr. Bernd Hirschl 2nd Examiner: Katharina Heinbach Submitted: 29th May 2020 Statement of Authentication I hereby declare that I am the sole author of this master thesis and that I have not used any other sources other than those listed in the bibliography and identified as references. I further declare that I have not submitted this thesis at any other institution in order to obtain a degree. The content, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. ________________________________ _____________________________________ (Place, Date) (Signature) Abstract The master thesis at hand examines the potential of district heating in Lusatia. The thesis follows the approach of first identifying technical and economic potentials in general and then transferring them to the study region. For the quantitative determination of district heating potential in Lusatia, the status quo is determined and a GIS-based analysis is carried out with regard to minimum heat demand densities. The extent to which district heating is suitable for climate-neutral heat supply will be investigated using the potential of renewable and waste heat energy sources. Furthermore, the regional economic effects of developing these potentials are examined. The results show that despite an overall decline in heat demand, there is potential to increase the relative share of district heating in Lusatia. -

Grenzen Und Naturräume
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 15 Autor(en)/Author(s): Bastian Olaf Artikel/Article: Die Westlausitz: Grenzen und Naturräume 9-18 © Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V. http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de ISSN 0941-0627 B E R I C H TE D E R NA T UR F O R S C H E ND E N G E S ELL S C H A F T D E R O BE R L AU S I TZ Band 15 Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 15: 9–18 (2007) ISSN 0941-0627 Manuskriptannahme am 25. 11. 2006 Erschienen am 24. 7. 2007 Vortrag zur 16. Jahrestagung der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz am 11. März 2006 in Kamenz Die Westlausitz: Grenzen und Naturräume Von OLAF B A S T I AN Mit 1 Karte Zusammenfassung „Westlausitz“ ist ein häufig verwendeter, jedoch nicht eindeutig definierter oder gar unumstrit- tener geographischer Begriff. Um Grenzen der Westlausitz zu ermitteln, müssen bereits vorhan- dene (historische und aktuelle) administrative Grenzen sowie Naturraumgrenzen berücksichtigt werden. Zum Kerngebiet der Westlausitz zählt zweifelsohne der innerhalb des heutigen Land- kreises Kamenz (einschließlich der kreisfreien Stadt Hoyerswerda) gelegene Teil der Oberlau- sitz. Diese reicht(e) abschnittsweise allerdings z. T. weit über den Landkreis Kamenz hinaus (besonders im Nordwesten und im Südosten), während andererseits der Südwestteil des Land- kreises Kamenz nicht Bestandteil der Oberlausitz ist bzw. war (Bezugsjahr 1777). Die Westlau- sitz ist landschaftlich sehr vielgestaltig. Mehrere große, charakteristische Naturräume (Makro- geochoren) der Tieflands- und der Hügellandregion (sowie bedingt des Berglandes) haben Anteil an der Westlausitz. -

Master's Thesis Tourism Innovation As a Driver for Rural Development In
Master’s Thesis Tourism innovation as a driver for rural development in Europe. Case studies from Germany. Tourismus Innovation als Schlüsselfaktor für die Entwicklung des ländlichen Raums. Fallstudien aus Deutschland. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in World Heritage Studies by Elena Bubeeva 3438836 Date of submission: 17.07.2017 Supervisors: Prof. Dr. Britta Rudolff Visiting Professor at the Chair of Cultural Heritage Management at the Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany Dr. Dariya Afanasyeva Chair of Environmental Planning at the Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany ‘If innovation is the spark, then knowledge is the fuel that drives tourism’ Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General Photo credits: unwto.org To my dearest grandfather, Candidate of Sciences in Agriculture, who instilled me with passion for knowledge and constant curiosity for this big world from the early childhood Посвящается моему дорогому дедушке, к.б.н. тому, кто привил жажду к знаниям с раннего детства Statement of Authentication I hereby declare that I have written the present thesis independently, without assistance from external parties and without use of other resources than those indicated. The ideas taken directly or indirectly from external sources (including electronic sources) are duly acknowledged in the text. The material, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. Place, Date Signature Verfassererklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht. -

VVO-Flyer Lausitz
VVO-Tarifzonenplan AUF IN DIE Ticketkauf Fahrplanauskunft Mit dem Zug zum Strand LAUSITZ mit Übersicht schnellfahrender und touristischer Linien Cottbus Elsterwerda- Berlin Biehla Plessa S 4 92 Torgau/Leipzig Spremberg RB 31 Zerre Großkoschen Geierswalde Elsterwerda Lauchhammer 166 160 x 800 Prösen 93 Verkehrsverbund Mühlberg Prösen West Prösen Ost Berlin-Brandenburg 166 166 Senftenberg/ 166 33 Ihren Fahrplan Gröditz Cottbus RE 15 Laubusch 20 94 RB 31 Hosena Hoyerswerda Ruhland S 4 RB 64 Außig Tiefenau Frauenhain Lauta Schwarzkollm Hy-Neustadt Lohsa erhalten Sie Mitteldeutscher Wülknitz 43 Ortrand 150 159 RB 45 x Verkehrsverbund 433 F30 461 Zabeltitz RE 15 Uhyst RB 64 RE 18 Wittichenau Elbe Görlitz Zeithain Großenhain Strehla 441 Roda Cottb Bf Lampertswalde Bernsdorf Thiendorf 159 103 91 über das Mobilitätsportal im Internet Glaubitz Röderau 441 x x 150 32 456 Folbern 477 182 www.vvo-online.de Riesa 450 Nünchritz 450 34 x x Oschatz/ 477 456 Leipzig RE 50 F29 42 Königsbrück x 409 171 30 82 Königswartha aktuelle Fahrplanauskünfte und Fahrplanänderungen RE 50 Tauscha Kamenz Seerhausen 430 40 Zweckverband Lenz Laußnitz 446 407 458 Ebersbach Gräfenhain Verkehrsverbund RB 45 41 Priestewitz Oberlausitz- RB 33 Tarifinformationen Stauchitz 102 103 Niederschlesien Prausitz Nieder- Diesbar- RB 31 182 lommatzsch F28 Seußlitz Bischheim- 409 RE 15 Radeburg Ottendorf-Okrilla Nord Gersdorf Löbsal RE 18 Zwischen Wasserwelt RE 50 Ottendorf-Okrilla Hp Informationen über touristische Verkehre 415 Steinbach 430 405 Elstra 102 VVO-Mobilitätszentrale RB 45 -
Powiat Bolesławiecki Bolesławiec County Der Landkreis Bolesławiec
Powiat Bolesławiecki Bolesławiec County Der Landkreis Bolesławiec Powiat bolesławiecki leży w południowo-za- chodniej części kraju w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jest on drugim co do wielkości powiatem tegoż województwa. Tutaj też przebiega granica pomiędzy województwami dol- nośląskim i lubuskim. Powiat bolesławiecki położo- ny jest w pobliżu granic Polski z Czechami i z Niem- cami, na skrzyżowaniu dróg łączących Wschodnią i Zachodnią Europę oraz Skandynawię z Europą Południową. Przez obszar powiatu prowadzi auto- strada A4 oraz autostrada A18, dzięki czemu Powiat jest bardzo dobrze dostępny komunikacyjnie, co podnosi jego atrakcyjność turystyczną. Doskonała baza noclegowa pozwola na wypoczynek w ulubio- ny sposób - spokojne zwiedzanie atrakcji Powiatu czy aktywne spędzanie wolnego czasu w Borach Dolnośląskich, nad wodą i w pobliskich górach. 2 Der Bunzlauer Landkreis befindet sich in dem süd- -westlichen Teil des Landes und im nord-westlichen Teil der Wojewodschaft Niederschlesien. Hier verläuft auch die Grenze zwischen den Wojewodschaften Niederschlesien und Lebus. Der Bunzlauer Landkreis befindet sich in der Nähe der Grenze zwischen Polen und Tschechien sowie Deutschland, an der Wegkre- uzung, die die West- und Osteuropa sowie Skandina- vien mit Südeuropa verbindet. Durch das Gebiet des Landkreises führen die geplante Autobahnen A4 und A18. Durch den Kreis verläuft die Autobahn A4 und A18, was dem Kreis eine sehr gute Verkehrslage ver- schafft; dadurch ist der Kreis touristisch sehr attrak- tiv. Umfangreiche Übernachtungsmöglichkeiten bie- ten Ihnen die Freizeitgestaltung auf beliebige Art und Weise – es kann ruhige Besichtigung der Attraktione des Kreises, sei es aktive Zeitverbringung in der Nie- derschlesischen Heide, am Wasser oder in dem nah gelegenen Gebirge. 3 The Bolesławiec County was created in 1999 as part of an administrative reform. -

Abfallkalender 2021 Pdf | 4,69 MB
Abfallkalender 2021 BAUTZEN · KAMENZ · HOYERSWERDA Wotpadkowa protyka BUDYŠIN · KAMJENC · WOJERECY Korrekturen im Tourenplan gegenüber der gedruckten Version www.nehlsen.com Ihr starker Partner in der Region für Privat und Gewerbe > Abscheiderservice > Straßenreinigung > Baustellenentsorgung > Winterdienst > Betrieb von Wertstoffhöfen > Containerdienst * > Grünanlagenpflege > Industrieentsorgung 5€ > Kanal- und Grubenreinigung GUTSCHEIN für die Wertstoffhöfe > Sonderabfallentsorgung in Radeberg und Kamenz * Gültig ab einem Mindestumsatz von 50 € brutto. Pro Anlieferung kann nur ein Gutschein genutzt werden. Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG Radeburger Str. 65 | 01689 Niederau OT Gröbern | Tel.: 03521 7654-0 | Fax.: 03521 7654-44 Wertstoffhof Kamenz | Neschwitzer Straße 66 | 01917 Kamenz | Tel.: 03578 34020 | Fax: 03578 3402-15 Wertstoffhof Radeberg | Pillnitzer Straße 1 | 01454 Radeberg | Tel.: 03528 4361-0 | Fax: 03528 4361-49 E-Mail: [email protected] Inhalt Wobsah 4 Vorwort Prˇedsłowo 6 Auskunft und Beratung Informacije a poradz´owanje 7 Abfallgebühren 2021 Wotpadkowe popłatki 2021 8 Beauftragte Entsorgungsunternehmen Za wotwožowanje zamołwite prˇedewzac´a 9 Touren und Termine von A bis Z Tury a terminy wot A do Z 36 Hinweise zum Datenschutz Pokiwy k škitej datow 37 Touren-Finder Kompas k namakanju turow Bautzen, Bischofswerda, Hoyerswerda und Kamenz Budyšin, Biskopicy, Wojerecy a Kamjenc Faltblatt Abfalltrennung – Was gehört in welche Tonne? Dz´eˇlenje wotpadkow – Što słuša do kotreho zbeˇrnika? Sfałdowane łopjeno Restabfall, Bioabfall, -

Erlebnis Westlausitz Ihr Freizeit- Und Ferienplaner 02-11 Thematische Seiten.Qxp 14-15 Skater, Wünsdorf 11.06.17 16:20 Seite 1
01 Titel original.qxp_14-15 Skater, Wünsdorf 12.06.17 13:36 Seite 1 Erlebnis Westlausitz Ihr Freizeit- und Ferienplaner 02-11 Thematische Seiten.qxp_14-15 Skater, Wünsdorf 11.06.17 16:20 Seite 1 Eine Postkutsche sieht man selten. Bei der Schlossrundfahrt der Pferdegespanne in der Westlausitz allerdings schon. Mehr über diesen Publikumsmagneten und Möglichkeiten zum Reiten: Freizeit-Reitverein „Hufnagel” e.V., Pickauer Dorfweg 2 in 01877 Bischofswerda Ansprechpartner Andreas Mikus (s. auch S. 14), Tel. 03594 701365 o. 0171 7892481 [email protected], www.reitverein-hufnagel.de Inhalt 16 Übersichtskarte Westlausitz 04 Die Landschaft der Westlausitz mit vielen Tipps und Sehenswürdigkeiten 06 Schlösser, Parks und Museen 18 Rammenau – Kinderstube des großen Denkers 08 Traditionelles Handwerk 19 Verführung im Barockschloss 10 Wo Familien was erleben Wallroda – Die Kunstblumenmanufaktur 12 Bischofswerda – eine Stadt, ein Holzkarren Arnsdorf – Übernachtungstipp und deren gemeinsame Geschichte 20 Pulsnitz – Eine Stadt zum Anbeißen Karlsdorf – Übernachtungstipp Pfefferküchlerei Löschner 14 Bischofswerda – Das Netzwerk für Kinder- & 21 Schumanns Genusswerkstatt Jugendarbeit e.V.; Der Berg-Gasthof Butterberg 22 Steina – Spektakuläre Aussicht vom Schweden- 15 Kamenz – Das Museum der Westlausitz stein; Hotel- und Bergrestaurant Elstra – Der Black Mountain Bike Park Entspannen auf einem Bauernhof 02-11 Thematische Seiten.qxp_14-15 Skater, Wünsdorf 08.06.17 16:45 Seite 2 Rast im sanften Hügelland Willkommen im westlichen Teil der Oberlausitz zwischen Dresden und Bautzen Als Landstrich voller Geheimtipps und versteckter Reize – so offenbart sich die Westlausitz in unmittelbarer Nähe zu Sachsens Landeshauptstadt Dresden. Fünf Städte und sieben Gemeinden bilden die Region, die sich zwischen Königs- brücker Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sowie dem Elbsand- steingebirge ausdehnt. -

CAA 2003, Vienna, Austria 1 GIS-Analysis in the Reconstruction Of
GIS-analysis in the reconstruction of an early medieval landscape. The Upper Lusatian case-study George Indruszewski Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. Leipzig and Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Roskilde Abstract The GIS-software has been used as a main tool in reconstructing the early medieval landscape in the Upper Lusatia (Saxony, Germany) territory. Quality cartographic data (Landesvermessungsamt Sachsen) was used to produce GIS-based (ArcView) 2D maps of natural and man-made features tied afterwards to a relational database of non-spatial attributes containing archaeological, historical, and linguistic data. The preliminary work included also the elaboration of a DEM (ArcView, ArcInfo, ArcGIS) used to further the reconstruction and the analysis of landscape themes. GIS was used as a working platform onto which spatial statistical analysis and more common GIS-based spatial analysis (viewshed, line-of-sight, distance, proximity, etc.) were integrated with satellite imagery and other photo documentation. The results, so far are encouraging us to plead for the scientific benefits and potentials of GIS-based analysis and reconstruction of early medieval landscapes. Introduction Bautzen/Budysin is considered the de facto cultural capital of the Sorbian minority in the larger region of the Sorbian/German Upper Lusatia, this perception being grounded mostly on decades of intermittent historic and archaeological research that underlined the central importance of this place for the region. The reconstruction of an early medieval landscape for this region focuses therefore, on the reconstitution of the multiple relationships between Bautzen/Budyšin as central place and the peripheral settlements during the early and the High Middle Ages. -

Setzen Von Telefonnummern Mit Latex
ENUMB N E O 3 2 1 R H 4 S P 5 Version 2.3 20. August 2021 S 6 e X t E z T e 7 A n 8 0 L v it o 9 n m T n el er efonnumm Paketautor Keno Wehr Fehlermeldungen https://github.com/wehro/phonenumbers/issues Dieses Paket ermöglicht es, Telefonnummern unterschiedlichen nationalen Kon- ventionen entsprechend zu setzen und bei Bedarf auch zu verlinken. Unter- stützt werden deutsche, österreichische, französische, britische und nordame- rikanische Telefonnummern. Nummern aus anderen Ländern werden rudimen- tär unterstützt. An English version of this manual is available in the file phonenumbers-en.pdf. Inhaltsverzeichnis 1 Schnelleinstieg 3 6.3 Optionen ........ 24 1.1 Deutschland ...... 3 6.4 Ungültige Nummern .. 25 1.2 Österreich ........ 3 1.3 Frankreich ....... 4 7 Nordamerikanische Tele- 1.4 Großbritannien ..... 4 fonnummern 26 1.5 Nordamerika ...... 5 7.1 Geltungsbereich .... 26 1.6 Andere Länder ..... 5 7.2 Aufbau der Nummern . 27 7.3 Optionen ........ 28 2 Allgemeine Prinzipien 6 7.4 Ungültige Nummern .. 30 2.1 Grundideen des Pakets 6 2.2 Befehle .......... 6 8 Technische Hinweise 31 2.3 Verlinkung von Telefon- nummern ........ 7 A Literatur 32 2.4 Optionen ........ 8 B Deutsche Vorwahlen 36 2.5 Ungültige Nummern .. 10 B.1 Ortsvorwahlen ..... 36 2.6 Lizenz .......... 10 B.2 Sondervorwahlen ... 89 3 Deutsche Telefonnummern 11 C Österreichische Vorwahlen 91 3.1 Aufbau der Nummern . 11 C.1 Ortsvorwahlen ..... 91 3.2 Optionen ........ 12 C.2 Sondervorwahlen ... 101 3.3 Ungültige Nummern .. 13 D Französische Vorwahlen 103 4 Österreichische Telefon- D.1 Regionalvorwahlen .. -
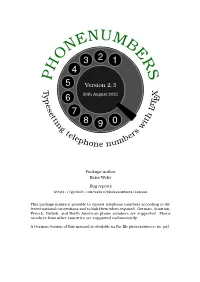
Typesetting Telephone Numbers with Latex
ENUMB N E O 3 2 1 R H 4 S P 5 Version 2.3 T y 20th August 2021 X p 6 E e T s A L e 7 t h t t in 8 0 i g 9 w te rs lep be hone num Package author Keno Wehr Bug reports https://github.com/wehro/phonenumbers/issues This package makes it possible to typeset telephone numbers according to dif- ferent national conventions and to link them when required. German, Austrian, French, British, and North American phone numbers are supported. Phone numbers from other countries are supported rudimentarily. A German version of this manual is available in the file phonenumbers-de.pdf. Contents 1 Quick Start 4 1.1 Germany ................................. 4 1.2 Austria ................................... 4 1.3 France ................................... 5 1.4 United Kingdom ............................. 5 1.5 North America .............................. 6 1.6 Other Countries ............................. 6 2 General Principles 7 2.1 Basic Ideas of the Package ....................... 7 2.2 Commands ................................ 7 2.3 Linking of Phone Numbers ....................... 8 2.4 Options .................................. 9 2.5 Invalid Numbers ............................. 11 2.6 Licence .................................. 11 3 German Phone Numbers 12 3.1 Structure of the Numbers ........................ 12 3.2 Options .................................. 13 3.3 Invalid Numbers ............................. 14 4 Austrian Phone Numbers 16 4.1 Structure of the Numbers ........................ 16 4.2 Options .................................. 17 4.3 Invalid Numbers ............................. 18 5 French Phone Numbers 20 5.1 Scope ................................... 20 5.2 Structure of the Numbers ........................ 20 5.3 Options .................................. 22 5.4 Invalid Numbers ............................. 23 6 British Phone Numbers 24 6.1 Scope ................................... 24 6.2 Structure of the Numbers .......................