Gratia. Mediale Und Diskursive Konzeptualisierungen Ästhetischer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Church of St. Aidan Blood Drive Sunday, September 22, 2019 8:00Am-2:00Pm Msg. Kirwin Hall 525 Willis Avenue, Williston Park
CHURCH OF SAINT AIDAN WILLISTON PARK Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? September 8, 2019 505 Willis Ave. Williston Park We invite New York 11596-1727 everyone to 516-746-6585 516-746-6055 (Fax) walk with Rectory Office Hours Monday to Friday Jesus 9:00 AM to 5:00 PM Saturday & Sunday and 9:00 AM to 1:00 PM www.staidanparish.org experience [email protected] His Pastor Rev. Adrian McHugh healing Associate Pastors power and Rev. Ken Grooms Rev. Solomon Odinukwe Rev. Robinson Sierra love In Residence Rev. Edward Sheridan Baptism the 4th Sunday of each month. Baptisms are held on the 1st Deacons Anyone who is homebound may Rev. Salvatore B. Villani Sunday and 3rd Sunday at 1:30 PM. receive Holy Communion at home Rev. Rudy Martin ext. 9412 Contact the Rectory office ext. 9101 on a regular basis. Call the rectory - Tuesday-Friday between the hours ext. 9101. St. Aidan School of 10:00 AM-3:00 PM. ext. 9202, 9203 Grades Nursery-2 ext. 9302, 9303 Grades 3-8 Confession / Reconciliation Principal Baptism Class For New Parents Reconciliation is celebrated every Mrs. Julie O’Connell The required Baptism class for new Saturday from 12:30-1:30 PM and Assistant Principal parents is held the second Sunday 4:00-5:00 PM in the church or by Ms. Barbara Graham of each month beginning with the appointment with a priest. 12:00 Mass parents are asked to Faith Formation ext. -

L'osservatore Romano
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia € 1,00 Copia arretrata €2,00 L’OSSERVATORE ROMANO GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO Unicuique suum Non praevalebunt Anno CLX n. 222 (48.546) Città del Vaticano lunedì-martedì 28-29 settembre 2020 . All’Angelus il nuovo appello del Papa Per Fauci un vaccino sicuro pronto all’inizio del 2021 La strada del dialogo e del negoziato Un milione di morti per la pace nel Caucaso a causa del covid-19 Nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato il pensiero agli sfollati interni costretti a fuggire come Gesù Essendo «giunte preoccupanti noti- di Maria Luigia del Santissimo Sa- E nel constatare che «la pande- presto risollevarsi dalle attuali diffi- zie di scontri nell’area del Caucaso», cramento (al secolo Maria Velotti), mia ha colpito duramente questo coltà». Papa Francesco è tornato a lanciare fondatrice della congregazione delle settore, così importante per tanti In precedenza, commentando co- un nuovo appello — dopo quello del suore Francescane adoratrici della Paesi», il vescovo di Roma ha volu- me di consueto il vangelo domenica- 19 luglio scorso — «per la pace» nel- Santa Croce, e la Giornata mondiale to incoraggiare «quanti operano le (Matteo 21, 28-32), il Papa aveva la regione, chiedendo «alle parti in del turismo, che si celebrava nella nel turismo», in particolare le pic- parlato della parabola dei due figli. conflitto di compiere gesti concreti stessa XXVI domenica del tempo or- cole imprese familiari e i giovani, di buona volontà e di fratellanza, dinario. con l’auspicio «che tutti possano PAGINA 8 che possano portare a risolvere i problemi non con l’uso della forza e delle armi, ma per mezzo del dialo- go e del negoziato». -

ISSN 1661-8211 | 117. Jahrgang | 30. April 2017
2017/08 ISSN 1661-8211 | 117. Jahrgang | 30. April 2017 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30. jeden Monats Hinweise unter: http://ead.nb.admin.ch/web/sb-pdf/ ISSN 1661-8211 © Schweizerische Nationalbibliothek NB, CH-3003 Bern. Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Sommario - Cuntegn - Table of contents Inhaltsverzeichnis - Table des matières - 300 Sozialwissenschaften / Sciences sociales / Scienze Sommario - Cuntegn - Table of contents sociali / Scienzas socialas / Social sciences.......................... 10 000 Allgemeine Werke, Informatik, 300 Sozialwissenschaften, Soziologie / Sciences sociales, Informationswissenschaft / Informatique, information, sociologie / Scienze sociali, sociologia / Scienzas socialas, ouvrages de référence / Informatica, scienza sociologia / Social sciences, sociology.........................................10 dell'informazione, generalità / Informatica, infurmaziun e referenzas generalas / Computers, information and general 320 Politikwissenschaft / Science politique / Scienza politica / Politica / Political science.............................................................12 reference........................................................................................ 1 330 Wirtschaft / Economie politique / Economia / Economia / Economics..................................................................................... 13 000 Allgemeine Werke, Wissen, Systeme / -

Programmi 2005/2006 Insegnamenti Annuali (6 + 6 Cfu)*
Programmi 2005/2006 Insegnamenti annuali (6 + 6 cfu)* • Antropologia filosofica (Irene Kajon) • Bioetica (Piergiorgio Donatelli) • Ermeneutica filosofica (Maria Giovanna Sillitti) • Estetica (Giuseppe Di Giacomo) • Estetica (Edoardo Ferrario) • Estetica (Pietro Montani) • Etica (Claudia Mancina) • Etica sociale (Francesco Saverio Trincia) • Filosofia del diritto (Filippo Gonnelli) • Filosofia del linguaggio (Donatella Di Cesare) • Filosofia della religione (Marco M. Olivetti) • Filosofia della scienza (Roberto Cordeschi) • Filosofia della scienza (Cesare Cozzo) • Filosofia della scienza (Elena Gagliasso) • Filosofia della storia (Marcella D'Abbiero) • Filosofia morale (Alessandra Attanasio) • Filosofia morale (Eugenio Lecaldano) • Filosofia politica (Stefano Petrucciani) • Filosofia teoretica (Tito Magri) • Filosofia teoretica (Mario Reale) • Istituzioni di filosofia morale (Paolo Vinci) • Istituzioni di filosofia teoretica (Paola Rodano) • Letteratura inglese (Hilary Gatti Cox) • Letteratura tedesca (Mauro Ponzi) • Logica (Carlo Cellucci) • Metodologia della ricerca pedagogica (Giuseppe Boncori) • Pedagogia generale (Lucio Pagnoncelli) • Pedagogia generale (Nicola Siciliani De Cumis) • Pedagogia sperimentale (Pietro Lucisano) • Propedeutica filosofica (Marco Borioni / Supplente: Guido Coccoli) • Psicologia dell'apprendimento (M. Serena Veggetti) • Psicologia generale (M. Ernestina Giannattasio) • Psicologia generale (M. Serena Veggetti) • Semiotica (Caterina Marrone) • Storia dell'estetica (Stefano Velotti) • Storia della filosofia (Giuseppe -

Fratrumminorum
ACTA ORDINIS FRATRUM MINORUM VEL AD ORDINEM QUOQUO MODO PERTINENTIA IUSSU ET AUCTORITATE Fr. MICHAEL ANTHONY PERRY TOTIUS ORD. FR. MIN. MINISTRI GENERALIS IN COMMODUM PRAESERTIM RELIGIOSORUM SIBI SUBDITORUM IN LUCEM AEDITA Veritatem facientes in caritate (Eph. 4,15). Peculiari prorsus laude dignum putavimus, dilecte Fili, consilium quo horum Actorum collectio atque editio suscepta est. (Ex Epist. LEONIS PP. XIII ad Min. Gen.) ROMA CURIA GENERALIS ORDINIS CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA FR. MICHAEL A. PERRY, ofm, Min. Gen. Fr. LUIGI PERUGINI Director Fr. GIANPAOLO MASOTTI Director responsabilis Autoriz. N. 10240 del Trib. di Roma, 8-3-1965 Impaginazione e grafica Fr. Alvin Te per l’Ufficio Comunicazioni OFM – Roma Stampato dalla TIPOGRAFIA MANCINI S.A.S. – Tivoli (Roma) nel mese di giugno dell’anno 2016 E SANCTA SEDE 1. Papa Francesco Tra questi vorrei ricordare lo sforzo fatto per favorire l’incontro dei leader mondiali, 1. Messaggio per la XLIX Giornata Mondiale nell’ambito della COP 21, al fine di cercare della Pace nuove vie per affrontare i cambiamenti climatici 1° gennaio 2016 e salvaguardare il benessere della Terra, la nostra casa comune. E questo rinvia a due Vinci l’indifferenza precedenti eventi di livello globale: il Summit e conquista la pace di Addis Abeba per raccogliere fondi per lo sviluppo sostenibile del mondo; e l’adozione, 1. Dio non è indifferente! A Dio importa da parte delle Nazioni Unite,dell’Agenda dell’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, finalizzata del nuovo anno, vorrei accompagnare con ad assicurare un’esistenza più dignitosa a tutti, questo mio profondo convincimento gli auguri soprattutto alle popolazioni povere del pianeta, di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno entro quell’anno. -
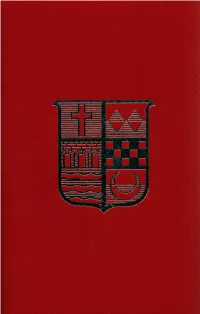
Scanned Using Book Scancenter 5131
Sacred Sneart nMiiversitu Tweniy-O^inth Commencement Sunday Afternoon THE Twenty-First of May Nineteen Hundred Ninety-Five One O’clock ’ University Campus I n^oard of ^Trudees Chairman The Most Rev. Edward M. Egan, J.C.D. Vice-Chairman Robert J. Matura President Anthony J. Cernera, Ph.D. Secretary Robert L. Julianelle, J.D. Treasurer James J. Costello Angelica Urra Berrie Alumni Representative William J. Conaty to the Board A. Joan Connor Betty S. Lynch ’74 Victor R. Coudert, Jr. Michael Daley Life Trustee Fred C. Frassinelli, Jr. The Most Rev. Walter W. Curtis, Rev. Msgr. William Genuario, J.C.D. S.T.D. Romelee A. Howard, M.D. Founder and Chairman Emeritus Robert W. Huebner Thomas L. Kelly Trustees Emeriti William J. Kelly Prescott S. Bush, Jr. Christopher K. McLeod J. Edward Caldwell, J.D. Paul S. Miller David E.A. Carson Mary Ann Reberkenny Mercedes De Arango, Ph.D. William J. Riordan Robert Delaney, L.L.B., C.P.A William V. Roberti ’69 Lestet J. Dequaine, L.L.B. Ralph L. Rossi Charles M. Grace Lois Schine John McGough Robert D. Scinto ’71 Manning Pattillo, Ph.D. Lloyd Stauder, J.D. Carmen A. Tortora Rev. Msgr. Kevin W. Wallin U^rogram Processional Conferral of Raoul De Villiers, Ph.D. Honorary Degrees Mace Bearer and Marshal President Cernera Master of Ceremonies Thomas J. Trebon, Ph.D. William Pitt Provost and Vice President for Academic Affairs Citation read by Camille P. Reale National Anthem Professor of Management Erica M. Clough Class of 1996 Hood vested by Robert D. -

Women's Bowling Association 1980 - 1981
CENTRAL JERSEY „no„ 1979 -1980 WOMEN’S BOWLING AVERAGE BOOK ASSOCIATION Central Jersey Women's Bowling Association 1980 - 1981 Officers: President: - Mrs. Florence Filo 120 Dawn Drive, Port Reading, N.J. 07064 541-8166 1st Vice-Pres: - Mrs. Pati Kane 4 East Zoller Road, East Brunswick, N.J. 08816 238-3812 2nd Vice-Pres: - Mrs. Janet Stanley 30 Foley Avenue, Edison, N.J. 08817 382-1674 Secretary: - Mrs. Edna C. Kaminski Office: 790 Route #1, c/o Carolier Lanes North Brunswick, N.J. 08902 247-2350 Wednesday 10:30 - 3:00 P.M. Home: 4 Beryl Court, Kendall Park, N.J. 08824 297-2283 after 6:00 P.M. Treasurer: - Mrs. Marie Thunstrom 279 Herbert Avenue, Old BRidge, N.J. 08857 251-8078 Sgt. at Arms: - Mrs. Ethel Wantuck 11 Grove Avenue, Woodbridge, N.J. 07095 634-0442 Directors - One Year Term - Mrs. Anne Heenan 11 Newman Street, Metuchen, N.J. 08840 549-2672 - Mrs. Helen Miller 19 Comstock Road, Edison, N.J. 08817 985-0056 - Mrs. Dottie Moore 19 Stanworth Road, Kendall Park, N.J. 08824 297-2230 - Miss Jill Praizner 101 Harrison Avenue, Iselin, N.J. 08830 388-8144 - Mrs. Linda Senyszyn 104 Weber Avenue, Sayreville, N.J. 08872 238-0183 Directors - Two Year Term - Mrs. April Booth 131 Randolph Avenue, South Plainfield, N.J. 07080 753-4414 - Mrs. Helen Dee 8 Bedford Road, Kendall Park, N.J. 08824 297-5662 - Mrs. Mary Foster 28 Wallace Street, East Brunswick, N.J. 08816 257-1894 - Mrs. Rose Haines 1624 Windrew Avenue, South Plainfield, N.J. 07080 561-1655 - Mrs. -

Fratrum Minorum Vel Ad Ordinem Quoquo Modo Pertinentia
Acta_Ordinis_3_2010:Layout 1 23-02-2011 11:22 Pagina 353 ACTA ORDINIS FRATRUM MINORUM VEL AD ORDINEM QUOQUO MODO PERTINENTIA IUSSU ET AUCTORITATE Fr. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO TOTIUS ORD. FR. MIN. MINISTRI GENERALIS IN COMMODUM PRAESERTIM RELIGIOSORUM SIBI SUBDITORUM IN LUCEM AEDITA Veritatem facientes in caritate (Eph. 4, 15). Peculiari prorsus laude dignum putavimus, dilecte Fili, consilium quo horum Actorum collectio atque editio suscepta est. (Ex Epist. LEONIS PP. XIII ad Min. Gen.) ROMA CURIA GENERALIS ORDINIS Acta_Ordinis_3_2010:Layout 1 23-02-2011 11:22 Pagina 354 CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA Fr. JOSÉ R. CARBALLO, ofm, Min. Gen. Fr. LUIGI PERUGINI Director Fr. GIANPAOLO MASOTTI Director responsabilis Autoriz. N. 10240 del Trib. di Roma, 8-3-1965 Impaginazione Ingegno Grafico • Subiaco (Roma) Stampato dalla TIPOGRAFIA MANCINI S.A.S. – Tivoli (Roma) nel mese di febbraio dell’anno 2011 Acta_Ordinis_3_2010:Layout 1 23-02-2011 11:22 Pagina 355 EX ACTIS SUMMI PONTIFICIS 1. Udienza generale del mercoledì: santa merevoli donne nel corso della storia sono sta- Chiara d’Assisi te affascinate dall’amore per Cristo che, nella bellezza della sua Divina Persona, riempie il Aula Paolo VI, 15.09. 2010 loro cuore. E la Chiesa tutta, per mezzo della mistica vocazione nuziale delle vergini consa- LA CHIESA crate, appare ciò che sarà per sempre: la Spo- DEVE MOLTO ALLE DONNE sa bella e pura di Cristo. In una delle quattro lettere che Chiara inviò Cari fratelli e sorelle, a sant’Agnese di Praga, la figlia del re di Boe- una delle Sante più amate è senz’altro san- mia, che volle seguirne le orme, parla di Cri- ta Chiara d’Assisi, vissuta nel XIII secolo, con- sto, suo diletto Sposo, con espressioni nunzia- temporanea di san Francesco. -

Church of Saint Aidan Williston Park
CHURCH OF SAINT AIDAN WILLISTON PARK September 15, 2019 505 Willis Ave. Williston Park We invite New York 11596-1727 everyone to 516-746-6585 516-746-6055 (Fax) walk with Rectory Office Hours Monday to Friday Jesus 9:00 AM to 5:00 PM Saturday & Sunday and 9:00 AM to 1:00 PM www.staidanparish.org experience [email protected] His Pastor Rev. Adrian McHugh healing Associate Pastors power and Rev. Ken Grooms Rev. Solomon Odinukwe Rev. Robinson Sierra love In Residence Rev. Edward Sheridan Baptism the 4th Sunday of each month. Baptisms are held on the 1st Deacons Anyone who is homebound may Rev. Salvatore B. Villani Sunday and 3rd Sunday at 1:30 PM. receive Holy Communion at home Rev. Rudy Martin ext. 9412 Contact the Rectory office ext. 9101 on a regular basis. Call the rectory - Tuesday-Friday between the hours ext. 9101. St. Aidan School of 10:00 AM-3:00 PM. ext. 9202, 9203 Grades Nursery-2 ext. 9302, 9303 Grades 3-8 Confession / Reconciliation Principal Baptism Class For New Parents Reconciliation is celebrated every Mrs. Julie O’Connell The required Baptism class for new Saturday from 12:30-1:30 PM and Assistant Principal parents is held the second Sunday 4:00-5:00 PM in the church or by Ms. Barbara Graham of each month beginning with the appointment with a priest. 12:00 Mass parents are asked to Faith Formation ext. 9404, 9405 gather at St. Joseph’s statue to the Adoration Director ext. 9406 right of the main altar. -

Archdiocese of Madras Mylapore, January 2020
3. A spirit of Audacity: Gideon (Jg 6), the young Jewish servant girl Archbishop Speaks.... (2 Kings 5) and young Ruth (Ru 4) symbolise the courage of the youth, their frankness and their valour in questioning, in intervening and in accepting challenges. Their audacity bears fruit not just for them but Biblical Inspirations for a Relevant Youth Spirituality also for their families and their communities. While the scripture insists on a spirit of obedience and respect for the elders and the traditions, it Dear brothers and sisters in Christ Jesus, does not advocate a spirit of slavery. When our youth question, critique and evaluate existing norms, dogmas, doctrines and values, they enter As 2020 dawns, I extend my prayerful greetings and blessings to into a dialogue between our past and their present. The result of this each of you and your families for a grace-filled and prosperous year dialogue will become evident in their faith and in the fruitfulness of ahead. In the light of the reflections of Christus vivit, the Post-Synodal their discipleship. The courage of the youth is not a threat to our Apostolic Exhortation published by our Holy Father Pope Francis on traditions but a fruitful process of continued dialogue. 25th March 2019, the Church in Tamil Nadu has consecrated the year 2020 as the Year of the Youth. As mentioned in my message last month, The challenges facing the children and youth of our country I propose to reflect with you on the youth. are truly alarming. Political ideologies that seek to divide, exclude and polarise threaten the secular fabric of our nation. -
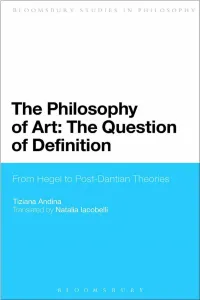
The Philosophy of Art: the Question of Definition
The Philosophy of Art: The Question of Definition Bloomsbury Studies in Philosophy Bloomsbury Studies in Philosophy presents cutting-edge scholarship in all the major areas of research and study. The wholly original arguments, perspectives and research findings in titles in this series make it an important and stimulating resource for students and academics from a range of disciplines across the humanities and social sciences. Available in the series: Aesthetic and Artistic Autonomy, edited by Owen Hulatt Art, Language and Figure in Merleau-Ponty, Rajiv Kaushik Art, Myth and Society in Hegel’s Aesthetics, David James The Challenge of Relativism, Patrick J. J. Phillips The Cognitive Value of Philosophical Fiction, Jukka Mikkonen The Demands of Taste in Kant’s Aesthetics, Brent Kalar The Dialectics of Aesthetic Agency, Ayon Maharaj Descartes and the Metaphysics of Human Nature, edited by Justin Skirry Dialectic of Romanticism, Peter Murphy and David Roberts Kant: The Art of Judgment in Aesthetic Education, Pradeep Dhillon Kant’s Aesthetic Theory, David Berger Kant’s Concept of Genius, Paul W. Bruno Kant’s Transcendental Arguments, Scott Stapleford Kierkegaard, Metaphysics and Political Theory, Alison Assiter Metaphysics and the End of Philosophy, H. O. Mounce Popper’s Theory of Science, Carlos Garcia The Science, Politics, and Ontology of Life-Philosophy, edited by Scott M. Campbell and Paul W. Bruno Virtue Epistemology, Stephen Napier The Philosophy of Art: The Question of Definition From Hegel to Post-Dantian Theories Tiziana Andina Translated by Natalia Iacobelli LONDON • NEW DELHI • NEW YORK • SYDNEY Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square 175 Fifth Avenue London New York WC1B 3DP NY 10010 UK USA www.bloomsbury.com First published 2013 © Tiziana Andina, 2013 Translated by Natalia Iacobelli All rights reserved. -

Roman Catholic Church of Saint Aidan
Roman Catholic505 Willis Avenue, Church Williston Park, New York of 11596 Saint Aidan 516-746-6585 516-746-6055 (Fax) The Salvation of Souls is the Supreme Law Mission Statement We, the parish family of the Church of Saint Aidan, strengthened by the Eucharist and encouraged by the Word of God, welcome all, for we recognize that everyone is a child of God and no one should be excluded. Guided by the Holy Spirit through prayer, we strive as one to build the Body of Christ. We commit ourselves to nurturing life-long faith formation, fostering lay leadership, promoting social justice, engaging our youth in every aspect of parish life, and offering care and compassionate service to all. We invite everyone to walk with Jesus and experience His healing power and love. Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 4, 2019 “Lord, do not delay in your coming!” The Pastoral Staff Rev. Adrian McHugh, Pastor Rev. Ken Grooms, Associate Pastor Rev. Solomon Odinukwe, Associate Pastor Rev. Robinson Sierra, Associate Pastor Rev. Edward Sheridan, In Residence Deacon Salvatore B. Villani Deacon Rudy Martin - ext. 9412 Mr. Drago Bubalo, DMA (cand). Music Director ext. 9130 E-mail address [email protected] www.staidanparish.org St. Aidan School Baptism (Grades Nursery-3. ext. 9202, 9203) Baptism of Children: Each month on the 1st Sunday and 3rd (Grades 4-8, ext. 9302, 9303) Sunday at 1:30 PM ceremony. Required: Parents’ class on the 2nd Miss Eileen P. Oliver, Principal Sunday of each month beginning with the 12:00 Mass. For Mrs. Julie O’Connell, Assistant Principal baptismal information, contact the Rectory office ext.