7. Jüdische Dramatik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shoah: Intervention. Methods. Documentation. S:I.M.O.N
01/2016 S: I. M. O. N. SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. ISSN 2408-9192 Issue 2016/1 Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Gustavo Corni/Dieter Pohl/Irina Sherbakova Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Philipp Rohrbach Web-Editor: Sandro Fasching Webmaster: Bálint Kovács Layout of PDF: Hans Ljung S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German. Funded by: © 2016 by the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI), S:I.M.O.N., the authors, and translators, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author(s) and usage right holders. For permission please contact [email protected] S: I. M. O. N. SHOAH: I NTERVENTION. M ETHODS. DOCUMENTATION. TABLE OF CONTENTS ARTICLES Suzanne Swartz Remembering Interactions 5 Interpreting Survivors’ Accounts of Interactions in Nazi-Occupied Poland Ionut Florin Biliuta Sowing the Seeds of Hate 20 The Antisemitism of the Orthodox Church in the Interwar Period Joanna Tokarska-Bakir The Hunger Letters 35 Between the Lack and Excess of Memory Johannes-Dieter Steinert Die Heeresgruppe Mitte 54 Ihre Rolle bei der Deportation weißrussischer Kinder nach Deutschland im Frühjahr 1944 Tim Corbett “Was ich den Juden war, wird eine kommende Zeit besser beurteilen …” 64 Myth and Memory at Theodor Herzl’s Original Gravesite in Vienna Sari J. Siegel The Past and Promise of Jewish Prisoner-Physicians’ Accounts 89 A Case Study of Auschwitz-Birkenau’s Multiple Functions David Lebovitch Dahl Antisemitism and Catholicism in the Interwar Period 104 The Jesuits in Austria, 1918–1938 SWL-READERS Susanne C. -

The Jewish Woman in a Torah Society
TEVES, 5735 I NOV.-DEC .. 1974 VOLUME X, NUMBERS 5-6 :fHE SIXTY FIVE CENTS The Jewish Woman in a Torah Society For Frustration or Fulfillment? Of Rights & Duties The Flame of Sara S chenirer The McGraw-Hill Anti-Sexism Memo ---also--- Convention Addresses by Senior Roshei Hayeshiva THE JEWISH OBSERVER in this issue ... OF RIGHTS AND DUTIES, Mordechai Miller prepared for publication by Toby Bulman.......................... 3 COMPLETENESS OF FAITH, based on an address by Rabbi Moshe Feinstein prepared for publication by Chaim Ehrman................... 5 CHUMASH: PREPARATION FOR OUR ENCOUNTER WITH THE WORLD, based on an address by Rabbi Yaakov Kamenetsky .................................. 8 SOME THOUGHTS ON MOSHIACH based on further remarks by Rabbi Kamenetsky ............... 9 PASSING THE TEST based on an address by Rabbi Yaakov Yitzchok Ruderman......................... I 0 JEWISH WOMEN IN A TORAH SOCIETY FOR FRUSTRATION? OR FULFILLMENT?, THE JEWISH OBSERVER is published monthly, except July and August, Nisson Wolpin ................. ............................................... 12 by the Agudath Israel of Amercia, 5 Beekman St., New York, N. Y. A FLAME CALLED SARA SCHENIRER, Chaim Shapiro 19 10038. Second class postage paid at New York, N. Y. Subscription: $6.50 per year; Two years, $11.00; BETH JACOB: A PICTORIAL FEATURE ........................ 24 Three years $15.00; outside of the United States $7 .50 per year. Single THE McGRAW HILL ANTI-SEXISM MEMO, copy sixty~five cents. Printed in the U.S.A. Bernard Fryshman ................................... .............. 26 RABBI N1ssoN WoLPIN MAN, a poem by Faigie Russak .......................................... 29 Editor Editorial Board WAITING FOR EACH OTHER DR. ERNST L. BODENHEIMER 30 Chairman a poem by Joshua Neched Yehuda .............................. RABBI NATHAN BULMAN RABBI JOSEPH ELIAS BOOK IN REVIEW: What ls the Reason - Vols. -
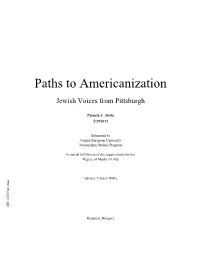
Paths to Americanization
Paths to Americanization Jewish Voices from Pittsburgh Pamela J. Abels 5/29/2012 Submitted to Central European University Nationalism Studies Program In partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts Adviser: Carsten Wilke CEU eTD Collection Budapest, Hungary Table of Contents Acknowledgements ...................................................................................................................................... iii Abstract ........................................................................................................................................................ iv Introduction—American Jewish Identity in Question .................................................................................. 1 Literature Review .......................................................................................................................................... 4 Chapter 1 Discourses on Americanization .................................................................................................. 13 1.1 Americanization—The Path of American Reform Judaism ........................................................... 16 1.2 Americanization of the Immigrant .................................................................................................. 20 1.3 Americanization of Orthodoxy ....................................................................................................... 21 1.4 Americanization in Newspaper Discourse ...................................................................................... -

Rumanian Minister Reassures Jews
HE ISH ERALD VOL. XIII, NO. 5 PROVIDENCE, R. I., FRIDAY, MARCH 11, 1938 5 CENTS THE COPY Rumanian Minister Reassures Jews Palestine Problems Seem Pleased "Russia," Topic of Requests Co-operation and Chief London Topic Center Lecturer Help to Restore Freedom Bucharest-In a letter to Roumania's chief Rabbi, Wise and Lipsky Arrange Reception Niemrowei, Dr. Miron Criestea new head of the Rouman Sail for England For New Members ian Cabinet, asked the Jewish Community to ossist the Government and the orthodox church in "restoring free New York.-Dr. Stephen S. Wise Maurice Hindus, noted authority dom and fostering co-operation among all peoples in the President, and Mr~ Louis Lipsky, on present-day Russia, will discuss service of God and the King." Vice-President o.f the American "Twenty Years of Soviet Russia" Jews, still frightened by the an ti-Semitic measures of the short Jewish Congress, sailed for Europe at the Jewish Community Center, lived regime of Premier Octavian last week aboard the S . s. Queen Sunday evening, March 13. Mr. Moes Chilim Starts Goga, were greatly encouraged by Mary, to confer with European Hindus, during his talk, will com the gesture of the Dr. Cristea, who, Jew;sh leaders on important pro Passover Campaign besides being Fernier, is Patriarch blems confronting the Jewish ment on the . treason trial now of the Roumanian Orthoa'Ox world. taking place in Moscow. Samuel Dr. Wise, who is President of the Workman will introduce the Harry Tannenbaum Church. Dr. Cristea's immediate pur Zionist Organization of America, speaker. Urges Full Support pose was to ask synagogues to hold and Mr. -
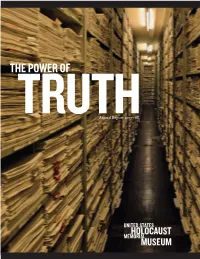
2007–08 Annual Report
THE POWER OF TRUTHAnnual Report 2007–08 THE TRUTH. iT HappenEd THEREFORE iT can HaPPEn again and iT can HaPPEn EvERyWHERE —Primo Levi, Holocaust survivor and author Contents 4 From Our Leadership 6 A Year of Outreach 8 Our Relentless Search for Truth 20 The Power of Truth to Confront Hate 28 The Power of Truth to Prevent Genocide 36 The Power of Truth to Change the World 46 Days of Remembrance Events 48 Our Partners 52 Our Donors 68 Financial Statement 69 United States Holocaust Memorial Council 2 annual report 2007–08 Our Relentless Search for Truth 3 DeaR FRiEndS, That the Holocaust can happen again is a fundamental truth The Holocaust teaches one of the greatest lessons about individual of the Museum. We are teaching people the world over another responsibility—the choice we each have to act or not to act and the truth: It didn’t have to happen, and that they have the power to prevent consequences of that decision. With your support, we continue building the next one. what is the world’s most comprehensive collection of evidence of this “crime of all crimes” against humanity. And what this evidence makes Three years ago, one of our Belfer Teachers so motivated his eighth painfully clear is that the Holocaust happened because ordinary people graders at a Catholic school in Louisville, Kentucky, by what they learned became accomplices to mass murder. Whether motivated by indifference, studying the Holocaust that they began to wonder why every student career advancement, peer approval, or antisemitism, in the long span did not have the same opportunity. -

CONTACT the Phoenix Project June 23, 1998
CONTACTThe Phoenix Educator: A LIGHT IN EVERY MIND! “YE SHALL KNOW THE TRUTH AND THE TRUTH SHALL MAKE YOU MAD!” “NOW THAT YOU’RE MAD, LET’S FIX IT!” VOLUME 21, NUMBER 5 NEWS REVIEW $ 3.00 JUNE 23, 1998 The Truth Is Out There If You Look What’s Stopping YOU? This is not meant to be a sermon, but a short gasping for air as each new lie piles upon the rest. It’s that part reflection instigated by the national release, this week, of you which instinctively KNOWS Truth and can sort it from of the X-Files movie based upon the popular television baloney. program. (Please see The Truth Is Out There If You Look, p.21) What is it that has made The X-Files so popular that it has acquired, as labeled by the ever-analyzing INSIDE THIS ISSUE media, a—oh, no—“cult” following? The answer is The News Desk, p.2 simple. Making Comparisons In A World Of Parasites, p.8 Even among the many who are seemingly asleep, Fallen Angels & Serpent People deep down the public psyche knows we-the-people have Part III: Untangling The Gordian Knot, p.12 been lied to concerning just about everything that is Soltec: Still Thyself And Hear Gods Voice Within, p.20 truly important in our lives. There is a part (called conscience) within every Lighted being which is Hidden Jewish Parasites; Zions Trojan Horse, p.22 Korton: Spotting Modern Evils Ancient Roots, p.36 CONTACT PRESORTED News Desk Special Report: P.O. Box 27800 FIRST-CLASS MAIL Religious Persecution Monitoring Las Vegas, NV 89126 U.S. -

August 5, 1966
Anti-Semitic Heckler Outshouted At Rally Carrying an anti-Semitic sign Freedom Fighters In U.S.A., Inc., reading "Communism Is Jewish Mr. Mlot-Mroz was finally escort (Zionist) From Start to Finish. ed from the parking I ot by two Smash Communism Everywhere," policemen, and drove away In a a picket at the meeting called by 1965 white Cadillac convertible. THE O NLY ENGLI SH-JE W ISH W EE KLY IN R. I. AND SOUTHEAST MASS. the Negro Leadership Conference Thirteen men, four women, a to protest de facto school segre 17-year-old girl, and a 17-year gation In South Providence on M"n old boy, all of them Negroes, were VOL. L, NO, 23 FRIDAY, AUGUST 5, 1966 !Sc Per Copy 12 Pages day night, was outshouted and sur arrested by police who moved In rounded by Negroes, who told him to disperse a chanting, rock to leave, as he attempted to heckle throwing mob who lingered In the the speakers. Willard Avenue Shopping Center Identifying himself as Jozef after the Freedom Rally. Israel's President Shazar Asks Mlot-Mroz ofSalem,Mass.,saytng The rally Itself was peaceful he was president of the Anti-Com and the crowd of approxlmotely munist Confederation of Polish 400 to 500 spectators appeared al most disinterested In the speakers. End To Organizational Rivalries Annual Jewish Service It was after the sound truck from which the rally had been staged NEW YO~K CITY -- President bavltcher movement, In the Crown started to leave the parking lot Zalmllll Shazar of Israel spoke out Heights section of Brooklyn. -

"Trauerspiele Mit Gesang Und Tanz"
Brigitte Dalinger „Trauerspiele mit Gesang und Tanz“ Zur Ästhetik und Dramaturgie jüdischer Theatertexte Böh lau Ve r lag Wi e n · Köln · We i mar Gedruckt mit der Unterstützung durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http ://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-205-77466-2 Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Über- setzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der Wiedergabe im Internet und der Speicherung in Daten - ver arbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. © 2010 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H. und Co.KG, Wien · Köln · Weimar http ://www.boehlau.at http ://www.boehlau.de Umschlaggestaltung: Judith Mullan Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier. Druck : Generaldruckerei Szeged, 6726 Szeged Inhalt Vorwort ......................................... 9 AusgAngspunkt und ZIelsetZung einführung ...................................... 13 Einleitung und Ziele .................................. 13 Definition und Abgrenzung .............................. 17 Zum Forschungsstand ................................. 20 Methode ......................................... 28 Formale Hinweise .................................. -
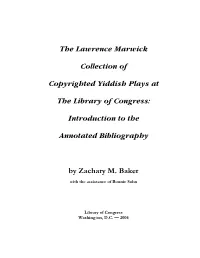
The Lawrence Marwick Collection of Copyrighted Yiddish Plays at the Library of Congress: Introduction to the Annotated Bibliography
The Lawrence Marwick Collection of Copyrighted Yiddish Plays at The Library of Congress: Introduction to the Annotated Bibliography by Zachary M. Baker with the assistance of Bonnie Sohn Library of Congress Washington, D.C. — 2004 Contents The Lawrence Marwick Collection of Copyrighted Yiddish Plays at the Library of Congress: Introduction to the Annotated Bibliography ............................................................................v Zachary M. Baker Yiddish Plays From The Lawrence Marwick Collection.......................................................................1 Index to Yiddish Titles...........................................................................................................................172 Index to Yiddish and English Titles in Roman Characters ..............................................................188 Index to Names of Persons Other Than Primary Authors ..............................................................217 Yiddish Plays from the Lawrence Marwick Collection: Introduction – iii THE LAWRENCE MARWICK COLLECTION OF COPYRIGHTED YIDDISH PLAYS AT THE LIBRARY OF CONGRESS: INTRODUCTION TO THE ANNOTATED BIBLIOGRAPHY by Zachary M. Baker Background This bibliography of one of the largest and most significant extant collections of Yiddish plays sheds light on the vibrant popular culture of Jewish immigrants to the United States. The more than 1,290 plays included here were first identified by the late Dr. Lawrence Marwick, Head of the Hebraic Section of the Library of Congress, on the basis -
9781107048201 Index.Pdf
Cambridge University Press 978-1-107-04820-1 - The Cambridge History of Jewish American Literature Edited by Hana Wirth-Nesher Index More information Index All titles beginning with articles, in English or other languages, are indexed on the word following the title. Groups/movements such as Di yunge are indexed on the article. Variations in Romanization of Hebrew and Yiddish in the index derive from the contributors’ transliterations in the essays. No attempt has been made to adopt a unifi ed transliteration standard. “ A gute nakht, velt ” (“Good Night, World”) Adler, Bruce, 239 (Glatstein), 209 – 210 , 219 – 220 Adler, Jacob, 229 , 236 , 239 “ A nakht ” (”Night”) (Halpern), 215 – 216 Adler, Morris, 238 – 239 Aarón the Jew ( El judío Aarón ) (Eichelbaum), Adler, Sara, 226 419 , 421 The Adventures of Augie March (Bellow), 99 , Abbott, George, 246 – 247 125 – 128 , 133 , 495 – 496 Abie’s Irish Rose (Nichols), 244 – 245 , 549 The Adventures of Yaakov and Isaac Abraham, Pearl, 634 (Kubert), 580 Abramovitch, Bina, 226 Af Tzelokhis Purim Brigade (theatrical Abramovitsh, Shalom (Mendele Moykher troupe), 561 – 562 Sforim), 406 , 498 Af yener zayt taykh ( On the Other Side of the Absalom! Absalom! (Faulkner), 115 River ) (Hirschbein), 232 Abstract Expressionists, 591 “The Affi nity of Poetry and Religion” Abulafi a (Kabbalist), 191 (Menken), 527 – 528 Aciman, André African American music, 96 in Alexandria, 322 African American stereotypes, 264 – 265 on diasporic adaptability, 324 African American writing, 6 , 42 , 253 exile of, 323 – 325 African -

2011–12 Annual Report If We Want the Future to Be Different from the Past, More People Must Understand the Holocaust and Care Enough To
INSPIRING ACTION2011–12 Annual Report If we want the future to be different from the past, more people must understand the Holocaust and care enough to 4 Educating New Generations 8 Rescuing the Evidence 12 Advancing Knowledge act. 16 Preventing Genocide 20 Days of Remembrance 2012 24 Regional Partners 26 International Travel Program 28 Donors 30 Remembering Eric and Lore Ross 46 Financial Statements 47 United States Holocaust Memorial Council Dear friends, Last June, we convened a student In recent years, our country’s leaders have come to the Museum to leadership summit on propaganda, address the challenges of confronting contemporary genocide. You hate speech, and civic engagement. may recall that President George W. Bush gave a speech at the Museum Sixty student leaders from 47 colleges about the situation in Darfur in 2007. This spring, after a tour of the and universities in 26 states explored Museum with Elie Wiesel, President Obama paid tribute to Holocaust how the Nazis used propaganda to survivors. In speaking about the lessons of the Holocaust, the president shape public opinion and behavior. announced the establishment of an Atrocities Prevention Board to These students left equipped with bolster our government’s ability to respond to genocide. The creation a deeper understanding of the of such a board was a recommendation of the Genocide Prevention Holocaust and inspired to create Task Force, cosponsored by the Museum. campus environments where hate cannot flourish. Mary Giardina Approaching our 20th anniversary in 2013, we are honored that in a (right) of Ohio State University was short time this Museum has assumed an important role in American particularly disturbed by Holocaust society, with growing global influence. -
Chasing Yiddishkayt: a Concerto in the Context of Klezmer Music
CHASING YIDDISHKAYT: A CONCERTO IN THE CONTEXT OF KLEZMER MUSIC A Monograph Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Musical Arts By Julia Alford-Fowler May, 2013 Committee Members: Dr. Matthew Greenbaum, Department of Music Studies, Advisor Dr. Rollo Dilworth, Department of Education Dr. Cynthia Folio, Department of Music Studies Dr. Maurice Wright, Department of Music Studies Dr. Steven Zohn, Department of Music Studies, Outside Reader © by Julia Alford-Fowler 2013 All Rights Reserved ii ABSTRACT Chasing Yiddishkayt: Music for Accordion, Klezmorim Concertino, Strings, and Percussion is a four-movement composition that combines the idioms of klezmer music with aspects of serialism. I aimed to infuse the piece with a sense of yiddishkayt: a recognizable, rooted Jewishness. In order to accomplish this goal, I based each movement on a different klezmer style. I used the improvisatory-style of the Romanian Jewish doina as the foundation for Movement 1. For Movements 2 through 4 I selected tunes from the 1927 Hoffman Manuscript–a fake-book assembled by Joseph Hoffman in Philadelphia for his son, Morris–as the starting point in my process, and also for the generation of pitch material. Each movement places the tunes in a different serialist context through the use of abstraction, manipulation and regeneration. The orchestration of the composition is designed as a modified a concerto structure that alternates between featuring the accordion and contrasting the klezmorim concertino (fiddle, clarinet, trumpet, trombone, tuba, and accordion) with the orchestra. Depending on the context, the percussion section functions as part of the concertino and the orchestra.