The Following Full Text Is a Publisher's Version
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Empowering Europe the Hague, July 2010
Conference Results Enriching the Planet – Empowering Europe The Hague, July 2010 Inhoud 1 Conference Report and Chair’s Conclusions Enriching the Planet – Empowering Europe 02 2 Clingendael Conference Paper Enriching the Planet – Empowering Europe 08 3 Conference Essays Increasing Scarcities of Natural Resources in the Coming Decades: Trends and Policy Options 24 Scarcity: a Story of linkages of Sustainability 30 A Sustainable and fair food System in the European Union 36 The Global Challenge of Mineral Scarcity 42 The Scarcity Issue: Energy, Raw Materials & the EU 50 4 Conference Programme Enriching the Planet – Empowering Europe 56 5 Conference Speeches Janez Potočnik, EU Commissioner for the Environment 60 Joke Schauvliege, Minister of Environment, Nature and Culture, Flanders, incoming Belgian EU Presidency 64 Tineke Huizinga, Minister of the Environment and Spatial Planning, the Netherlands 68 Gerda Verburg, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality, the Netherlands 70 6 Participants list Conference Enriching the Planet – Empowering Europe 74 01 1 Conference Report and Chair’s Conclusions Enriching the Planet – Empowering Europe Optimising the use of natural resources for a more sustainable economy Conference Chair: Laurens Jan Brinkhorst Rapporteurs: Louise van Schaik and Barend van Wonderen1 Key conclusions drawn under the responsibility of the Chair of the Conference held in The Hague on 26 and 27 April 2010, cf.: http://www.clingendael.nl/resourcescarcity 1 The rapporteurs would like to thank Hannah Koutstaal, Maarten lak, Gerrit Meester, Arnoud Passenier, Krijn Poppe, Jan Rood and Christine van Empel for their contributions to and review of this report. The final responsibility for the content lies with the rapporteurs and Chair of the seminar only. -

Bewerken 2008 De Bouwvakkers Van Cheops Waren Nu Heel Wat Beter Af Geweest Het Plaatsen Van Een Sterke Functio- De Meest Toegepaste Vorm Is Opslag En
9e Jaargang, nummer 4 BBEEwweerrkkeenn Kwartaalblad van de BRBS, de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren December BEwerken 2008 De bouwvakkers van Cheops waren nu heel wat beter af geweest Het plaatsen van een sterke functio- De meest toegepaste vorm is opslag En... dankzij de platte organisatie- nele opslag gaat met Constar Mega- en scheiding van grint, houtafval, structuur plaatsen we al binnen 2 Block® snel en eenvoudig. oude metalen, strooizout en mest. werkdagen na opdracht. Mega-Block® is een modulair bouw- Met Mega-Block® verzekert u zich Mega-Block® is dankzij de flexi- systeem voor wanden en keermuren, van een snelle en flexibele oplossing bliliteit ook geschikt als tijdelijke stapelbaar en vrij van indeling op te voor nagenoeg elk opslagprobleem. opslagplaats. bouwen. Constar beschikt in Nederland over Meer weten? Mega-Block® is onderhoudsarm, ver- 5 betonfabrieken. Bel (0344) 61 12 22 of surf naar plaatsbaar, voordelig in aanschaf, Vanuit de dichtsbijzijnde vestiging sterk en milieuvriendelijk. transporteren we rechtstreeks naar www.constar.nl De elementen zijn gemaakt van een de door u aangewezen locatie. voor een gedetailleerde beschrijving sterk en onderhoudsarm beton. Het lossen van de vracht betekent en alle mogelijkheden. Het systeem is breed inzetbaar. gelijktijdig het plaatsen. 3 inhoud 5 Van de voorzitter 6 Hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen stijgt 3% 7 ‘Kansen Benutten’ aangeboden aan vaste kamercommissie VROM 8 Maakt hoogwaardig hergebruik en terugwinning van energie uit sorteerresidu daadwerkelijk kans? -

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010 Colofon: Nederlandse Vrouwen Raad Benoordenhoutseweg 23 2596 BA Den Haag T: 070 3469304 F: 070 3459346 E: [email protected] www.nederlandsevrouwenraad.nl Foto omslag: Aanbieding manifest Vrouwenpodium Gerdi Verbeet, voorzitter Tweede Kamer (zie pagina 26) 2 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 5 2. Kennisinfrastructuur emancipatie: de kerntaken van de koepel 9 3. Informatievoorziening en communicatie 11 4. Netwerkfunctie 15 5. Het voeden van beleidsprocessen en de politiek 21 6. Internationale vertegenwoordiging 29 7. (Kraamkamer van) Projecten 35 7.a. Ontwikkeling projecten 35 7.b. Uitvoering projecten 41 8. De Nederlandse Vrouwen Raad 49 9. Samenvatting van de Jaarrekening 2010 53 Bijlagen: Bijlage 1 Ledenbestand 55 Bijlage 2 Samenstelling NVR-organisatie en mutaties 59 Bijlage 3 Vertegenwoordigingen 62 3 4 1. Inleiding 2010 was het eerste jaar waarin de Nederlandse Vrouwen Raad deel uitmaakt van de Kennis Infrastructuur Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op grond hiervan ontvangt de NVR structureel subsidie. Hierdoor gesteund heeft de NVR in 2010 haar werk en werkwijze krachtig voortgezet. De belangrijke netwerkfunctie van de NVR is extra ondersteund door een eenmalige subsidie, eveneens van het Ministerie van OC&W, voor de ontwikkeling van een eigentijds relatiebeheer- en kennissysteem. In 2010 zijn in de ontwikkeling van dit systeem, mede dankzij de inzet van de lidorganisaties in de levering van informatie, flinke vorderingen gemaakt. Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR in november werd (de werking van) het systeem gepresenteerd en enthousiast ontvangen. In 2011 zullen lidorganisaties het systeem zelf kunnen raadplegen en bewerken. De projecten die de NVR, samen met lidorganisaties, ontwikkelt en uitvoert zijn idealiter langlopend en/of hebben een opzet die opgeschaald kan worden, bijvoorbeeld van provinciaal naar landelijk niveau, of „herhaald‟ kan worden, bijvoorbeeld in andere regio‟s of om nog meer vrouwen te bereiken. -

International Monitoring of Compliance with Human Rights of Migrants in the Netherlands 2000-2008
WHO’S RIGHT(S)? International Monitoring of Compliance with Human Rights of Migrants in the Netherlands 2000-2008 a WHO’S RIGHT(S)? INTERNATIONAL MONITORING OF COMPLIANCE WITH HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS IN THE NETHERLANDS 2000-2008 Dominique van Dam Centre for Migration Law Nijmegen 2009 Foreword It was internationally renowned Humanist Erasmus who lay the foundation for Human Rights in the Netherlands. It is his work, which made this country a safe haven for minorities and also an important multicultural economic force in the Golden Age. And this legacy of rationale and tolerance were the basis on which The Hague’s Peace Conferences of 1899 and 1907 were held; the events where the first steps to codify international law were taken. The prominent role of the Netherlands in the promotion of Human Rights is not overstated when we take into account the exceptional position this country has chosen to take in relation to international conventions and treaties. The Netherlands, as most know, will accept international law above its own; even before ratification. It is for this reason that the Netherlands welcomes and actively cooperates with different national and international organisations and NGO’s in the examina- tion of our laws and policies against the backdrop of Human Rights. However, while this is the case, it is prudent to consider that the results of these examinations are not always as satisfactory as we would expect. In the past years NGO’s have found that the implementation of laws and policies are at odds with one or more Human Rights. The mission of FORUM, the Dutch National Knowledge Institute for Multicul- tural Affairs, is to promote social cohesion, shared citizenship and a multi- ethnic society based on the principles of the Rule of Law, Human Rights and Equality of all citizens. -

Girl Trouble the Dutch Political Reformed Party and Passive Female Suffrage 1922- Present
Girl Trouble The Dutch Political Reformed Party and passive female suffrage 1922- present Yurre Wieken, 3006239 Master Politics & Parliament Radboud University Nijmegen June 2014 0 Table of contents Section Page Introduction 2 1. The SGP and female suffrage 10 2. The SGP, theocracy and democracy 16 3. The SGP and other political parties 18 4. The SGP’s views on female passive 25 suffrage – a democratic analysis 5. Conclusion 28 6. Acknowledgements 32 1 Introduction The Dutch Political Reformed Party (Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP), is something of a relic in Dutch politics. Founded in 1918, it is the oldest Dutch political party still in existence. Amidst an irreligious society, it continues to adhere to deeply conservative Christian principles regarding abortion, euthanasia, same-sex marriage and the seperation of Church and State. For instance, it insists that the Dutch government has a responsibility to take political action against ‘false religions’ and ‘godlessness’1. The SGP has maintained its principles in the face of an increasingly secularized society which has seen its peers, the Christian Democratic Appeal (CDA) and the Christian Union (CU), take on more pragmatic approaches now that matters such as abortion and euthanasia are a fact of life2. The SGP’s position on passive voting rights for women has been a hot topic for decades – not the position itself, which is the SGP’s democratic right to have and voice, but its internal party regulations that naturally flow from this position. For a long time, women were not allowed to join the SGP as members. When they finally were allowed to do so in 2006, after legal action threatened to end the party’s government subsidies, they were still not allowed to hold or run for political office. -

Binnenvaart Twijfelt Aan CBS-Cijfers
121e jaargang nummer 28 Zaterdag 11 juli 2009 losse nummers 3,10 euro Duitsland: 3,80 euro Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart Schippers en binnen- CBS: ‘Omzet binnenvaart daalt zeventien procent’ vaartorganisaties zijn ver- 6 Halve Chinees is strakker Meest gelezen DEZE WEEK dan een hele ontwaardigd over de om- op Schuttevaer.nl inclusief special zetcijfers die het Centraal 7 Sneller afl aden bij Geluk Scheepsbouw & Offshore in Cuijck 1) Open brief aan de binnenvaart Bureau voor de Statistiek Binnenvaart twijfelt 2) Ponton met bakken strandt 2 Bruggen Zeekanaal centraal 9 Tent vereenvoudigt 3) Twee jaar langer aflossen (CBS) begin deze week bediend vanuit Willebroek onderwaterreparatie 4) Nieuwe geoptimaliseerde naar buiten bracht. Vol- Bontekoe te koop 3 Kwart miljoen voor 11 Fonds om sloopschepen van 5) Eerste binnenvaartschip gens het CBS daalde de Crisisberaad ‘zwarte stranden’ te houden op aardgas omzet in de binnenvaart aan CBS-cijfers 5 Gekoppeld varen 23 Kamperzand is in de eerste drie maan- spaart tonnen gasolie voorstander van CAB Aantal bekeken pagina’s: 93.975 den van dit jaar met zeventien procent waren gedaald, dan hadden we nu een dipje in de ruim zeventien procent. binnenvaart. Dat had niet tot de ri- De binnenvaarbranche goureuze problemen geleid waarmee we nu hebben te kampen. Vooral in spreekt zelf over omzet- de droge lading zijn de omzetten dalingen van minstens zeker veertig tot vijftig procent gedaald. Dat kunnen wij aantonen. veertig tot vijftig procent. Misschien dat de cijfers uit de tank- vaart de cijfers van het CBS hebben beïnvloed? De tankvaart deed het de Hoe snel de economische crisis toe- eerste drie maanden nog beter dan sloeg, blijkt uit de cijfers van vorig de droge lading.’ jaar. -

Speech from the Throne’ Outlines Plans for the Future
Reports online: www.unitedinternationalpress.com THE NETHERLANDS Queen’s ‘Speech from the Throne’ Outlines Plans for the Future Beatrix Wilhelmina Armgard (born January 31, 1938) has been queen of the Kingdom of the Netherlands since April 1980, when her mother, Queen Juliana, abdicated. As queen, Beatrix has more power than most other reigning monarchs in Europe. While local government is handled by elected offi cials, the queen plays a key role in the country’s international relations and serves as an offi cial spokesperson for the country. The queen gives the ‘Speech from the Throne’ every year in September in an event called ‘Prinsjesdag’, during which she speaks to parliament in the Ridderzaal at the Binnenhof in The Hague. The ‘Speech from the Throne’ sets out the government’s plans for the coming year. In last year’s speech, the queen referred to the global fi nancial crisis and its impact on the Netherlands. She said, “The times we are living in demand determination and a willingness to change. The global fi nancial and economic crisis has hit countries hard, including the Netherlands. The consequences will be felt for a long time to come…. The government's ambition is to turn uncertainty into recovery. The changes required can strengthen the Netherlands economically and socially. We have much to offer our country and one another by standing together and holding fast to the tradition of freedom, responsible citizenship and active European and international engagement.” The queen pointed out that the government had submitted a ‘Crisis and Recovery’ bill aimed at accelerating procedures for infrastructure projects. -

De Personages in Het Boek 'Helpende Hackers'
De personages in het boek ‘Helpende hackers’ De respondenten in dit onderzoek zijn veelal live geïnterviewd, maar soms ook via Skype, telefoon of e-mail. Al deze personen hebben ook de teksten waarin ze voor komen van commentaar voorzien. Hun functietitel is die uit de periode waarin de casestudie speelde. Daar waar het relevant is, staat hun huidige positie erbij. De politici die geciteerd zijn uit Kamerstukken, staan hier ook vermeld. Personages die geciteerd zijn uit andere bronnen, staan alleen in de hoofdstukken. Respondenten • 0xDUDE, @0xDUDE, ethisch hacker en Victor, ambtenaar bij een ICT-dienstverlener binnen de Rijksoverheid • Bas Anneveld, @basanneveld, Manager Site Operations Marktplaats • Maarten Baaij, directeur Financiën en ICT van het Groene Hart Ziekenhuis • Jaya Baloo, Chief Information Security Officer KPN • Vincent Beerends, countrymanager bij Sulake, het bedrijf achter Habbo Hotel • Olivier Beg, @smiegles, ethisch hacker en mbo-scholier • Yvon van den Berg, manager Relatiemanagement, Marketing & Communicatie bij Diagnostiek voor U • Joost Blokzijl, @jblokzijl, redacteur bij het tv-programma EenVandaag • Frank Brokken, Security Manager van de Rijksuniversiteit Groningen • Ralf Dennissen, PR-manager Volkswagen • Peter van Dijk, directeur Mcomm • Beau van Doorn, Habbo helpdeskmedewerkster • Wouter van Dongen, ethisch hacker en eigenaar Dong-IT • David van Es, student Information Security Management aan de Haagse Hogeschool • Mischa van Geelen, @rickgeex, ethisch hacker • Peter Geissler, ethisch hacker @bl4sty en medeoprichter -

The Representation of Climate Change Politics in the Dutch Newspaper ‘De Volkskrant’ Between 2008 and May 2018
The representation of climate change politics in the Dutch newspaper ‘De Volkskrant’ between 2008 and May 2018 Name: Laura Hilhorst Student number: 10995951 Study: Bachelor Future Planet Studies; major Human Geography Study year: 2017/2018 Course: Bachelor Thesis Project Project: Representation of climate change politics in ‘De Volkskrant’ Supervisor: Patrick Weir (second reader: Aslan Zorlu) Date: June 18, 2018 Word count: 13,560 E-mail: [email protected] Abstract In this research the representation of climate change politics in the Dutch newspaper De Volkskrant has been studied. Through scientific journalism, news media serve as a place where public opinion on climate change is formed, which then influences the political agenda regarding climate change. A qualitative content analysis has been carried out to to find out if there is a pattern of climate change representations in the newspaper between January 2008 and May 2018. There is focused on predominant climate change politics representations, human actors, journalistic norms, and climate change representations. Change politics was predominantly represented as international CO2 mitigation strategies, giving preference to mitigation (undoing the effects) of rather than adaptation to climate change (providing assistance). Most predominant actors included (foreign) politics (primarily presidents and ministers), intergovernmental organizations (EU and UN), and environmental organizations (Greenpeace and Milieudefensie). Journalists reporting climate change politics in De Volkskrant mainly used the norm ‘novelty’; journalists prefer new stories over stories that have already been reported. Last, climate change was predominantly represented as a problem in general, journalists and politicians often used wording like ‘climate crisis’ and ‘saving the climate’. However, media representations of climate change also showed to be subject to the uncertainties and ontology of science itself. -

1 Vrouwen & Macht : Een Paar Apart
MACHIAVELLILEZING door Cisca Dresselhuys Vrouwen & macht : een paar apart Jaren geleden interviewde ik Jaap de Hoop Scheffer, toenmalig CDA-fractieleider in de Tweede Kamer. Het gesprek werd gehouden in de zomer van 1997, op het terras van een Brabants cafe. We zaten daar omdat de Hoop Scheffer ergens in de Peel op vakantie was en het dus wel zo gemakkelijk was dat ik naar hem toe kwam. Vanwege de vakantie- en de plaats van samenkomst- was er geen voorlichter, woordvoerder of andere spindoctor aanwezig bij het interview- dus we spraken ongehinderd voort. Dat werd anders bij de autorisatie van het verhaal. Opeens kreeg ik te maken met Jack de Vries, tegenwoordig staatssecretaris van defensie, toen voorlichter van het CDA. Ondanks het feit, dat hij niet bij het gesprek aanwezig was geweest, faxte hij me een lijst met wijzigingen van ongeveer een strekkende meter lang. Dat werden dus veel telefoontjes over en weer, waarbij mijn bloeddruk gevaarlijke hoogten aannam. Ik herinner me vooral het meest pijnlijke punt: de slotregels van het verhaal, waarin de rooms-katholieke De Hoop Scheffer het verschil tussen de protestantse en katholieke bloedgroep van het CDA probeerde uit te leggen. Rooms-katholieken waren veel vrolijker, dat zag je alleen al aan het feit, dat die zondags na de mis een biertje pakten in het cafe, terwijl protestanten na de preek thuis gingen koffiedrinken. Dat biertje moest er per se uit, betoogde Jack de Vries. Ik begreep er niets van: hoezo? Wat was er mis met die aardige vergelijking? Dat ik dat niet begreep, dat zou heel veel kwaad bloed kunnen zetten bij CDA-stemmers, zei De Vries. -
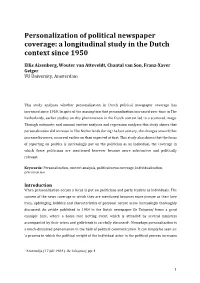
Personalization of Political Newspaper Coverage: a Longitudinal Study in the Dutch Context Since 1950
Personalization of political newspaper coverage: a longitudinal study in the Dutch context since 1950 Ellis Aizenberg, Wouter van Atteveldt, Chantal van Son, Franz-Xaver Geiger VU University, Amsterdam This study analyses whether personalization in Dutch political newspaper coverage has increased since 1950. In spite of the assumption that personalization increased over time in The Netherlands, earlier studies on this phenomenon in the Dutch context led to a scattered image. Through automatic and manual content analyses and regression analyses this study shows that personalization did increase in The Netherlands during the last century, the changes toward that increase however, occurred earlier on than expected at first. This study also shows that the focus of reporting on politics is increasingly put on the politician as an individual, the coverage in which these politicians are mentioned however became more substantive and politically relevant. Keywords: Personalization, content analysis, political news coverage, individualization, privatization Introduction When personalization occurs a focus is put on politicians and party leaders as individuals. The context of the news coverage in which they are mentioned becomes more private as their love lives, upbringing, hobbies and characteristics of personal nature seem increasingly thoroughly discussed. An article published in 1984 in the Dutch newspaper De Telegraaf forms a good example here, where a horse race betting event, which is attended by several ministers accompanied by their wives and girlfriends is carefully discussed1. Nowadays personalization is a much-discussed phenomenon in the field of political communication. It can simply be seen as: ‘a process in which the political weight of the individual actor in the political process increases 1 Ererondje (17 juli 1984). -

Boek Over Totstandkoming Kabinet-Balkenende IV
Het kabinet Balkenende IV werken COALITIEAKKOORD, SAMEN REGERINGSVERKLARING, BEWINDSPERSONEN, FORMATIEVERLOOP samen LE VEN Het kabinet Balkenende IV werken COALITIEAKKOORD, SAMEN REGERINGSVERKLARING, BEWINDSPERSONEN, FORMATIEVERLOOP samen LE VEN ©2007 Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag Foto’s omslag: © RVD Den Haag Vormgeving en druk: Koninklijke De Swart Foto’s: © RVD, ANP: Cynthia Boll (blz. 120), Evert-Jan Daniëls (blz. 110, 13), Rob Keeris (blz. 108), Olaf Kraak (blz. 118), Robin Utrecht (blz. 10) en Robert Vos (blz. 66) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en drukker deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. While every effort has been made tot ensure the reliability of the information presentend in this publication, Koninklijke De Swart neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences. De officiële documenten behorende bij de kabinetsformatie, zoals Coalitieakkoord, Regeringsverklaring en verslagen van de (in)formateur(s) aan de Koningin, kunt u ook terugvinden via www.regering.nl en www.kabinetsformatie20062007.nl Koninklijke De Swart Thieme GrafiMedia Groep Kobaltstraat 27 Postbus 5318 2505 AD Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord 7 Coalitieakkoord 9 Regeringsverklaring 65 CV’s Ministers 77 CV’s Staatssecretarissen 95 Formatieverloop 109 Informatieopdracht Hoekstra 111 Eindverslag Hoekstra 112 Informatieopdracht Wijffels 119 Eindverslag Wijffels 121 Formatieopdracht Balkenende 123 Eindverslag Balkenende 125 Portefeuilles kabinet 128 5 6 Voorwoord ‘Samen werken, samen leven’. Dat is het motto van het kabinet dat op 22 februari 2007 door de Koningin werd beëdigd.