Also in Mainz – Tätig Waren
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Als Die Bücher in Der Wiege Lagen Von Den Anfängen Des Buchdrucks Ausgewählte Inkunabeln Aus Konstanzer Einrichtungen Im Bildungsturm
ALS DIE BÜCHER IN DER WIEGE LAGEN VON DEN ANFÄNGEN DES BUCHDRUCKS AUSGEWÄHLTE INKUNABELN AUS KONSTANZER EINRICHTUNGEN IM BILDUNGSTURM grenzenlos denken ALS DIE BÜCHER IN DER WIEGE LAGEN AUSSTELLUNG IM BILDUNGSTURM DER STADT KONSTANZ VOM 24.10. BIS 13.12.2009 IM Rahmen des „Jahres der Wissenschaft 2009“ unter dem Motto „grenzenlos denken“ und „Deutschland liest, TreffPunkt Bibliothek“ ALS DIE BÜCHER IN DER WIEGE LAGEN VON DEN ANFÄNGEN DES BUCHDRUCKS Amt für Schulen, Bildung und Wissenschaft der Stadt Konstanz. IN Zusammenarbeit mit der Bibliothek der Universität Konstanz und der Wessenberg-Bibliothek, der Bibliothek des Heinrich-Suso-GYmnasiums, dem Rosgartenmuseum Konstanz und dem Stadtarchiv Konstanz. Beiträge und Redaktion: Helmut von Bohr (hvb), Katharina Kirr (kk), Anja Rehlen (ar), Ulrich Zeller (uz) Mitarbeiter: Michael Kuthe (mk), DR. Peter ChristoPH Wagner (Pcw) Illustrationen: Sandra Merten KonzePtion und Kreation: Barbara Füssinger und Karen Merkel, Büro für Kommunikationsdesign Druck: Zabel-Druck, Radolfzell 1. Aufl. in 1.500 EXemPlaren – 2009 ISBN 978-3-00-029190-6 INHALTE KAPITELÜBERSICHT EINLEITUNG KAPITEL 01 Die beteiligten Institutionen UND ihre Inkunabelbestände 14 KAPITEL 05 Konstanzer Drucker- und Buchbinderwerkstätten 50 Das Rosgartenmuseum Konstanz 14 Der Drucker des Remigius – Heinrich Jan 50 DAS STADTARCHIV KONSTANZ 16 Ulrich Gering 54 Die Bibliothek des Heinrich-Suso-GYmnasiums 18 Paul Hurus 56 Die Wessenberg-Bibliothek 20 Buchbinderwerkstätten 62 Die Bibliothek der Universität Konstanz 22 KAPITEL 06 Die Zainer – eine süddeutsche Druckerfamilie 68 KAPITEL 02 Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 24 Günther und Johann Zainer in Augsburg und Ulm 68 Voraussetzungen 26 ERZEUGNISSE DER ZAINER-WERKSTATT 72 Der Erfinder – Johannes Gutenberg 28 KAPITEL 07 Ausgewählte Inkunabeln 84 Die Erfindung 30 KAPITEL 03 Handschrift und gedrucktes Buch im Vergleich 32 LITERATURVERZEICHNIS RÖmischer Psalter, Konstanzer Brevier und Missale 32 Liber seXtus VON Bonifatius VIII. -

The Printing Revolution in Europe, 1455-1500 Author Index 1
Incunabula: The Printing Revolution in Europe, 1455-1500 Author Index Aaron Hakohen. Abraham ibn Ezra. Orhot Hayyim. Perush ha-Torah. [Spain or Portugal: Printer of Alfasi's Halakhot. [before Naples: Joseph ben Jacob Ashkenazi Gunzenhauser and his 1492?] son [Azriel]. 2 May 1488 ia00000500: GW 486; Offenberg 2; Thesaurus Tipog. ia00009300: H 23; Fava & Bresciano 262; Sander 4; IGI 6 = Hebraicae B37. VI E2; IDL 2448; Sajó-Soltész 1; Voulliéme, Berlin 3178; Fiche: IH 52 Ohly-Sack 4; Madsen 2; Proctor 6729; Cowley p.14; De Rossi (p.58) 21; Encyclopaedia Judaica 122; Freimann p.115; Abbey of the Holy Ghost. Freimann, Frankfurt 1; Goldstein 52; HSTC 73; Jacobs 53; Westminster: Wynkyn de Worde. [about 1497] Marx 1; Offenberg 56; Offenberg, Rosenthal 13; Schwab 46; ia00001500: Duff 1; H 19; STC 13609; Oates 4142; Proctor Steinschneider, Bodley 4221(1); Thesaurus Tipog. Hebraicae 9721; GW 1; Fac: ed. F. Jenkinson, Cambridge, 1907. A60; Wach II 158; Zedner p.22; GW 114. Fiche: EN 129 Fiche: IH 1 Abiosus, Johannes Baptista. Abrégé de la destruction de Troie. Dialogus in astrologiae defensionem cum vaticinio a Paris: Michel Le Noir. 1500 diluvio ad annos 1702. With additions by Domicus Palladius ia00009700: CIBN A-4, GW 119. Soranus. Fiche: RM 78 Venice: Franciscus Lapicida. 20 Oct. 1494 ia00008000: H 24*; GfT 2207; Klebs 1.1; Pellechet 17; CIBN Abstemius, Laurentius. A-2; IGI 2; IBP 1; IBE 2; Essling 756; Sander 1; Walsh Fabulae (Ed: Domicus Palladius Soranus). Aded: Aesopus: 2626A; Sheppard 4581; Proctor 5543; BSB-Ink A-2; GW 6. Fabulae (Tr: Laurentius Valla). -

01 Introduction Gr.Pdf
CATALOGUE INCUNABULORUM QUAE IN BIBLIOTHECIS PUBLICIS HUNGARIAE ASSERVANTUR CATALOGUS INCUNABULORUM QUAE IN BIBLIOTHECIS PUBLICIS HUNGARIAE ASSERVANTUR EDIDERUNT GÉZA SAJÓ et ERZSÉBET SOLTÉSZ IN COLLIGENDA MATERIA ET 1DENTIFICANDIS INCUNABUL1S SOC1I FUERUNT CSABA CSAPODI et MIKLÓS VÉRTESY VOLUMEN I. 8 IN AEDIBUS ACADEMIAE SCIENTIAKUM HüNGARICAE BUDAPESTI NT. MCMLXX CURAVERUNT GEDEON BORSA ET LÁSZLÓ MEZEI ......,\ r rar;'^ S7fí Akadémiai Kiadó, Budapest 1970 Printed in Hungary INTRODUCTION* The first union catalogue of incunabula in Hungary contains listings of 7107 copies of the earliest printed books in 56 libraries and other institutions. More than half of this stock is shared by the three biggest libraries of Budapest, viz. the National Szé- (j'héiiyi Library (1748), the Library of the Hungarian Academy of Sciences (1159), and the University Library, Budapest (1035). In the provinces, the collection of incunabula housed in the Li- brary of the Kalocsa Cathedral and that in the Episcopal Library of Székesfehérvár follow in order of magnitude, possessing over 500 copies each. The Library of the Esztergom Cathedral is known to contain 290 copies, the Library of the Abbey of Pannonhalma 236, and the Simor Library of Esztergom has 232 copies in its possession. The Library of the Episcopal Semi- nary of Győr possesses approximately 200, and the former Fran- ciscan Library of Gyöngyös, in the custody of the National Széchényi Library, has preserved about the same number of incunabula. The Great Library of the Transtibiscan Reformed Church District of Debrecen contains 145, paid the Diocesan Li- brary of Szombathely has 102 fifteenth-century printed books in its possession. Nearly 700 incunabula of the national holdings are shared to different degrees by 44 other libraries and institutions. -
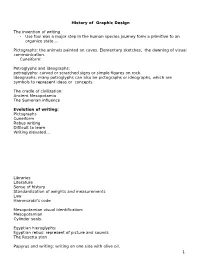
History of Graphic Design the Invention of Writing • Use Tool Was A
History of Graphic Design The invention of writing • Use tool was a major step in the human species journey form a primitive to an organize state…. Pictographs: the animals painted on caves. Elementary sketches, the dawning of visual communication. Cuneiform: Petroglyphs and ideographs: petroglyphs: carved or scratched signs or simple figures on rock. Ideographs: many petroglyphs can also be pictographs or ideographs, which are symbols to represent ideas or concepts. The cradle of civilization: Ancient Mesopotamia The Sumerian influence Evolution of writing: Pictographs Cuneiform Rebus writing Difficult to learn Writing elevated… Libraries Literature Sense of history Standardization of weights and measurements Law Hammurabi’s code Mesopotamian visual identification: Mesopotamian Cylinder seals. Egyptian hieroglyphs: Egyptian rebus: represent of picture and sounds The Rosetta ston Papyrus and writing: writing on one side with olive oil. 1 Major step in visual communication Scribes Illustrated manuscripts: Egyptians also combined words and pictures to communicate information Egyptian visual identification: Scarabs Conclusion: 3000 years chapter 2 The alphabet: a set of visual symbols of characters used to represent the elementary sounds of a spoken language. North Semitic alphabet: Semite: a member of a number of people of ancient SW Asian including akkadians, Phoenicians, Hebrews and Arabs. Semitic refers to the language family… Aramaic alphabet: origin from syria First used by the tribes from Aram Become d Dominant in the near East Predecessor to modern Arabic and Hebrew. Hebrew and Arabic languages: Square Hebrews to Modern Hebrew kufic Naskhi Aramic and India The Greek alphabet: Greek civilization King Cadmus of Phoenicia Votive stela Boustrophedon: reading left to right, right to left. -

Early Printed Books
"IKi DIES to;; .^ Ex Libris W. P. M. KENNEDY (a/Ha. jfo?vtM*r ^ «G« p *£ • Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/earlyprintedbooOOduff eigiftimutiflumpf IirtPijPpmWmtuu Dnmnoftrufu»ttrc0 r&pnuisatirnmus* un acctpta Ijabras tt bnoiraS'ljciD^na- bee inu^nrra-tjrc fanrta^ famnna il= ubata,Inpiui8 out ttbi otau^io fctfia ma faucta bat^Um^iaiHtirat- mftoUire^aDunare-i rrgt Otftttietoto rcfc terras/Una ru famfomo $ap no* ftrojM rrge uro- jMautt&ite noftm ' ( p\ omite oz^JtDjris-at^batbJlttt ct ajjoftdite- ftUti tultante. 6mmto tine fatnubra famulas$ jJtuarii- B- %ir fit mrmonauiuoii- „ otm rircuaftaml quoi? tibi fibre rogtii tatfttt nota fcuorii pzo quite nbi offm muo-uri nut nbt offmlt bor rarrifinum FROM SCHOEFFER'S CANON OF THE MASS Early Printed Books By E. Gordon Duff London Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. MDCCCXCIII THE To 15 % TO THE MEMORY OF HENRY BRADSHA W a7To9av<s)V en \a\ti a 2 Preface In the following pages I have endeavoured to give a short account of the introduction of printing into the principal countries and towns of Europe, and to bring our information on the subject as far as possible up to date. Small books on large subjects are for the most part both superficial and imperfect, and I am afraid the present book forms no exception to this rule, but my excuse must be that I have attempted rather to draw attention to more out of the way information than to recapitulate what is already to be found in the majority of bibliographical books. -

De Gulden Passer. Jaargang 20
De Gulden Passer. Jaargang 20 bron De Gulden Passer. Jaargang 20. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1942 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_gul005194201_01/colofon.php © 2015 dbnl i.s.m. 1 [De Gulden Passer 1942] [Nummer 1-2] De boekencensuur Historisch overzicht Door boekencensuur verstaat men het onderzoek waaraan de geestelijke of wereldlijke overheid dikwijls de geschriften en prenten van allerlei aard onderwerpt, vooraleer toelating te geven tot hunne uitgave of verspreiding. Zóó opgevat, krijgt zij den naam van preventieve censuur. Wanneer, om een gewisse oorzaak, dit voorafgaand onderzoek niet plaats grijpt, en één dezer twee overheden het lezen of verspreiden van een reeds verschenen uitgave verbiedt, dan spreekt men van repressieve censuur. Wanneer de maatregel (voorafgaand onderzoek of verbod) uitgaat van de geestelijke overheid of van de wereldlijke macht, zoo wordt dan gesproken, in het eerste geval, van geestelijke censuur, in het tweede geval, van wereldlijke, staats- of ook politieke censuur. Bevatte het werk, na onderzoek, niets verdachts of laakbaars, zoo kreeg de auteur dan toelating om het te doen drukken en verspreiden. Deze toelating werd in het gekeurde boek geplaatst en heette goedkeuring, in 't latijn approbatio; soms vindt men de uitdrukking: toelating tot drukken; thans spreekt men van imprimatur. De formule van goedkeuring was niet gestereotypeerd, en tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw, laschtten zekere censors er dan ook werkelijke lofbetuigingen in, terwijl zij meteen de geloovigen het lezen van het boek vurig aanbevolen. Op onze dagen is deze formule meestal zeer kort, ja lakoniek: imprimatur, imprimi potest. In bijna iederen tekst van approbatie vindt men twee bestanddeelen, t.w.: den naam van den censor of van den persoon die zijn toelating gaf, en het jaartal waarop deze laatste gegeven werd. -

A Guide to the Exhibition in the King's Library Illustrating the History Of
THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES British Museum A GUIDE TO THE EXHIBITION IN THE KING'S LIBRARY ILLUSTRATING THE HISTORY OF PRINTING, MUSIC-PRINTING AND BOOKBINDING PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES 1913 Price Sixpence. A GUIDE TO THE EXHIBITION IN THE KING'S LIBRARY British Museum A GUIDE TO THE EXHIBITION IN THE KING'S LIBRARY ILLUSTRATING THE HISTORY OF PRINTING, MUSIC-PRINTING AND BOOKBINDING PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES 1913 Art Library INTRODUCTION THE Library of Printed Books consists of over three million volumes, acquired partly under the provisions of the Copyright Act, which give the Trustees of the British Museum a right to a copy of every book published in the United Kingdom, partly by purchase, and partly by donation or bequest. Among the most important collections which have been presented or be- queathed are : the printed books of Sir Hans Sloane, forming part of his private museum, the offer of which to the nation, at about one-fourth of its value, brought about the Act of Parliament of the British Museum the 1753, constituting ; printed books in the Old Royal Library presented by George u. in 1757, containing books collected by English Sovereigns from the time of Henry vii. the Thomason Civil Tracts ; War purchased in. and in the rare by George presented 1762 ; books, including many fine specimens of binding, bequeathed by the Rev. C. M. Cracherode in 1799; the library of Sir Joseph Banks, consisting principally of works on natural history, received 5 827827 6 INTRODUCTION in 1820; the magnificent library formed by King George in., and presented to the Museum by his successor, in accordance with an arrangement with the Treasury, in 1823; and the choice collection bequeathed by the Right Hon. -

A Könyves Kultúra XIV-XVII
A könyves kultúra XIV-XVII. század I. Válogatás az angolszász szakirodalomból TARTALOM Előszó Rouse, Richard H. - Rouse, Mary A. A könyvkereskedelem a párizsi egyetemen a XIII. század második és a XIV. század első felében Eisenstein, Elisabeth L. A felnemismert forradalom Hirsch, Rudolf Nyomdászok és könyvnyomtatás Lowry, Martin Álmodozás egy Akadémiáról Waller, A. R. A könyvnyomtatás kezdetei Angliában és a korai nyomdatermékek Bennett, H. S. Caxton és irodalmi öröksége Bennett, H. S. A nyomdászok Bennett, H. S. A könyvszakma szabályozása Waller, A. R. A könyvszakma, 1557-1625 Mackinnon, Frank Jegyzetek az angol szerzői jog (copyright) történetéről Bennett, H. S. Írástudás Az angol Biblia Steinberg, S. H. Anyanyelvű nyomtatás Steinberg, S. H. Korai bestsellerek Eisenstein, Elizabeth L. Evangéliumi igazságok új formában: a nyomtatott Vulgata Humpreys, K. W. A könyv és a könyvtár szerepe a társadalomban 2 Előszó A művelődéstörténet a hazai felsőoktatásban egyre nagyobb teret követel magának. Jogosan, hiszen azok a törekvések, amelyek a szakmai képzés mellett világnézeti nevelést is meg akartak/akarnak valósítani az intézményekben, azt eredményezték, hogy a szakmai képzésből kiszorított történetiség nem az úgynevezett általános tárgyak közé került, hanem elveszett az oktatás számára (lásd például egy természettudományt oktató tanár, egy könyvtáros, vagy éppen egy irodalmat tanító szaktanár képzését). Több egyetemünkön - más-más arculattal - már működik művelődéstörténet tanszék, de a legtöbb helyen még csupán egyes szakok mellé telepített speciális ismereteket nyújtó képzésformaként kezelik. A szegedi felsőoktatási intézményekben, s hangsúlyosan is a József Attila Tudományegye- temen, illetve a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ma már hagyományosnak mondhatóan erősen művelődéstörténet-orientált oktatás folyik több szakon is. Paradox módon ezeken a helyeken nem kapott tanszéket ez a diszciplina. -

Proquest Dissertations
110 UNIVERSITY DOTTAWA ~ ECOLE DES GRADUES ROBERT COPLAND'S KYNGE APPOLYN OF THYRE by Hubert J.Spekkens Thesis presented to the Faculty of -Arts of the University of Ottawa through the Department of English as partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 1-hilQ^ephyV^-^ UBRARteS .» '*K 0^ ^S/ty oi Ottawa, Canada, 1966 UNIVERSITY OF OTTAWA ~ SCHOOL OF GRADUATE STUDIES UMI Number: DC53715 INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI UMI Microform DC53715 Copyright 2011 by ProQuest LLC All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 UNIVERSITY DOTTAWA ECOLE DES GRADUES CURRICULUM VITAE Name: Hubert J". Spekkens Born: 13 July, 1940 Maastricht, Limburg, Netherlands BA: University of Ottawa, May 1961 Hon.BA (English): U. of Ottawa, May 1962 MA (English): U. of Ottawa, May 1963 Benigne lector: Ignoscas aliquot erroribus vel machinae vel calami I UNIVERSITY OF OTTAWA SCHOOL OF GRADUATE STUDIES UNIVERSITY D-OTTAWA ~ ECOLE DES GRADUES TABLE OF CONTENTS Chapter page I.-THE STORY vi II.-THE LATIN TEST xviii III.-THE OLD FRENCH VERSIONS xlii IV.-THE PRINTING REVOLUTION lxvi V.-ROBERT COPLAND'S KYNGE APPOLYN xciii BIBLIOGRAPHY cxi EDITORIAL PRACTICE cxxvii THE TEXT OF Kynge Appolyn of Thyre .. -

The Sacrifice of Isaac Is a Topos That Has Occupied Theologians
© 2014 Sylvia Lissner Irwin ALL RIGHTS RESERVED THE SACRIFICE OF ISAAC IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN GERMAN AND YIDDISH WORKS By SYLVIA LISSNER IRWIN A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, the State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in German written under the direction of Marlene Ciklamini and approved by ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ New Brunswick, N.J. May, 2014 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Sacrifice of Isaac In Medieval and Early Modern German and Yiddish Works By Sylvia Lissner Irwin Dissertation Director: Marlene Ciklamini In my dissertation I investigate the Biblical story of the Sacrifice of Isaac as portrayed by six authors, writing in the German or Yiddish vernacular. These vernacular texts include two medieval German plays, Der Sündenfall by Arnold Immessen, and the Heidelberger Passionsspiel; two plays by the Reformation author, Hans Sachs, Tragedia mit neun Person zu agirn. Die Opferung Isaac. Hat 3 actus and his Tragedia. Der Abraham, Lott sampt der opfferung Isaac, hat 21 person und 7 actus, and Sachs's Meistersang, Der ertz-Patriarch Abraham mit der opferung Isaac, ein figur Jesu Christi; the Reformation play Drey liebliche nützliche Historien der dreier Erzveter und Patriarchen Abrahams, Isaacs und Jacobs, aus dem Ersten buch Mosi, in Deudsche reim verfasset durch Joachimum Greff von Zwickaw, zu spielen und zu lessen tröstlich. Wittemberg 1540 by Joachim Greff; and two Yiddish texts of the Early Modern period, Shira fun Yitzkhak and Akêdass Yizhak. In addition to a literary analysis of these works, I examine the Christian texts' use of religious and literary typology, as well as their respective inclusion of Catholic, Protestant and Jewish exegesis in their depiction of the Sacrifice of ii Isaac. -
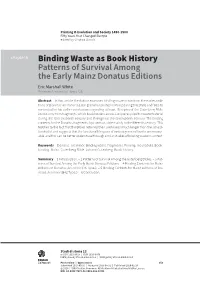
Binding Waste As Book History Patterns of Survival Among the Early Mainz Donatus Editions Eric Marshall White Princeton University Library, US
Printing R-Evolution and Society 1450-1500 Fifty Years that Changed Europe edited by Cristina Dondi chapter 6 Binding Waste as Book History Patterns of Survival Among the Early Mainz Donatus Editions Eric Marshall White Princeton University Library, US Abstract In this article the Author examines binding waste made from the earliest edi- tions of Donatus’ Ars minor (a Latin grammar printed in Mainz during the 1450s and ’60s) to contextualize his earlier conclusions regarding at least 15 copies of the Gutenberg Bible known only from fragments, which bookbinders across Europe recycled for waste material during the later sixteenth century and throughout the seventeenth century. The binding contexts for the Donatus fragments, by contrast, date mainly to the fifteenth century. This testifies to the fact that the Bibles retained their usefulness much longer than the school- books did, and suggests that the functional life spans of various genres of books are measur- able, and this can be better understood through similar studies of binding waste in context. Keywords Donatus. Ars minor. Binding waste. Fragments. Printing. Incunabula. Book- binding. Mainz. Gutenberg Bible. Johann Gutenberg. Book history. Summary 1 Introduction. – 2 Patterns of Survival Among the Gutenberg Bibles. – 3 Pat- terns of Survival Among the Early Mainz Donatus Editions. – 4 Binding Contexts for Mainz editions of Donatus, Ars minor (DK Types). – 5 Binding Contexts for Mainz editions of Do- natus, Ars minor (B42 Types). – 6 Conclusion. Studi di storia 13 e-ISSN 2610-9433 | ISSN 2610-8879 ISBN [ebook] 978-88-6969-332-8 | ISBN [print] 978-88-6969-333-5 Edizioni Ca’Foscari Peer review | Open access 253 Submitted 2019-05-16 | Accepted 2019-08-31 | Published 2020-02-24 © 2020 | cb Creative Commons Attribution 4.0 International Public License DOI 10.30687/978-88-6969-332-8/006 Eric Marshall White 6 • Binding Waste as Book History Dedicated to Stephen Ferguson, who has brought so much book history to Princeton University. -

The Printed Books of Hours of Thielman Kerver: Exploring Printer, Shop, Community and Book
The printed books of hours of Thielman Kerver: exploring printer, shop, community and book. A Senior Honors Thesis in the Department of Art and Art History Anna Majeski i Table of Contents: Introduction 3 Chapter 1 15 1.1 Thielman Kerver and his origins 18 1.2 Kerver and his world 20 1.3 Kerver and his associates 25 1.4 Conclusion 31 Chapter 2 37 2.1 Kerver’s production 39 2.2 Design of illustrations 48 2.3 Conclusion 60 Chapter 3 74 3.1 The border and the page 77 3.2 The Biblical typologies 81 3.3 Kerver’s Apocalypse borders 91 3.4 Conclusion 104 Conclusion 115 Bibliography 120 ii Introduction: I discovered the books of hours of Thielman Kerver through my research on a group of manuscript and print fragments in Tisch Library’s Special Collections. In a collection of uncatalogued, unidentified fragments, I found a printed folio from one of Kerver’s books of hours, although I did not know its maker or provenance. (Figure 1.1) The layout of the folio was similar to contemporary manuscript books of hours. The devotional text at center was framed with elaborate, printed borders. In the lateral borders on each side were three stacked images forming a typological trio: one image from the New Testament at the center, and two images from the Old Testament to the top and bottom. Each image was identified by texts from the Bible, in the bas-de-page these texts were framed on either side by images of prophets. Appropriating the format of the traditional author portrait, these figures authenticated the text and images.