Stimmige Kunst
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Constructing the Archive: an Annotated Catalogue of the Deon Van Der Walt
(De)constructing the archive: An annotated catalogue of the Deon van der Walt Collection in the NMMU Library Frederick Jacobus Buys January 2014 Submitted in partial fulfilment for the degree of Master of Music (Performing Arts) at the Nelson Mandela Metropolitan University Supervisor: Prof Zelda Potgieter TABLE OF CONTENTS Page DECLARATION i ABSTRACT ii OPSOMMING iii KEY WORDS iv ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 – INTRODUCTION TO THIS STUDY 1 1. Aim of the research 1 2. Context & Rationale 2 3. Outlay of Chapters 4 CHAPTER 2 - (DE)CONSTRUCTING THE ARCHIVE: A BRIEF LITERATURE REVIEW 5 CHAPTER 3 - DEON VAN DER WALT: A LIFE CUT SHORT 9 CHAPTER 4 - THE DEON VAN DER WALT COLLECTION: AN ANNOTATED CATALOGUE 12 CHAPTER 5 - CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 18 1. The current state of the Deon van der Walt Collection 18 2. Suggestions and recommendations for the future of the Deon van der Walt Collection 21 SOURCES 24 APPENDIX A PERFORMANCE AND RECORDING LIST 29 APPEDIX B ANNOTED CATALOGUE OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION 41 APPENDIX C NELSON MANDELA METROPOLITAN UNIVERSTITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (NMMU LIS) - CIRCULATION OF THE DEON VAN DER WALT (DVW) COLLECTION (DONATION) 280 APPENDIX D PAPER DELIVERED BY ZELDA POTGIETER AT THE OFFICIAL OPENING OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION, SOUTH CAMPUS LIBRARY, NMMU, ON 20 SEPTEMBER 2007 282 i DECLARATION I, Frederick Jacobus Buys (student no. 211267325), hereby declare that this treatise, in partial fulfilment for the degree M.Mus (Performing Arts), is my own work and that it has not previously been submitted for assessment or completion of any postgraduate qualification to another University or for another qualification. -
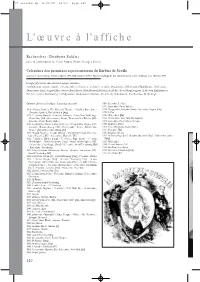
L'œuvre À L'affiche
37 affiche xp 2/06/05 10:13 Page 120 L'œuvre à l'affiche Recherches: Elisabetta Soldini avec la contribution de César Arturo Dillon, Georges Farret Calendrier des premières représentations du Barbier de Séville d’après A. Loewenberg, Annals of Opera 1597-1940, Londres 1978 et Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, éd. C. Dahlhaus et S. Döhring, 1991 Le signe [▼] renvoie aux tableaux des pages suivantes. Sauf indication contraire signalée entre parenthèses, l’œuvre a été chantée en italien: [Ang] anglais, [All] allemand, [Bulg] bulgare, [Cro] croate, [Dan] danois, [Esp] espagnol, [Est] estonien, [Finn] finnois, [Flam] flamand, [Fr] français, [Héb] hébreu, [Hong] hongrois, [Lett] letton, [Lit] Lituanien, [Née] néerlandais, [Nor] norvégien, [Pol] polonais, [Rou] roumain, [Ru] russe, [Serb] serbe, [Slov] slovène, [Sué] suédois, [Tch] tchèque CRÉATION: 20 février 1816, Rome, Teatro Argentina. [▼] 1869: décembre, Le Caire. 1871: 3 novembre, Paris, Athénée. 1818: 10 mars, Londres, Her Majesty’s Theatre. - 16 juillet, Barcelone. - 1874: 29 septembre, Helsinki. [Finn] - 2 décembre, Zagreb. [Cro] 13 octobre, Londres, Covent Garden. [Ang] 1875: Le Cap. 1819: 1er janvier, Munich. - Carnaval, Lisbonne. - 3 mai, New York [Ang] - 1876: Tiflis. - Kiev. [Ru] 27 mai, Graz. [All] - 28 septembre, Vienne, Theater auf der Wieden. [All] - 1883: 23 novembre, New York, Metropolitan. 26 octobre, Paris, Théâtre-Italien. 1884: 8 novembre, Paris, Opéra-Comique. 1820: 6 septembre, Milan, Teatro alla Scala. - 29 septembre, Prague. [All] - 1905 : Ljubljana. [Slov] 3 octobre, Braunschweig. [All] - 16 décembre, Vienne, Kärntnertor- 1913 : 3 mai, Christiania (Oslo). [Norv] Theater. [All] - 18 décembre, Brünn. [All] 1918 : Shanghai. [Ru] 1821: 25 août, Madrid. - 31 août, Odessa. - 19 septembre, Lyon. -

Kimberly Barber--Mezzo-Soprano
KIMBERLY BARBER, MEZZO-SOPRANO COMPLETE PERFORMANCE ARCHIVE Operatic and concert performances: 2019 “I never saw another butterfly: Music of the Holocaust”; Recital with Pianist Anna Ronai and Flutist Ulrike Anton; Richmond Hill Centre for the Performing Arts, Richmond Hill, ON, November 7, 2019 Gala Concert: Opening of CASP Conference; Edmonton, AB; mezzo-soprano Elizabeth Turnbull and others; October 16, 2019 Faculty Showcase: Music at Noon; Pianist Anna Ronai, Penderecki String Quartet, Pianists Anya Alexeyev and Glen Carruthers, vocalist Glenn Buhr; Maureen Forrester Recital Hall, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON; September 12, 2019 Mysterious Barricades: The Stories We Tell; Kitchener Public Library Theatre, Kitchener, ON; Pianist Anna Ronai, Penderecki String Quartet, Trumpeter Guy Few and others; Sept 10, 2019 (coast-to-coast livestream Sept. 14-21, 2019) Closing concert Festival de Fourvière; Chateau LaCroix-Laval, Lyon, France; Pianists Franck Avitabile and Catherine Garonne, cellist Yannick Callier; Aug 4, 2019 Opening concert Festival de Fourvière; Hôtel de Ville, Lyon, France; Three Songs of James Joyce, op. 10, Samuel Barber; Pianist Laetitia Bougnol; Aug 1, 2019 Concert Lyrique, NSVI, Église Ste-Claire, Riviere-Beaudette, QC; Pianist Michael Shannon, Mezzo-soprano Maria Soulis and others; July 3, 2019 Église Ste-Madeleine, Rigaud, QC, July 6, 2019 Mme. de la Haltière, Cendrillon, Jules Massenet; Conductor Leslie De’Ath, Soprano Emily Vondrejs, Mezzo-soprano Dominie Boutin and others; Theatre Auditorium WLU, Waterloo, -

Nov Dvds.Qxd
NNOOVVEEMMBBEERR 22000099 UK release call off 30th October SPECIAL BOX SETS SPECIAL BOX 2057918 2057928 Music [4] Sacred 2057938 Italian Opera [4] 2057948 Opera [4] Baroque 2057958 [4] Abbado Portrait Claudio [4] Essential Beethoven 2057728 2057468 Violetta Urmana, Konzert Europa Abbado BPO / 2072488 Quasthoff, Creation Haydn Dasch / Fisher Thielemann Die Meistersinger / available 9th November 2009 9th November available harmonia mundi CLASSICAL DVD news CLASSIC FM November DVD OF THE MONTH Medici Arts 2057348 Sao Paulo Samba BBC MUSIC MAGAZINE DVD CHOICE Signum Vision SIGDVD006 Touch the Sound: a sound journey / Evelyn Glennie BBC MUSIC MAGAZINE DVD CHOICE Medici Arts 2055488 Mahler Symphony No. 4, Schoenberg Pelleas & Melisande Juliane Banse (soprano); Gustav Mahler Youth Orchestra/ Claudio Abbado Coming next month: El Sistema, featuring José Contact Info Antonio Abreu, Gustavo Sales Tel: 020 8709 9500 Dudamel and the Simón Fax: 020 8709 9501 Bolívar Youth Orchestra on [email protected] bluray and DVD. DVDPress Karen Pitchford Tel: 07785 733561 This lyrical and moving [email protected] documentary takes us from Accounts: Kamrul Masud the rubbish dumps and Tel: 020 8709 9515 [email protected] barrios of Caracas to the Opening hours 9.00am - 5.30pm world's finest concert halls. harmonia mundi (U.K.) Limited Registered Office c/o Browne Jacobson LLP, Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HN Registered in England and Wales nº 159786 6 A R L E S / L O S A N G E L E S / L O N D O N / H E I D E L B E R G / B A R C E L O N A / D E N H A A G / A N T W E R P EN 2057728 Barcode: 880242577283 NTSC - 16:9, PCM Stereo, DD 5.1, DTS 5.1 Region code: 0 Original language: Italian Subtitles: English, French, German, Italian Booklet Notes: French, German, English Running time: 90 mins Audience: all EUROPA KONZERT 2009 VERDI La Forza del Destino Overture; MARTUCCI La canzone dei ricordi; SCHUBERT Symphony No. -

Programmheft Herunterladen
FREIBURGER BAROCKORCHESTER GOTTFRIED VON DER GOLTZ LEITUNG VESSELINA KASAROVA MEZZOSOPRAN Abo: Große Stimmen II In unserem Haus hören Sie auf allen Plätzen gleich gut – leider auch Husten, Niesen und Handy- klingeln. Ebenfalls aus Rücksicht auf die Künstler bitten wir Sie, von Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung abzusehen. Wir danken für Ihr Verständnis! 2,50 E 4I5 HÄNDEL IN LONDON GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759) GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Ouvertüre g-moll zu »Ariodante« HWV 33 (1735) Ouvertüre B-Dur zu »Alcina« HWV 34 (1735) ›Dopo notte, atra e funesta‹ ›Mi lusinga il dolce affetto‹ Arie des Ariodante aus »Ariodante« HWV 33 Arie des Ruggiero aus »Alcina« HWV 34 ›E vivo ancora?‹ – ›Scherza infida, in grombo al drudo‹ FRANCESCO MARIA VERACINI (1690 – 1768) Rezitativ und Arie des Ariodante aus »Ariodante« HWV 33 Ouvertüre Nr. 2 F-Dur (1716) Largo – Allegro – Largo – Allegro Ballo ›Entrée des Songes agréables effrayés‹ / ›Combat des songes‹ Gavotte für Streicher und Basso continuo aus »Ariodante« HWV 33 Sarabande Menuett ›Con l’ali di costanza‹ Gigue Arie des Ariodante aus »Ariodante« HWV 33 Menuett FRANCESCO GEMINIANI (1687 – 1762) GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Concerto grosso D-Dur op. 3 Nr. 1 (1733) ›Caro Amor, sol per momenti‹ Adagio Arie des Mirtillo aus »Il Pastor fido« HWV 8c (1712) Allegro Adagio ›Sento brillar nel sen‹ Allegro Arie des Mirtillo aus »Il Pastor fido« HWV 8c – Pause ca. 20.50 Uhr – – Ende ca. 22.00 Uhr – 6I7 PROGRAMM 8I9 KONKURRENZ BELEBT DAS GESCHÄFT Kardinal Cusani, der ihn entdeckt und protegiert hatte, schickte ihn in die Schule des berühmten HÄNDELS LONDONER OPERNUNTERNEHMUNGEN Kastraten Antonio Bernacchi. -

JULES MASSENET – His Life and Works by Nick Fuller I
JULES MASSENET – His Life and Works By Nick Fuller I. Introduction Jules Massenet’s operas made him one of the most popular composers of the late nineteenth century, his works performed throughout Europe, the Americas and North Africa. After World War I, he was seen as old- fashioned, and nearly all of his operas, apart from Werther and Manon , vanished from the mainstream repertoire. The opera-going public still know Massenet best for Manon , Werther , and the Méditation from Thaïs , but to believe, as The Grove Dictionary of Opera wrote in 1954, that ‘to have heard Manon is to have heard all of him’ is to do the composer a gross disservice. Massenet wrote twenty-seven operas, many of which are at least as good as Manon and Werther . Nearly all are theatrically effective, boast beautiful music and display insightful characterisation and an instinct for dramatic and psychological truth. In recent decades, Massenet’s work has regained popularity. Although he Figure 1 Jules Massenet, drawing by Ernesto Fontana (Source: is not the household name he once http://artlyriquefr.fr/personnages/Massenet%20Jules.html) was, and many of his operas remain little known, he has been winning new audiences. Conductors like Richard Bonynge, Julius Rudel and Patrick Fournillier have championed Massenet, while since 1990 a biennial Massenet festival has been held in his birthplace, Saint-Étienne, in the Auvergne-Rhône-Alpes, its mission to rediscover Massenet’s operas. His work has been performed in the world’s major opera houses under the baton of conductors Thomas Beecham, Colin Davis, Charles Mackerras, Michel Plasson, Riccardo Chailly and Antonio Pappano, and sung by Joan Sutherland, José van Dam, Frederica von Stade, Nicolai Gedda, Roberto Alagna, Renée Fleming, Thomas Hampson and Plácido Domingo. -

Vesselina Kasarova Concerto De’Cavalieri | Marcello Di Lisa Ópera E Oratória
Vesselina Kasarova Concerto de’Cavalieri | Marcello Di Lisa ÓPERA E ORATÓRIA PROGRAMA Vesselina Antonio Vivaldi Sinfonia de La Verità in cimento 5’ Kasarova Allegro – Andante – Allegro Georg Friedrich Händel Verdi Prati, ária de Alcina 5’ Concerto de’Cavalieri Georg Friedrich Händel Marcello Di Lisa Sta nell’Ircana, pietrosa tana, ária de Alcina 5’ Arcangelo Corelli Concerto Grosso em Ré maior, op. 6 n.º 4 9’ 9 novembro 21h Adagio, Allegro – Adagio, Vivace – Allegro Grande Auditório M ⁄ 6 Antonio Vivaldi Se al giorno vi chiudete, ária de Tito Manlio VERSÃO DE 1720 6’ Georg Friedrich Händel Vesselina Kasarova meio-soprano Se bramate d’amar chi vi sdegna, ária de Serse 7’ Marcello Di Lisa direção musical INTERVALO Concerto de’Cavalieri Georg Friedrich Händel violinos Concerto Grosso em Fá maior, op. 6 n.º 2 12’ Federico Guglielmo solista ⁄ Alessia Pazzaglia solista Andante larghetto – Allegro – Largo – Allegro ma non troppo Marialuisa Barbon ⁄ Katarzyna Solecka ⁄ Gabriele Politi Giancarlo Ceccacci ⁄ Heilke Wulff Giovanni Battista Pergolesi HWIETZ C Che fiero martìre, ária de Il prigionier superbo 5’ NNE S Gian Claudio Del Moro viola SA © SU violoncelos Antonio Vivaldi A P CA Gioele Gusberti solista ⁄ Valeria Brunelli Concerto para cordas em Ré maior, RV 121 6’ OTO F Luca Cola contrabaixo Allegro molto – Adagio – Presto Salvatore Carchiolo cravo Georg Friedrich Händel Mi lusinga il dolce affetto, ária de Alcina 7’ APOIO Georg Friedrich Händel Fammi combattere, ária de Orlando 5’ Vesselina Kasarova e Marcello Di Lisa, e uma vitalidade interpretativa fora a passagem do estilo veneziano tradicional Apresentação com o agrupamento Concerto de’ Cavalieri, do comum. -

Vesselina Kasarova El Canto También Se Transmite a Través De Una Mirada
ENTREVISTA Vesselina Kasarova El canto también se transmite a través de una mirada por Ingrid Haas acida en Stara Zagora, Bulgaria, Vesselina Kasarova es una de las grandes exponentes de la voz de mezzosoprano hoy en día y cuenta con un vasto Nrepertorio que va desde óperas de Händel, Mozart, Bellini, Berlioz, Bizet, Cilea, Gluck, Gounod, Massenet, Monteverdi, Offenbach, Rossini, Verdi, Richard Strauss, Tchaikovsky y Wagner. El timbre oscuro y aterciopelado de la voz de Kasarova impresiona de inmediato y sorprende la extensión tan amplia que tiene. Sus graves son ricos en armónicos y redondos y sus notas agudas son brillantes y con un bello squillo. Su versatilidad de estilos la ha llevado a cantar los llamados “trouser roles” (roles travestidos) como Ariodante en la ópera homónima de Händel, Ruggero en Alcina, Farnace en Mitridate, Re di Ponto, Idamante en Idomeneo, Cherubino en Le nozze di Figaro, Sesto y Annio en La clemenza di Tito, Romeo en I Capuleti e i Montecchi de Bellini, Stéphano en Roméo et Juliette de Gounod y Octavian en Der Rosenkavalier de Richard Strauss. En papeles femeninos se ha destacado por ser una excelente Rosina en Il barbiere di Siviglia de Rossini, Angelina en La Cenerentola, Isabella en L’italiana in Algeri de Rossini, Giovanna Seymour de Anna Bolena, Léonor de Guzman en La favorite de Donizetti, Dalila de Samson et Dalila de Saint-Saëns, Olga en Eugene Onegin y Polina en La dama de picas de Tchaikovsky, Eboli en Don Carlo, Amneris en Aida y Meg Page en Falstaff de Verdi, Fatime en Oberon de Weber y Venus en Tannhäuser, entre otros.. -

03-16-2020 Werther.Indd
JULES MASSENET werther conductor Opera in four acts Yannick Nézet-Séguin Libretto by Édouard Blau, Paul Milliet, production Sir Richard Eyre and Georges Hartmann, based on the novel Die Leiden des Jungen Werthers by set and costume designer Rob Howell Johann Wolfgang von Goethe lighting designer Monday, March 16, 2020 Peter Mumford 7:30–10:25 PM projection designer Wendall K. Harrington First time this season choreographer Sara Erde The production of Werther was made possible revival stage director by a generous gift from Elizabeth M. and J. Knighten Smit Jean-Marie R. Eveillard Major funding was received from Rolex Additional funding was received from The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation, Inc.; the Gramma Fisher Foundation, Marshalltown, Iowa; and The Gilbert S. Kahn & John J. Noffo Kahn Foundation general manager Peter Gelb jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2019–20 SEASON The 88th Metropolitan Opera performance of JULES MASSENET’S werther conductor Yannick Nézet-Séguin in order of vocal appearance charlotte johann Joyce DiDonato Philip Cokorinos sophie schmidt Ying Fang* Tony Stevenson* bailiff werther Alan Opie Piotr Beczała children brühlmann hans Calvin Griffin DEBUT William Kramer gretel käthchen Zoe Buff Megan Esther Grey** karl A. Jesse Schopflocher albert clara Etienne Dupuis This performance Mila Di Polo is being broadcast fritz live on Metropolitan Sasha Grossman Opera Radio on max SiriusXM channel 75 N. Casey Schopflocher and streamed at metopera.org. Monday, March 16, 2020, 7:30–10:25PM KEN -
Los Nuevos Tenores Mediáticos
VOCES Los nuevos tenores mediáticos por Ingrid Haas n las ediciones anteriores de la revista, tuvimos títulos en donde Eoportunidad de conocer a algunas de las jóvenes podemos escuchar sopranos y mezzosopranos que están triunfando en los (y ver) a Beczala. Les escenarios del mundo y que, a pesar de su excelente recomendamos en DVD calidad, no son famosas en nuestro país. A continuación les algunas de las óperas presentamos a cinco tenores que, aunque no cuentan con mencionadas, todas ellas mucha fama, están haciendo carrera en los principales teatros del archivo de la Ópera del mundo por la calidad de sus voces. de Zurich, así como su corta participación como Cabe destacar que, dentro de la cuerda de los tenores, la el Cantante Italiano competencia es muy grande ya que, como sabemos, es la voz en Der Rosenkavalier más “comercial” dentro del repertorio operístico masculino. (filmado en el Festival Creo que en el caso particular de los tenores, depende mucho de Salzburgo en 2004). el tipo de repertorio que canten para tener mayor o menor Recientemente grabó un difusión. Tal vez sea por ello que los cinco tenores que hemos disco de arias de ópera escogido no son tan famosos como otros: uno de ellos para la marca ORFEO se especializa en el repertorio rossiniano; otro tanto en el llamado Salut! y, a francés; el tercero en el mozartiano; uno más en el dramático finales de este año saldrá y wagneriano; y el quinto en el repertorio pucciniano. el DVD de su actuación Piotr Beczala como Edgardo en una función de Lucia di Piotr Beczala Lammermoor en el Met del pasado mes de febrero. -

Catalogue 2018
CATALOGUE 2018 Cast The Arthaus Musik classical music catalogue features more than 400 productions from the beginning of the 1990s until today. Outstanding conductors, such as Claudio Abbado, Lorin Maazel, Giuseppe Sinopoli and Sir Georg Solti, as well as world-famous singers like Placido Domingo, Brigitte Fassbaender, Marylin Horne, Eva Marton, Luciano Pavarotti, Cheryl Studer and Dame Joan Sutherland put their stamp on this voluminous catalogue. The productions were recorded at the world’s most renowned opera houses, among them Wiener Staatsoper, San Francisco Opera House, Teatro alla Scala, the Salzburg Festival and the Glyndebourne Festival. Unitel and Arthaus Musik are proud to announce a new partnership according to which the prestigious Arthaus Musik catalogue will now be distributed by Unitel, hence also by Unitel’s distribution partner C Major Entertainment. World Sales: All rights reserved · credits not contractual · Different territories · Photos: © Arthaus · Flyer: luebbeke.com Tel. +49.30.30306464 [email protected] Unitel GmbH & Co. KG, Germany · Tel. +49.89.673469-630 · [email protected] www.unitel.de OPERA ................................................................................................................................. 3 OPERETTA ......................................................................................................................... 35 BALLET ............................................................................................................................... 36 CONCERT........................................................................................................................... -

Zwischenfach: Paradox Or Paradigm?
Zwischenfach: Paradox or Paradigm? Elisabeth Harris A thesis submitted to Massey University and Victoria University of Wellington in partial fulfilment of the degree Master of Musical Arts, Majoring in Classical Voice. 2014 2 ABSTRACT Singers within the operatic world are expected to conform to the strict limits and dictates of the Fachsystem. Casting directors and opera companies prefer to be informed of which particular ‘Fach-box’ you tick when auditioning and it is becoming increasingly important for career advancement and name recognition to remain within that box. Yet what happens when your voice does not operate strictly within the predetermined requirements of a particular box? Or if the vocal category you supposedly assume is already ambiguous and contentious? Jennifer Allen’s DMA thesis, An Analysis and Discussion of Zwischenfach Voices, provides invaluable critical insight surrounding this enigmatic concept of voice categorisation. Allen argues that despite advances within vocal pedagogy, there remains a ‘gray area’ within the discussion. This elusiveness, to which Allen refers, pertains directly to the Zwischenfach voice type. Translated literally from German, the word Zwischen means ‘between’ and ‘Fach’ refers specifically to vocal specialisation as a way of categorising singers according to the weight, range and colour of their voices. Thus, in its most basic form, a Zwischenfach voice denotes a voice that lies between the vocal categories of soprano and mezzo-soprano. However, whilst Dr Rudolf Kloiber’s Handbuch der Oper (a staple for the operatic world) provides a definitive guide to vocal categorisation and continues to influence casting throughout Germany and Europe, the corresponding American Boldrey Guide acknowledges Zwischenfach as a voice that cannot be classified precisely in one particular Fach or another.