SOMMER! 8X Orgel So, 21.07.-08.09.2013, 20 Uhr | Stadtkirche S -Bad Cannstatt R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wagnerskt Orgelbrus
CG9010 Självständigt arbete, kyrkomusik, 15 hp Kandidatprogram, musiker, kyrkomusik 2021 Institutionen för klassisk musik (KK) Handledare: Incca Rasmusson Ludvig Käll Wagnerskt orgelbrus Att transkribera Richard Wagners musik för orgel Till dokumentationen hör följande inspelning: Morgenpracht inspelad i Sankt Görans kyrka Sammanfattning I orgeltranskriberingens historia så har Richard Wagners musik fått en särställning genom organisten Edwin H. Lemares massiva transkriptionsarbete. I det här arbetet undersöks hur Lemares transkriptionskonst är utformad och hur hans metoder kan appliceras på eget transkriptionsarbete. Lemares och andras transkriptioner jämförs med Wagners originalpartitur för att metoder och verktyg ska kunna observeras. Dessa appliceras på en egen transkription, vars skapelseprocess redogörs för. Detta arbete visar att Lemare använder sig av en metodisk teknik som i stora drag grundar sig på det klangliga resultatets slutliga kvalitet. I det här arbetet beskrivs denna teknik relativt ingående, för att om möjligt bidra med insikter och metoder för den av transkriptioner intresserade. Nyckelord: Wagner, Lemare, transkription, orgel, Parsifal, orkester, Gesamtkunstwerk, opera, musikdrama Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund ..................................................................................................... 1 5.1 Richard Wagners musik ............................................................................................. 1 5.2 Om Wagner-transkription ......................................................................................... -

The Big Picture - Welte’S Instruments, Rolls, Recording, Digital Editing
The big picture - Welte’s instruments, rolls, recording, digital editing by David Rumsey The Welte Philharmonie - or Philharmonic to most English-speakers - was an ingenious musical instrument. Its origins lay in both the pneumatics and acoustics of the ancient Greeks, to say nothing of their mechanics, hydraulics or music. In the 20th century, both the “Phil”, as it is affectionately known in some circles, and aeronautical engineering, brought human arts and sciences of using air to their zenith. Pneumatic organ actions were then transformed to electric actions although there was a later reaction back to mechanics. For the aviation industry it was seminal: aircraft now replaced steam engines and organs as the most complex technology known to civilisation. The many ages and stages between the ancient Greeks, and Welte’s early 20th century automatic instruments, produced a train of incremental invention. Each epoch found ways of making organs play and sound the way it wanted them to. That changed with every new aesthetic from gothic, renaissance, baroque, “neo- classical” late 18th century, through the romantic era and on to a second, “neo- classical” phase, in the 20th century. It differed from country to country, culture to culture, even language to language: whether French, German, Italian, English or Netherlands, organs were also expressions of national ethos. By the early 19th century, the means of controlling the aesthetic qualities of organ pipes had long been established by empirical means: if it sounded good, then that was the way it was done. Sounding good, of course, differed according to Welte’s original proposal for the appearance of whether you were a medieval Britannic’s Philharmonie on board Netherlander, a renaissance Spaniard, a baroque Saxon, or your language and culture were “classical” French. -

Welton Hall & Organ
The PipeLine Journal of the YDOA June Edition Patron: Dr Francis Jackson CBE (Organist Emeritus, York Minster) President: Nigel Holdsworth, 01904 640520 Secretary: Renate Sangwine, 01904 781387 Treasurer: Cynthia Wood, 01904 795204 Membership Secretary: Helen Roberts, 01904 708625 The PipeLine Editor, Webmaster and YDOA Archivist: Maximillian Elliott www.ydoa.co.uk The York & District Organists’ Association is affiliated to the Incorporated Association of Organists (IAO) and serves all who are interested in the organ and its music. Contents 1. Introduction ................................................................................ 3 2. YDOA Events ............................................................................... 4 3. The Ebor Organ Album……………………………………………… ............... 5 4. Previous Event ............................................................................ 6 5. Next Event ................................................................................... 8 6. Upcoming Recitals & Concerts…………………………………………………. 9 7. Gallery ...................................................................................... 11 8. Article I ...................................................................................... 12 9. Article II ..................................................................................... 21 10. Organ of the Month .................................................................. 25 11. The Trivia Section ...................................................................... 27 The Caption -

Journal of the YDOA December Edition
The PipeLine Journal of the YDOA December Edition Patron: Dr Francis Jackson CBE (Organist Emeritus, York Minster) President: Nigel Holdsworth, 01904 640520 Secretary: Renate Sangwine, 01904 781387 Treasurer: Cynthia Wood, 01904 795204 Membership Secretary: Helen Roberts, 01904 708625 The PipeLine Editor, Webmaster and YDOA Archivist: Maximillian Elliott www.ydoa.co.uk The York & District Organists’ Association is affiliated to the Incorporated Association of Organists (IAO) and serves all who are interested in the organ and its music. Contents 1. Introduction ................................................................................ 3 2. YDOA Events ............................................................................... 4 3. Previous Event ............................................................................ 5 4. Next Event ................................................................................... 6 5. Upcoming Recitals & Concerts…………………………………………………. 7 6. Gallery……………………………………………………………………………………. 8 7. Article I ........................................................................................ 9 8. Article II ..................................................................................... 24 9. Organ of the Month .................................................................. 31 10. The Trivia Section ...................................................................... 38 The Caption Competition .......................................................... 38 11. The People Section .................................................................. -

The Berkshire Organist 2017
err rg ISSN 0265-1971 2017 be 70 Patron: Gillian Weir DBE President 2015-2017 Jonathan Holl ARCO LRAM ARCM, e Old Dairy Farm, Winkeld Lane, Winkeld, Windsor SL4 4RU tel: (01344) 886700 [email protected] President Elect -vacant Secretary -Harry Russell, 131 Recreation Road, Burgheld Common, Reading RG7 3EN tel: (0118) 983 3547 [email protected] Treasurer -Derek Guy AFCM 14 Wilmington Close, Woodley, Reading, RG5 4LR tel: (0118) 969 3587 [email protected] Programme Secretary -Christine Wells BMus FRCO LRAM Lynton Villa, Pheasants Hill, Hambleden, Henley-on-ames Oxfordshire, RG9 6SD tel: (01491) 571588 Editor: e Berkshire Organist - vacant Editor: e Newsletter - David Pether Publicity O!cer - Harry Russell, 131 Recreation Road, Burgheld Common, Reading RG7 3EN tel: (0118) 983 3547 [email protected] Webmaster - David Pether www.berkshireorganists.org.uk Other Trustees: Andy Baldwin, David Butler, Anthony Hodson, Jill York, Mark Jameson, Ian May Independent Examiner - David Duvall Honorary Fellows - Dr. Francis Jackson, Dr William McVicker Neither the Editors nor the Association accept any responsibility for opinions expressed in this Journal e Berkshire Organist 2016 1 ! e Berkshire Organists Association Table of Contents Page Constitution 4 Recital & AGM 13 May 2017 Andy Baldwin 10 President’s Report to the AGM Jonathan Holl 13 Reading Town Hall Recitals Celebrity Recital Anne Page 19 May 2016 Edward Stans! eld 14 Daniel Cook 17 October 2016 Jonathan Holl 17 Simon Johnson 11 May 2017 Jonathan Holl 19 Lunchtime -

The Organ Music of Edwin H. Lemare – 1) Original Works, 2) Editions, 3) Transcriptions 1) Original Organ Works by Edwin H
The organ music of Edwin H. Lemare – 1) Original works, 2) Editions, 3) Transcriptions 1) Original organ works by Edwin H. Lemare (211) The 52 pieces without opus numbers have been allocated WoO. numbers, which will be used for identification purposes in the new printed edition from www.trumph.se. Some of these works use melodies by other composers. They are not transcriptions in the sense of being an organ version of the original composers music, but they are free paraphrases by Lemare in the manner of a fantasia or hymn prelude. They have been included here as original works. Two works, the Concert Fantasia on Pleyel's German Hymn WoO. 53 and a March in G WoO. 54 are presumed lost. (Note that sometimes Lemare used the same opus number twice eg. Op. 74, Op. 121, Op. 141 and Op. 153.) Op. Title Date Dedicatee Notes Number Op. 2 Marche Moderne 1884 WoO. 1 Andantino in D-flat 1888 The author has found ten references to performances of this piece by three different organists in two countries Concert Fantasia on Pleyel's WoO. 53 1888 between 1888 and 1909. One programme German Hymn indicated that it was played from manuscript and so this may have been lost. WoO. 2 Andante Moderato in F 1889 date c. 1889 WoO. 3 Allegro Moderato in D 1889 WoO. 4 Concert Fantasia in F 1891 W.S.Hoyte Op. 4 Concert Fantasia on “Hanover” 1892 Mons.A.Guilmant WoO. 5 Pastorale No.1 in E 1892 WoO. 6 Romance in D-flat 1893 WoO. -

Welte's Instruments, Rolls
David Rumsey THE BIG PICTURE – WELTE’S INSTRUMENTS, ROLLS, RECORDING, DIGITAL EDITING The Welte Philharmonie – or Philharmonic to most The many ages and stages between the ancient English-speakers – was an ingenious musical in- Greeks, and Welte’s early 20th century automatic in- strument. Its origins lay in both the pneumatics struments, produced a train of incremental inven- and acoustics of the ancient Greeks, to say nothing tion. Each epoch found ways of making organs play of their mechanics, hydraulics or music. In the and sound the way it wanted them to. That changed 20th century, both the “Phil”, as it is affectionately with every new aesthetic from gothic, renaissance, known in some circles, and aeronautical engineer- baroque, “neo-classical” late 18th century, through ing, brought human arts and sciences of using air the romantic era and on to a second, “neo-classical” to their zenith. Pneumatic organ actions were then phase, in the 20th century. It differed from country transformed to electric actions although there was to country, culture to culture, even language to lan- a later reaction back to mechanics. For the aviation guage: whether French, German, Italian, English industry it was seminal: aircraft now replaced or Netherlands, organs were also expressions of steam engines and organs as the most complex national ethos. technology known to civilisation. By the early 19th century, the means of controlling the aesthetic qualities of organ pipes had long been established by empirical means: if it sounded good, then that was the way it was done. Sounding good, of course, differed according to whether you were a medieval Netherlander, a renaissance Spaniard, a 64 baroque Saxon, or your language and culture were 65 “classical” French. -
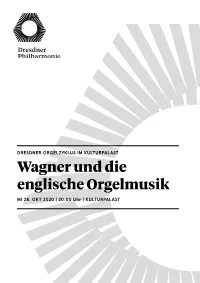
Programmheft (PDF 1.0
DRESDNER ORGELZYKLUS IM KULTURPALAST Wagner und die englische Orgelmusik MI 28. OKT 2020 | 20.00 Uhr | KULTURPALAST KONZERT- EINFÜHRUNG DIGITAL Zu ausgewählten Konzerten können Sie unsere Einführungen in Ruhe sowohl vor dem Konzert als auch noch lange danach hören unter dresdnerphilharmonie.de/konzerteinfuehrung-digital PROGRAMM Richard Wagner (1813 – 1883) Ouvertüre zur Oper »Der fiegende Holländer« (1841) Arrangement von Edwin Henry Lemare Samuel Sebastian Wesley (1810 – 1876) Larghetto fs-Moll, Nr. 2 aus Three Pieces for a Chamber Organ (1843) Charles Villiers Stanford (1852 – 1924) Fantasia und Toccata op. 57 (1894/1917) Richard Wagner »Isoldes Liebestod« aus »Tristan und Isolde« (1865) Arrangement von Reginald Goss-Custard Henry Smart (1813 – 1879) Grand Solemn March Edwin Henry Lemare (1866 – 1934) Scherzo a-Moll aus der Sonate Nr. 1 F-Dur für Orgel op. 95 (1914) Toccata di concerto op. 59 (1909) Johannes Trümpler | Orgel Auf Einladung der Dresdner Philharmonie HARALD HODEIGE Von musikalische Dramen und virtuosen Feuerwerken Wagner und die englische Orgelmusik »Der fliegende Holländer« – Bühnenbildentwurf von Helmut Jürgens für den 1. Aufzug, Bayerische Staatsoper München 1950 4 WAGNER UND DRESDEN karätiges Sängerensemble zur Verfügung Zeit seines Lebens hatte Richard Wagner stand. In Dresden wurden auch »Tann- zu seiner Geburtsstadt Leipzig kein unge- häuser« sowie die romantische Oper »Der trübtes Verhältnis. Auch die Gegenliebe fiegende Holländer« uraufgeführt, in der der Leipziger hielt sich eher in Grenzen: sich erstmals die tragische Verstrickung Das Geburtshaus am Brühl wurde bereits von Fluch, Betrug und Erlösung fndet, drei Jahre nach dem Tod des Kompo- die in Wagners späteren Musikdramen nisten abgerissen, und es bedurfte einer eine so große Rolle spielen sollte. -
![Excerpt from Navidad Nuestra [Nah-Vee-THAD Nooayss-Trah]; Music by Ariel Ramírez [Ah-Reeell Rah-MEE-Rehth] and Text by F](https://docslib.b-cdn.net/cover/8962/excerpt-from-navidad-nuestra-nah-vee-thad-nooayss-trah-music-by-ariel-ram%C3%ADrez-ah-reeell-rah-mee-rehth-and-text-by-f-3038962.webp)
Excerpt from Navidad Nuestra [Nah-Vee-THAD Nooayss-Trah]; Music by Ariel Ramírez [Ah-Reeell Rah-MEE-Rehth] and Text by F
La anunciacion C La anunciación C lah ah-noon-theeah-theeAWN C (excerpt from Navidad nuestra [nah-vee-THAD nooAYSS-trah]; music by Ariel Ramírez [ah-reeELL rah-MEE-rehth] and text by F. Luna [(F.) LOO-nah]) La barca C lah BAR-kah C (The Boat) C (excerpt from the suite Impresiones intimas [eem- prayss-YO-nayss een-TEE-mahss] — Intimate Impressions — by Federico Mompou [feh- theh-REE-ko mawm-POOO]) La barcheta C lah bar-KAY-tah C (The Little Boat) C (composition by Hahn [HAHN]) La bas dans le limousin C Là-bas dans le Limousin C lah-bah dah6 luh lee-môô-zeh6 C (excerpt from Chants d'Auvergne [shah6 doh-vehrny’] — Songs of the Auvergne [o-vehrny’], French folk songs collected by Joseph Canteloube [zho-zeff kah6-t’lôôb]) La bas vers leglise C Là-bas, vers l'église C lah-bah, vehr lay-gleez C (excerpt from Cinq mélodies populaires grecques [seh6k may-law-dee paw-pü-lehr greck] — Five Popular Greek Melodies — by Maurice Ravel [mo-reess rah-vell]) La belle helene C La belle Hélène C lah bell ay-lenn C (The Fair Helen) C (an opera, with music by Jacques Offenbach [ZHACK AWF-funn-bahk]; libretto by Henri Meilhac [ah6-ree meh-yack] and Ludovic Halévy [lü-daw-veek ah-lay-vee]) La belle isabeau conte pendant lorage C La belle Isabeau (Conte pendant l’orage) C lah bell ee- zah-bo (kaw6t pah6-dah6 law-rahzh) C (The Lovely Isabeau (Tale During a Storm)) C (poem by Alexandre Dumas [ah-leck-sah6-dr’ dü-mah] set to music by Hector Berlioz [eck-tawr behr-leeawz]) La belle se sied au pied de la tour C lah bell s’-seeeh o peeeh duh lah tôôr C (The Fair Maid -

March 2011 Newsletter.Pub
RON RESEIGH IN CONCERT … connued from the first page Ron has had the opportunity to play several of concert arsts on the internaonal theatre organ cir‐ the large organ installaons in the Detroit area includ‐ cuit. He has an amazing musical memory, playing toe‐ Detroit Theater Organ Society ing the Senate Theater and the famed Detroit Fox Thea‐ tapping ragme pieces, jazz, standards, ballads, and tre Wurlitzer. current popular music. He is currently the featured In 1997, Ron entered the Motor City Theatre organist at the Organ Piper Music Palace near Milwau‐ March 2011 Newsletter Volume 50, Issue 2 Organ Society’s Young Organist Compeon and placed kee, Wisconsin. first in the Hobbyist Division. He then entered the The doors and box office to the theatre open American Theatre Organ Society (ATOS) Naonal Young at 2:00p.m.. The concert will start at 3:00p.m.. Show Organist Compeon and placed first in the Intermedi‐ your membership card at the box office to receive your ON RESEIGH IN CONCERT ate Division. That took him to San Francisco to the free cket. Your membership card is also good for up Redford Theatre 1998 ATOS naonal convenon where he won the to three more complimentary admissions. Normal ck‐ Sunday, March 13, 2011 3:00 p.m. Overall Division in the Naonal Finalist Compeon. As et price is $12.00. Discounts are available for members R a result, Ron was invited to London, England, where he of the American Guild of Organists (AGO) and the Mo‐ The Detroit Theater played a concert for the 1999 ATOS naonal convenon tor City Theatre Organ Society (MCTOS). -

The Tracker Journal of the Organ Historical Society Skinner Organ Company, Op
VOLUME 62, NUMBER 3, JULY 2018 THE TRACKER JOURNAL OF THE ORGAN HISTORICAL SOCIETY SKINNER ORGAN COMPANY, OP. 711 (1928) C.E. MOREY, NO. 248 (1907) PAUL FRITTS & COMPANY, OP. 26 (2008) THE RUDOLPH WURLITZER COMPANY (1929) OUR FEATURED ARTISTS DAVID BASKEYFIELD NATHAN LAUBE DAVID PECKHAM EDOARDO BELLOTTI ANNIE LAVER ROBERT POOVEY IVAN BOSNAR THATCHER LYMAN WILLIAM PORTER KEN COWAN COLIN LYNCH CAROLINE ROBINSON PETER DUBOIS COLIN MACKNIGHT DARYL ROBINSON KATELYN EMERSON CHRISTOPHER MARKS JONATHAN RYAN DAVID HIGGS MALCOLM MATTHEWS NICOLE SIMENTAL RICHARD HILLS AMANDA MOLE JOEL SPEERSTRA FRED HOHMAN ALAN MORRISON BRUCE STEVENS LEN LEVASSEUR LEN WILMA JENSEN JONATHAN MOYER MICHAEL UNGER PHOTOS PETER KRASINSKI SEAN O’DONNELL JORIS VERDIN C.B. FISK, INC., OP. 83 (1983) CHRISTIAN LANE JONATHAN ORTLOFF BRADLEY HUNTER WELCH ORTLOFF ORGAN COMPANY, LLC, OP. 1 (2016) JOIN THE OHS IN ROCHESTER IN COLLABORATION WITH THE EASTMAN ROCHESTER ORGAN INITIATIVE FESTIVAL IN OCTOBER THE 2018 CONVENTION of the Organ Historical Society will celebrate the rich array of instruments in Rochester, New York. Home to an expansive collection of organs representing diverse musical styles and performance practices, Rochester is a hub for organ performance and education. Convention attendees will experience an eighteenth-century Italian Baroque organ housed in the beautiful Memorial Art Gallery, a tour of the George Eastman Museum—home of the world’s largest residence organ—and everything in between. Visit the website below for the latest updates! WWW.ORGANHISTORICALSOCIETY.ORG/2018 AEOLIAN COMPANY, NO. 947 AND NO. 1345 GOART/YOKOTA (2008) HOPE-JONES ORGAN COMPANY, OP. 2 (1908) ANONYMOUS ITALIAN BAROQUE ORGAN (CA. -

Eati·E OI•0An JOURNAL of the AMERICAN THEATRE ORGAN SOCIETY ~
eatI·e OI•0an JOURNAL OF THE AMERICAN THEATRE ORGAN SOCIETY ~ May / June 2000 ~ I Pro Organo .. Q·.,o P P O ~nQli a leading ·American Q~.gano producer of sacred Pro Organo CD 7051 ·11, ·.· i.o~ouTH~· . :t: Pro 0rgano CD7042 ~-YM1. GAN&.llM. · ~l . classical THE OLD SOUTH 1~//i•,,'.it'tiL~.'.~t OPUS 190 Frederick Hohman organ and BRASS .~ ui i!· ,,;)0 ;~. O~GAN T~MPA".'1I -~\~ Total time: 75:35 • [DDD fully digital] choral & Ji),.J,... ~;; (1 J~ ~:. Recorded: September, 1995 d · Frederick MacArthur, organist ·:J · · .. ·•:::..:.,ij•"'-=...,_J, reCO/< 1ngs... Roger Voisin, conductor - ~:::::~ ~ ..::.!...:..•:tf :::::- ·. Vintage repertoire played upon the Oldest Original and Intact 4-manual Suggests Total time: 75:48 • [DDD] • CD only ~.:t.; ::f 7. ':§.~:? Ernest M. Skinner Pipe Organ (1912) at a few titles Ernest M. Skinner organ (Opus 308, 1921) ~ ..,. ""· ,. 1.lffi fjfg'_ Grand Avenue Temple United Methodist of Old South Church, Boston, Massachusetts H• • - ~ ~----~~-~ Church, Kansas City, Missouri from our Program: The Star-Spangled Banner • The Ride of the Valkyries - Wagner Program: Ernest M. Skinner's Opus 190 Start-Up and Shut-Down Sounds • catalog •Poeme Hero'ique , Dupre• 1812 Overture , Tchaikovsky- arr. Faxon• Carillon Horatio Parker, Festival Prelude • Walter Edward Howe, Hommage a Bonnet de Westminster , Vierne • March Triomphale Centenaire de Napoleon I, (1918] • Alfred Hollins, A Song of Sunshine (1913] • Gaston Dethier , Intermezzo that Offer Vierne • Fanfare , Oliphant Chuckerbutty • Pomp & Circumstance No. 1, Opus (191 OJ•Gordon Balch Nevin, Will o' the Wisp• Felix Borowski, Sonata No. 1 for as much 39, Elgar• The Stars & Stripes Forever , Sousa • Auld Lang Syne - arrange Organ • Powell Weaver , The Cuckoo - The Squirrel • Pietro Yon, Speranza • ments for brass, organ and timpani by George Faxon Tchaikovsky, Yearning• Harry Rowe Shelley, Scherzo-Mosaic (Dragonflies) • Louis Vierne, from Organ Symphony No.