Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AMTLICHE NACHRICHTEN NIEDERÖSTERREICH Nr
AMTLICHE NACHRICHTEN NIEDERÖSTERREICH Nr. 10 / Jahrgang 2016 / St. Pölten, 31. Mai 2016 Start der Offensive für Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in Niederösterreich LH Pröll: „Setzen ganz bewusst auf Freiwilligkeit und Vorbildwirkung“ Niederösterreich wolle Vorbild sein durch die Teilnahme an der Aktion. Überall, dort, wo man die Verantwortung trage, welche Lebensmittel verwendet werden, werde die Aktion ab Sommer durchgeführt: in der Landhaus- küche, in den Großküchen der Pflegeheime und Kliniken und bei der Verpflegung in den Lan- desschulen. Dabei beginne man nicht von Null. „Wir waren in der Vergangenheit bereits sehr inten- siv darauf bedacht nach heimi- schen Produkten zu greifen. Über 90 Prozent der Produkte kommen aus Niederösterreich", so der Landeshauptmann. 80 Prozent der Fleischprodukte würden aus Niederösterreich kommen und der Bio-Anteil betrage zwischen Starteten Offensive für Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln: Landwirtschaftskammer-Präsident Ing. Hermann 40 und 80 Prozent, diesen Wert Schultes, Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und SeneCura-CEO Anton Kellner, MBA. (v.l.n.r.). (Foto: Filzwieser) wolle man natürlich steigern. Mit der Kennzeichnung der regi- Im Rahmen einer Pressekonfe- abgegeben. Ab Sommer wird zwischen Produzenten und Kon- onalen Herkunft von Fleisch und renz informierten Landeshaupt- in den Großküchen des Landes sumenten", so Pröll. „Das ‚Gut Eiern wolle man „Transparenz mann Dr. Erwin Pröll, Landwirt- Niederösterreich die regionale zu wissen‘-Siegel ist keine Zu- und Sicherheit" geben. Man wol- schaftskammer-Präsident Ing. Herkunft von Fleisch und Eiern satzbelastung für die Wirte. Je- le damit „ein Vorbild für andere Hermann Schultes und SeneCu- auch sichtbar gemacht. der, der kennzeichnen will, kann Großküchen sein", so Pröll. „Wir ra-CEO Anton Kellner, MBA das tun. -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich
1 von 32 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2017 Ausgegeben am 18. Dezember 2017 Teil II 385. Verordnung: Änderung der Verordnung über das Aktionsprogramm 2012 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 385. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung über das Aktionsprogramm 2012 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen geändert wird Auf Grund § 55p Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2017, wird verordnet: Die Verordnung über das Aktionsprogramm 2012 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, in der Fassung des Amtsblatts zur Wiener Zeitung, Nr. 22/2008, zuletzt geändert durch das BGBl. II Nr. 319/2015, wird wie folgt geändert: 1. Der Titel lautet: „Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über das Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitrat-Aktionsprogramm- Verordnung – NAPV)“ 2. § 1 Abs. 2 lautet: „(2) Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 1. Ackerflächen: für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen genutzte landwirtschaftliche Nutzflächen oder für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verfügbare, aber brachliegende Flächen, unabhängig davon, ob sich diese Flächen unter -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

The Paleoenvironment of an Early Middle Miocene Paratethys
Geobios (2002) Mémoire spécial n° 24 www.elsevier.com/locate/geobios The paleoenvironment of an early Middle Miocene Paratethys sequence in NE Austria with special emphasis on paleoecology of mollusks and foraminifera Oleg Mandic a,*, Mathias Harzhauser b, Silvia Spezzaferri a, Martin Zuschin a aInstitute of Paleontology, University of Vienna, Althanstrasse 14, 1090 Vienna, Austria bMuseum of Natural History, Burgring 7, BOX 417, 1014 Vienna, Austria Received 21 September 2001; accepted 18 February 2002 Abstract In a multidisciplinary approach including data on paleoecology of foraminifera, mollusks, balanids and coralline algae, as well as on taphonomy, sedimentology, sequence stratigraphy and regional geology, the environmental reconstruction for the Niederleis Basin (a satellite depression of the Vienna Basin and important fossiliferous site of the Central Paratethys region) is provided. The data came from two sections in proximal (section Buschberg) and distal (section Bahnhof) position relative to the northwesterly exposed basement chain. The accomplished analysis confirmed the presumed bathymetric and paleogeographic differences. A paleodepth of about 100 m for the Buschberg- and up to 500 m for the Bahnhof-section was indicated by foraminifera. Due to the short distance of the Buschberg-section to the paleoshore, a drowned paleocliff paralleling the tectonic margin of the Niederleis Basin is assumed. Synsedimentary tectonic sagging of the basin is inferred for the sequence at Bahnhof. Whereas the fossil record from autochthonous sediments implies deepening upward, the mixed fossil assemblage from tempestites implies shallowing of the supply center, respective gradual installation of extended onshore to lagoonal habitats. This is in accordance with the inferred biostratigraphic position within the late Lower Lagenidae Zone characterized by the installation of the high stand system tract in the Vienna Basin. -

1. SUMSI-ERIMA-KIDS-CUP 25. 4. 2018 in Stronsdorf
1. SUMSI-ERIMA-KIDS-CUP 25. 4. 2018 in Stronsdorf GRUPPE A GRUPPE B A1 VS Poysdorf 2 B1 VS Poysdorf 1 A2 VS Wilfersdorf B2 VS Niederleis A3 VS Gaweinstal B3 VS Altlichtenwarth/Rabensburg A4 VS Ladendorf B4 VS Asparn/Zaya A5 VS Gaubitsch B5 VS Wildendürnbach A6 VS Fallbach/Hagenberg B6 VS Neudorf A7 VS Laa/Thaya B7 VS Staatz A8 VS Großharras/Stronsdorf B8 VS Großkrut ZEITPLAN 9.00 VS Fallbach/Hagenb. – VS Groha/Stro VS Neudorf – VS Niederleis 9.12 VS Poysdorf 2 – VS Wilfersdorf VS Altlichtenwarth/Rabensburg – VS Asparn/Zaya 9.24 VS Gaweinstal – VS Ladendorf VS Poysdorf 1 – VS Niederleis 9.36 VS Gaubitsch – VS Fallbach/Hagenberg VS Wildendürnbach – VS Neudorf 9.48 VS Laa/Thaya – VS Großharras/Stronsdorf VS Staatz – VS Großkrut 10.00 VS Poysdorf 2 – VS Gaweinstal VS Asparn/Zaya – VS Wildendürnbach 10.12 VS Wilfersdorf – VS Ladendorf VS Neudorf – VS Poysdorf 1 10.24 VS Gaubitsch – VS Laa/Thaya VS Altlichtenwarth/Rabensburg – VS Niederleis 10.36 VS Fallbach/Hagenberg – VS Poysdorf 2 VS Großkrut – VS Poysdorf 1 10.48 VS Gaweinstal – VS Wilfersdorf VS Staatz – VS Neudorf 11.00 VS Ladendorf – VS Gaubitsch VS Poysdorf 1 – VS Altlichtenwarth/Rabensburg 11.12 VS Laa/Thaya – VS Fallbach/Hagenberg VS Wildendürnbach – VS Niederleis 11.24 VS Großharras/Stronsdorf – VS Poysdorf 2 VS Neudorf – VS Altlichtenwarth/Rabensburg 11.36 VS Gaubitsch – VS Wilfersdorf VS Asparn/Zaya – VS Staatz 11.48 VS Fallbach/Hagenberg – VS Gaweinstal VS Wildendürnbach – VS Großkrut 12.00 VS Ladendorf – VS Laa/Thaya VS Staatz – VS Altlichtenwarth/Rabensburg 12.12 VS Gaubitsch -

In Wilfersdorf Wünscht Die SPÖ
Rotstift Informationsblatt der sozialdemokratischen Partei Wilfersdorf 113. Ausgabe - Juni 2006 www.spoe-wilfersdorf.at Aus dem Inhalt _________________________________________ ? Leitartikel, Franz Nießler... S2 _________________________________________ ? Gemeinderatssitzung........ S 3,5 _________________________________________ ? Sie fragen, wir antworten. S 6,7 _________________________________________ ? Kindergartengesetz-neu..... S13 _________________________________________ ? Club-Räume....................... S15 _________________________________________ ? Jugendheim........................ S16 _________________________________________ in Wilfersdorf wünscht die SPÖ Deponie-Schwerverkehr auf Dauer über Wilfersdorf umgeleitet? Vielen von Ihnen wird das fersdorf/Hobersdorf fahren, dort strikt gegen eine derartige Lösung Verkehrszeichen “Links abbiegen umdrehen und dann wieder zurück ausgesprochen. Es wurde zwar von verboten” (von Richtung zur Deponie fahren! der Behörde die Deponie geneh- Mistelbach kommend, vor der Das kann nicht wirklich sein? migt, die Kosten für eine Kläranlage Mistelbach), schon Doch - in der mündlichen Abbiegespur sind ihr jedoch zu aufgefallen sein. Doch was Verhandlung am 10.12.2004 teuer. bedeutet es? Alle Schwer- (UVP-G2000) im Stadtsaal Warum wird nicht der Betreiber- transporte, die aus Richtung Mistelbach, wo obiges verlangt firma die Errichtung einer Ab- Mistelbach, Laa, Ernstbrunn usw. wurde, hat sich gfGR Hömstreit (in biegespur vorgeschrieben? kommen, müssen nach Wil- Vertretung von Bgm. Ing. Döltl) -
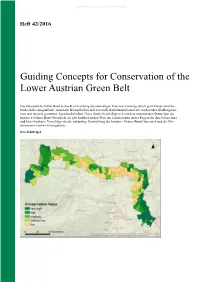
Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt
©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Heft 42/2016 Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Das Europäische Grüne Band erstreckt sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch ganz Europa und ver- bindet dabei ausgedehnte, naturnahe Biotopflächen und wertvolle Kulturlandschaften mit wachsenden Siedlungsräu- men und intensiv genutzten Agrarlandschaften. Diese Studie beschäftigt sich mit dem momentanen Status Quo der Initiative Grünes Band Österreich, sie gibt Einblick in den Wert der Landschaften dieser Region für den Naturschutz und bietet konkrete Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Initiative Grünes Band Österreich und der Nie- derösterreichischen Grenzgebiete. Eva Schweiger ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Eva Schweiger, 2015 ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Abstract Stretching across Europe along the former Iron Curtain, the European Green Belt connects large undisturbed natural biotopes and valuable cultural landscapes with developing urban areas and intensively used agricultural landscapes. The European Green Belt initiative’s main goal is to preserve and restore a pan-European ecological network with a connecting function for species and habitats as well as for conservation work. This study investigates the current status quo of the Austrian Green Belt initiative in regard of organisational structures and conservation activities. Furthermore, a spatial analysis of one specific part of the Austrian borderlands, the Lower Austrian Green Belt, sheds light on the value of this region’s landscapes for nature conservation and clearly shows that the Iron Curtain’s preserving effect is still present in proximity to the border. -

Kopie Von L500020-22.Vp
VERORDNUNG ÜBER DIE SCHULSPRENGEL DER VOLKSSCHULEN UND DIE VOLKSSCHUL- GEMEINDEN IN NIEDERÖSTERREICH 5000/20–0 Stammverordnung 82/77 1977-08-10 Blatt 1-22 5000/20–1 1. Novelle 114/78 1978-08-22 Blatt 9, 10, 10a, 11, 14, 15, 17 5000/20–23 5000/20–2 2. Novelle 72/80 1980-05-30 Blatt 1-23 5000/20–3 3. Novelle 68/81 1981-05-19 Blatt 6, 7, 14, 22 5000/20–4 4. Novelle 85/92 1982-08-20 Blatt 16, 17, 18, 23 5000/20–5 5. Novelle 70/83 1983-06-10 Blatt 14 und 20 5000/20–6 6. Novelle 112/83 1983-08-31 Blatt 7 und 10 5000/20–7 7. Novelle 65/84 1984-08-10 Blatt 15, 19, 23 5000/20–8 8. Novelle 77/84 1984-08-24 Blatt 16 5000/20–9 9. Novelle 106/87 1987-10-13 Blatt 1, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 5000/20–10 10. Novelle 43/88 1988-04-19 Blatt 1, 2, 3, 4 0 5000/20–11 11. Novelle 70/92 1992-06-12 Blatt 5, 7, 8, 11-17, 21, 22 5000/20–12 12. Novelle 133/95 1995-09-21 Blatt 3, 6, 8-10, 16, 19-21, 23 5000/20–13 13. Novelle 107/96 1996-08-29 Blatt 4, 6, 8-10, 13, 20, 21 5000/20–14 14. Novelle 88/97 1997-08-29 Blatt 3-6, 8, 10-12, 14, 15, 15a, 16, 19-23 5000/20–15 15. -

589 Mistelbach
Mistelbach - Asparn an der Zaya - Stronsdorf 589 gültig bis 25.4.2021 Betreiber: Dr. Richard NÖ GmbH & Co KG, Stromstraße 11, 1200 Wien, Tel.: 01/33100-355 Alle Angaben ohne Gewähr Montag - Freitag Kursnummer 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 Verkehrshinweis ▲ ▲ ▲a ▲ ▲ ▲b ▲ ▲ ▲ Mistelbach Hauptplatz (C2) 9.44 11.07 11.44 12.21 13.00 13.44 14.01 15.10 15.44 16.10 16.44 17.44 18.44 Mistelbach Alleegasse 11.10 13.03 14.04 Mistelbach Bahnhof (H) 7.47 9.47 11.11 11.47 12.24 13.04 13.47 14.05 15.13 15.47 16.13 16.47 17.47 18.47 19.47 Mistelbach Josef-Dunkl-Straße 7.48 9.48 11.12 11.48 12.25 13.05 13.48 14.06 15.14 15.48 16.14 16.48 17.48 18.48 19.48 Hüttendorf Weidengasse 7.50 9.50 11.14 11.50 12.27 13.07 13.50 14.08 15.16 15.50 16.16 16.50 17.50 18.50 19.50 Hüttendorf Wehrgasse 7.51 9.51 11.15 11.51 12.28 13.08 13.51 14.09 15.17 15.51 16.17 16.51 17.51 18.51 19.51 Hüttendorf Obere Landstraße 7.52 9.52 11.16 11.52 12.29 13.09 13.52 14.10 15.18 15.52 16.18 16.52 17.52 18.52 19.52 Asparn/Zaya Am Sandgraben 7.56 9.56 11.20 11.56 12.33 13.13 13.56 14.14 15.22 15.56 16.22 16.56 17.56 18.56 19.56 Asparn/Zaya Hauptplatz 7.57 9.57 11.21 11.25 11.57 12.34 13.14 13.57 14.15 15.23 15.57 16.23 16.57 17.57 18.57 19.57 Asparn/Zaya Schulzentrum an 11.22 11.26 12.35 13.15 14.16 15.24 16.24 16.58 Asparn/Zaya Schulzentrum ab 11.25 11.26 12.35 13.15 14.16 15.24 16.24 16.58 Asparn/Zaya Kiesweg 7.59 11.27 11.59 15.26 15.59 17.00 17.59 19.59 Olgersdorf Am Steinberg 8.00 11.28 12.00 15.27 16.00 17.01 18.00 20.00 Olgersdorf Dorfstraße -

Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich
Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich Langenlebarner Straße 108 | 3430 Tulln an der Donau Telefon: +43 (2272) 9005 - 13170 | Fax: +43 (2272) 9005 - 13135 EMail: [email protected] endgültige Ergebnisliste (Stand von: 27.08.2018 22:14 mit Sollzeit von: 12:20,00) 62. Landeswasserdienstleistungsbewerb 23.08.2018 - 26.08.2018 LFKDO Niederösterreich Rang Gruppenname Instanz AFKDO Nr. Gesamt Bronze Frauen ohne Alterspunkte / Eigene 10 Julia Kastner , Ulrike Steyrer Laa/Thaya Laa/Thaya 43 10:52,23 Bronze ohne Alterspunkte / Eigene 16 Johannes Pfennigbauer , Gerald Laa/Thaya Laa/Thaya 34 07:04,49 Steyrer 47 Florian Krammer , Jürgen Pleil Bullendorf Mistelbach 379 07:32,96 112 Christoph Schweinberger , Lukas Bullendorf Mistelbach 731 08:06,19 Schweinberger 175 Ewald Hartmann , Helmut Hartmann Gaubitsch Laa/Thaya 291 08:45,19 191 Florian-Mika Graf , Josef Graf Atzelsdorf Mistelbach 128 08:55,07 225 Roland Graf , Anna Weilinger Bernhardsthal Poysdorf/Schrattenberg 273 09:20,04 236 Thomas LEHNER , Sandra Altlichtenwarth Poysdorf/Schrattenberg 495 09:32,32 Woditschka 243 Thomas Krautstoffel , Andreas Bernhardsthal Poysdorf/Schrattenberg 272 09:39,32 Schmid 270 Benedikt-Josef Graf , Ingrid Graf Atzelsdorf Mistelbach 267 10:55,03 272 Helga Neugebauer , Harald Bernhardsthal Poysdorf/Schrattenberg 372 11:12,48 Schlifelner Bronze mit Alterspunkten / Eigene 7 Leopold Krammer , Martin Pleil Bullendorf Mistelbach 388 07:07,20 10 Gerald Gail , Martin Seiler Wilfersdorf Mistelbach 582 07:13,34 31 Martin Hofmeister , Patrick Moser Bernhardsthal Poysdorf/Schrattenberg -

Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good Practice
Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good practice Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good practice Vienna 2018 Publishing information Media owner, general editor and publisher: Federal Ministry for Sustainability and Tourism Stubenring 1, A-1010 Vienna +43 1 71100-0 www.bmnt.gv.at Text, editing and design: Marian Unterlercher, Revital - Integrative Naturraumplanung GmbH; supported by the Federal Water Engineering Administrations in the Provinces (Selection and description of the example projects) Proofing: Clemens Neuhold, Drago Pleschko, Franz Schmid, Heinz Stiefelmeyer, Martin Wenk Image sources: Air Media/ Karl Strauch (p. 42 right), Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 12 (p. 13, p. 16 right, p. 17 top left, bottom left, bottom right, p. 45), Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Wasserbau (p. 50), Amt der Salzburger Landesregierung Abt. 7 (p. 24-25, p. 30-31), Amt der Tiroler Landesregierung BBA Reutte (p. 45), Amt der Vorarlberger Landesregierung (p. 48 (2), Amt der Vorarlberger Landesregierung/Walter Häusler (p. 6), BMNT/Paul Gruber (p. 5), BMVIT/Martin Stippel (p. 13 bottom), BMNT (p.27, p.41), Autonome Provinz Bozen-Südtirol Abt. 30 Wasserschutzbauten (p. 15 left), Bundesheer/Kermer (p. 7), Bundesheer (p. 10 left, right , p. 18 right), Bundesheer/Mario Berger (p. 11), Bundesheer/Günther Filzwieser (p. 12, p. 15 right), Bundeswasserbauverwaltung Burgenland (p. 46 top right, left), Bundeswasserbauver- waltung Steiermark/zepp-cam/Graz (p. 38), BWV Steiermark (p. 44), Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung Sektion Kärnten (cover image; p. 13 left, p. 17 top right, p. 33 bottom right), Hydroingenieure (p. 14 li.), Gunz ZT GmbH (p. 43), ICPDR (p. -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens.