Steckbrief Pseudoskorpion
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diptera, Empidoidea) 263 Doi: 10.3897/Zookeys.365.6070 Research Article Launched to Accelerate Biodiversity Research
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 365: 263–278 (2013) DNA barcoding of Hybotidae (Diptera, Empidoidea) 263 doi: 10.3897/zookeys.365.6070 RESEARCH ARTICLE www.zookeys.org Launched to accelerate biodiversity research Using DNA barcodes for assessing diversity in the family Hybotidae (Diptera, Empidoidea) Zoltán T. Nagy1, Gontran Sonet1, Jonas Mortelmans2, Camille Vandewynkel3, Patrick Grootaert2 1 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny (JEMU), Rue Vautierstraat 29, 1000 Brussels, Belgium 2 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny (Ento- mology), Rue Vautierstraat 29, 1000 Brussels, Belgium 3 Laboratoire des Sciences de l’eau et environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Avenue Albert Thomas, 23, 87060 Limoges, France Corresponding author: Zoltán T. Nagy ([email protected]) Academic editor: K. Jordaens | Received 7 August 2013 | Accepted 27 November 2013 | Published 30 December 2013 Citation: Nagy ZT, Sonet G, Mortelmans J, Vandewynkel C, Grootaert P (2013) Using DNA barcodes for assessing diversity in the family Hybotidae (Diptera, Empidoidea). In: Nagy ZT, Backeljau T, De Meyer M, Jordaens K (Eds) DNA barcoding: a practical tool for fundamental and applied biodiversity research. ZooKeys 365: 263–278. doi: 10.3897/zookeys.365.6070 Abstract Empidoidea is one of the largest extant lineages of flies, but phylogenetic relationships among species of this group are poorly investigated and global diversity remains scarcely assessed. In this context, one of the most enigmatic empidoid families is Hybotidae. Within the framework of a pilot study, we barcoded 339 specimens of Old World hybotids belonging to 164 species and 22 genera (plus two Empis as outgroups) and attempted to evaluate whether patterns of intra- and interspecific divergences match the current tax- onomy. -

Diptera: Empidoidea), with a Redefinition of the Tribe Ocydromiini
© Copyright Australian Museum, 2000 Records of the Australian Museum (2000) Vol. 52: 161–186. ISSN 0067–1975 Revision of the Genus Apterodromia (Diptera: Empidoidea), With a Redefinition of the Tribe Ocydromiini BRADLEY J. SINCLAIR1 AND JEFFREY M. CUMMING 2 1 Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 160, D-53113 Bonn, Germany [email protected] 2 Systematic Entomology Section, ECORC, Agriculture and Agri-Food Canada, K.W. Neatby Building, C.E.F., Ottawa, ON, Canada K1A 0C6 [email protected] ABSTRACT. The Australian endemic genus Apterodromia Oldroyd (Diptera: Empidoidea) is revised and includes four apterous species (A. evansi Oldroyd, A. minuta n.sp, A. setosa n.sp., and A. tasmanica n.sp.) and eight fully winged species (A. aurea n.sp., A. bickeli n.sp., A. irrorata n.sp., A. monticola n.sp., A. pala n.sp., A. spilota n.sp., A. tonnoiri n.sp., and A. vespertina n.sp.). The male of A. evansi is described and zoogeographic patterns of the genus are discussed. On the basis of wing venation and male terminalia Apterodromia is transferred from the Tachydromiinae to the tribe Ocydromiini (subfamily Ocydromiinae). The Ocydromiini is redefined, two new genera (Neotrichina n.gen. and Leptodromia n.gen.) are described, and all included genera are listed. Keys to major lineages of Australian Empidoidea and Southern Hemisphere genera of Ocydromiini are provided. The following new combinations are listed: Hoplopeza tachydromiaeformis (Bezzi), Leptodromia bimaculata (Bezzi), Neotrichina abdominalis (Collin), N. digna (Collin), N. digressa (Collin), N. distincta (Collin), N. elegans (Bigot), N. fida (Collin), N. indiga (Collin), N. -

Nomenclatural Studies Toward a World List of Diptera Genus-Group Names
Nomenclatural studies toward a world list of Diptera genus-group names. Part V Pierre-Justin-Marie Macquart Evenhuis, Neal L.; Pape, Thomas; Pont, Adrian C. DOI: 10.11646/zootaxa.4172.1.1 Publication date: 2016 Document version Publisher's PDF, also known as Version of record Document license: CC BY Citation for published version (APA): Evenhuis, N. L., Pape, T., & Pont, A. C. (2016). Nomenclatural studies toward a world list of Diptera genus- group names. Part V: Pierre-Justin-Marie Macquart. Magnolia Press. Zootaxa Vol. 4172 No. 1 https://doi.org/10.11646/zootaxa.4172.1.1 Download date: 02. Oct. 2021 Zootaxa 4172 (1): 001–211 ISSN 1175-5326 (print edition) http://www.mapress.com/j/zt/ Monograph ZOOTAXA Copyright © 2016 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://doi.org/10.11646/zootaxa.4172.1.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:22128906-32FA-4A80-85D6-10F114E81A7B ZOOTAXA 4172 Nomenclatural Studies Toward a World List of Diptera Genus-Group Names. Part V: Pierre-Justin-Marie Macquart NEAL L. EVENHUIS1, THOMAS PAPE2 & ADRIAN C. PONT3 1 J. Linsley Gressitt Center for Entomological Research, Bishop Museum, 1525 Bernice Street, Honolulu, Hawaii 96817-2704, USA. E-mail: [email protected] 2 Natural History Museum of Denmark, Universitetsparken 15, 2100 Copenhagen, Denmark. E-mail: [email protected] 3Oxford University Museum of Natural History, Parks Road, Oxford OX1 3PW, UK. E-mail: [email protected] Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by D. Whitmore: 15 Aug. 2016; published: 30 Sept. 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 NEAL L. -

Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Leaf Litter of the Slovak Karst National Park
Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 61: 77-83 Karlsruhe, April 2021 Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from leaf litter of the Slovak Karst National Park Alexandra Jászayová & Tomáš Jászay doi: 10.30963/aramit6113 Abstract. A total of 667 specimens of pseudoscorpions, belonging to 15 species and four families were collected during 2014. Samples were taken from leaf litter at five localities in the Western Carpathians in the Slovak Karst National Park, Slovakia. The most abundant fa- milies were Neobisiidae (381 specimens) and Chthoniidae (275 specimens). Furthermore ten chernetid specimens and a single cheliferid deutonymph were recorded. Four of the 15 pseudoscorpion species were recorded in the Slovak Karst for the first time. Keywords: Carpathians, distribution, faunistics, Slovakia Zusammenfassung. Pseudoskorpione (Arachnida: Pseudoscorpiones) aus Laubstreu im Nationalpark Slowakischer Karst. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 667 Pseudoskorpione aus 15 Arten und vier Familien gesammelt. Die Proben wurden in fünf verschiedenen Gebieten im Nationalpark Slowakischer Karst (Westkarpaten, Slowakei) genommen. Am häufigsten waren die Familien Neobisiidae (381 Exemplare) und Chthoniidae (275 Exemplare) vertreten. Weiterhin wurden zehn Exemplaren der Chernetidae und nur eine Deutonym- phe einer Cheliferidae erfasst. Vier der 15 Pseudoskorpionarten wurden erstmals im slowakischen Karst nachgewiesen. The Slovak Karst National Park is one of the most valuable localities (Fig. 1): Brzotín Rocks (BR), Pod Fabiánkou (F), areas in Slovakia in terms of biodiversity (Tomaskinova & Drieňovec (D), Hrušovská lesostep forest-steppe (HL) and Tomaskin 2013). The territory of the National Park consists Jasovské dubiny ( JD). of the Koniarská, Plešivská, Silická, Zádielská and Jasovská BR: Brzotín Rocks National Nature Reserve is situated at plateaus, the Horný and Dolný hills, and is divided into gorges 290–679 m a.s.l. -

Georg-August-Universität Göttingen
GÖTTINGER ZENTRUM FÜR BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG UND ÖKOLOGIE GÖTTINGEN CENTRE FOR BIODIVERSITY AND ECOLOGY Herb layer characteristics, fly communities and trophic interactions along a gradient of tree and herb diversity in a temperate deciduous forest Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von Mag. rer. nat. Elke Andrea Vockenhuber aus Wien Göttingen, Juli, 2011 Referent: Prof. Dr. Teja Tscharntke Korreferent: Prof. Dr. Stefan Vidal Tag der mündlichen Prüfung: 16.08.2011 2 CONTENTS Chapter 1: General Introduction............................................................................................ 5 Effects of plant diversity on ecosystem functioning and higher trophic levels ....................................................... 6 Study objectives and chapter outline ...................................................................................................................... 8 Study site and study design ................................................................................................................................... 11 Major hypotheses.................................................................................................................................................. 12 References............................................................................................................................................................. 13 Chapter 2: Tree diversity and environmental context -
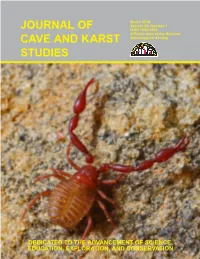
Journal of Cave and Karst Studies
March 2018 Volume 80, Number 1 JOURNAL OF ISSN 1090-6924 A Publication of the National CAVE AND KARST Speleological Society STUDIES DEDICATED TO THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, EDUCATION, EXPLORATION, AND CONSERVATION Published By BOARD OF EDITORS The National Speleological Society Anthropology George Crothers http://caves.org/pub/journal University of Kentucky Lexington, KY Office [email protected] 6001 Pulaski Pike NW Huntsville, AL 35810 USA Conservation-Life Sciences Tel:256-852-1300 Julian J. Lewis & Salisa L. Lewis Lewis & Associates, LLC. [email protected] Borden, IN [email protected] Editor-in-Chief Earth Sciences Benjamin Schwartz Malcolm S. Field Texas State University National Center of Environmental San Marcos, TX Assessment (8623P) [email protected] Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Leslie A. North 1200 Pennsylvania Avenue NW Western Kentucky University Washington, DC 20460-0001 Bowling Green, KY [email protected] 703-347-8601 Voice 703-347-8692 Fax [email protected] Mario Parise University Aldo Moro Production Editor Bari, Italy Scott A. Engel [email protected] Knoxville, TN 225-281-3914 Exploration Paul Burger [email protected] National Park Service Eagle River, Alaska Journal Copy Editor [email protected] Linda Starr Microbiology Albuquerque, NM Kathleen H. Lavoie State University of New York Plattsburgh, NY [email protected] Paleontology Greg McDonald National Park Service Fort Collins, CO [email protected] Social Sciences Joseph C. Douglas The Journal of Cave and Karst Studies , ISSN 1090-6924, CPM Volunteer State Community College Number #40065056, is a multi-disciplinary, refereed journal pub- Gallatin, TN lished four times a year by the National Speleological Society. -

Predation Interactions Among Henhouse-Dwelling Arthropods, With
Predation interactions among henhouse-dwelling arthropods, with a focus on the poultry red mite Dermanyssus gallinae Running title: Predation interactions involving Dermanyssus gallinae in poultry farms Ghais Zriki, Rumsais Blatrix, Lise Roy To cite this version: Ghais Zriki, Rumsais Blatrix, Lise Roy. Predation interactions among henhouse-dwelling arthropods, with a focus on the poultry red mite Dermanyssus gallinae Running title: Predation interactions involving Dermanyssus gallinae in poultry farms. Pest Management Science, Wiley, 2020, 76 (11), pp.3711-3719. 10.1002/ps.5920. hal-02985136 HAL Id: hal-02985136 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02985136 Submitted on 1 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 Predation interactions among henhouse-dwelling 2 arthropods, with a focus on the poultry red mite 3 Dermanyssus gallinae 4 Running title: 5 Predation interactions involving Dermanyssus gallinae 6 in poultry farms 7 Ghais ZRIKI1*, Rumsaïs BLATRIX1, Lise ROY1 8 1 CEFE, CNRS, Université de Montpellier, Université Paul Valery 9 Montpellier 3, EPHE, IRD, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier Cedex 10 5, France 11 *Correspondence: Ghais ZRIKI, CEFE, CNRS 1919 route de Mende, 34293 12 Montpellier Cedex 5, France. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Pseudoscorpionida: Chernetidae), Two Remarkable Sexually Dimorphic Pseudoscorpions from Australasia
Records of the Western Australian Museum Supplement No. 52: 199-208 (1995). Barbaraella gen. novo and Cacoxylus Beier (Pseudoscorpionida: Chernetidae), two remarkable sexually dimorphic pseudoscorpions from Australasia Mark S. Harvey Western Australian Museum, Francis Street, Perth, Western Australia 6000, Australia Abstract -A new genus, Barbaraella, with the new species, B. mainae, is described from northwestern Australia, in which males possess greatly elongate pedipalps. The possible relationships of the genus are discussed and a close affinity with Teratochemes is suggested. Cacoxylus echinatlls Beier is redescribed, and the unusual sexual dimorphism of the body is highlighted. The composition of the Lamprochernetinae is discussed and 7 genera are included: Lamprochernes Tomosvary, Allochernes Beier, Wyochemes Hoff, Pselaphochemes Beier, NlIdochernes Beier, Lasiochernes Beier and Megachernes Beier. INTRODUCTION in the Eucla Caravan Park for a series of Sexual dimorphism in pseudoscorpions is pseudoscorpions collected over many years generally restricted to the genital region, although sampling the varied habitats in Western Australia. differences may be observed in other areas of the body (Chamberlin 1931) such as the abdomen (e.g. Syarinidae, Cheliferidae, Withiidae, Atemnidae), MATERIALS AND METHODS chela (e.g. Chernetidae), coxae (e.g. Feaellidae, The specimens that form the basis of this study Pseudochiridiidae, Cheliferidae), cheliceral galea, are lodged in the American Museum of Natural and tarsal claws (some Cheliferidae). Of the chelal History, New York (AMNH), Natural History modifications, size differences skewed in favour of Museum, London (BMNH), the Smithsonian females (Zeh 1987) are the most apparent, although Institution, Washington D.e. (USNM) and the the males of some species, especially chernetids, Western Australian Museum, Perth (WAM). -

Diptera) of Uzh River Basin, with Additions to Checklists of Ukraine
Annales de la Société entomologique de France (N.S.) International Journal of Entomology ISSN: 0037-9271 (Print) 2168-6351 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tase20 Brachystomatidae, Empididae and Hybotidae (Diptera) of Uzh River Basin, with additions to checklists of Ukraine Ruud van der Weele, Ľuboš Hrivniak, Jürgen Kappert, Peter Manko, Igor Shamshev & Jozef Oboňa To cite this article: Ruud van der Weele, Ľuboš Hrivniak, Jürgen Kappert, Peter Manko, Igor Shamshev & Jozef Oboňa (2017): Brachystomatidae, Empididae and Hybotidae (Diptera) of Uzh River Basin, with additions to checklists of Ukraine, Annales de la Société entomologique de France (N.S.), DOI: 10.1080/00379271.2017.1304178 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00379271.2017.1304178 Published online: 03 Apr 2017. Submit your article to this journal Article views: 6 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tase20 Download by: [Universitetsbiblioteket i Bergen] Date: 07 April 2017, At: 00:32 Annales de la Société entomologique de France (N.S.), 2017 http://dx.doi.org/10.1080/00379271.2017.1304178 Brachystomatidae, Empididae and Hybotidae (Diptera) of Uzh River Basin, with additions to checklists of Ukraine Ruud van der Weelea, Ľuboš Hrivniakb,c, Jürgen Kappertd, Peter Mankoe, Igor Shamshevf & Jozef Oboňae* aVliegerweg 11, NL – 4101 JK Culemborg, The Netherlands; bBiology Centre CAS, Institute of Entomology, Branišovská 1160/31, CZ – 370 05 České Budějovice, Czech Republic; cFaculty of Sciences, University of South Bohemia, Branišovská 31, CZ – 370 05 České Budějovice, Czech Republic; dForsthaus 1, D – 363 91 Sinntal, Germany; eDepartment of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, 17. -

Association of Pseudoscorpions with Different Types of Bird Nests
Biologia 66/4: 669—677, 2011 Section Zoology DOI: 10.2478/s11756-011-0072-8 Association of pseudoscorpions with different types of bird nests Jana Christophoryová1,ZuzanaKrumpálová2,JánKrištofík3 &ZlaticaOrszághová1 1Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina B-1,SK-84215 Bratislava, Slovakia; e-mail: [email protected], [email protected] 2Department of Ecology and Environment, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Trieda Andreja Hlinku 1,SK-94974 Nitra, Slovakia; e-mail: [email protected] 3Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9,SK-84506 Bratislava, Slovakia; e-mail: jan.kristofi[email protected] Abstract: The hypothesis of associating pseudoscorpions with bird nest types was tested on the basis of an analysis of 480 specimens. Eleven pseudoscorpion species were found in 171 nests of 28 different bird species collected in Slovakia, Austria and the Czech Republic. The frequent appearance of Cheiridium museorum, Dactylochelifer latreillii, Chernes hahnii, Dendrochernes cyrneus and Allochernes wideri was confirmed. High proportion and association of Pselaphochernes scorpioides in hoopoe hollow nests with decomposed substrate, D. cyrneus in the Eurasian tree sparrow nest boxes and A. wideri in the nests of the tawny owls, the European scops owls and the European roller was proved. In contrast, C. hahnii and D. latreillii were related to the nest fauna of blackbirds and song thrushes, C. museorum to the nests of white wagtails situated on the ground and on buildings and C. cancroides to the nests in synanthropic habitats. Until present, the occurrence of 22 pseudoscorpion species has been confirmed in the bird nests of Central Europe based on the obtained results and published resources. -

(Pseudoscorpiones, Chernetidae) in Phoresy on Fanniidae (Diptera) Acta Scientiarum
Acta Scientiarum. Biological Sciences ISSN: 1679-9283 [email protected] Universidade Estadual de Maringá Brasil de Araujo Lira, André Felipe; Tizo-Pedroso, Everton Report of Sphenochernes camponoti (Beier, 1970) (Pseudoscorpiones, Chernetidae) in phoresy on Fanniidae (Diptera) Acta Scientiarum. Biological Sciences, vol. 39, núm. 4, october-december, 2017, pp. 449- 454 Universidade Estadual de Maringá Maringá, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187153564006 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Acta Scientiarum http://www.uem.br/acta ISSN printed: 1679-9283 ISSN on-line: 1807-863X Doi: 10.4025/actascibiolsci.v39i4.36373 Report of Sphenochernes camponoti (Beier, 1970) (Pseudoscorpiones, Chernetidae) in phoresy on Fanniidae (Diptera) André Felipe de Araujo Lira1 and Everton Tizo-Pedroso2* 1Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil. 2Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos, Universidade Estadual de Goiás, Rua 14, 625, 75650-000, Câmpus Morrinhos, Jardim América, Morrinhos, Goiás, Brazil. *Author for correspondence. E-mail: [email protected] ABSTRACT. Phoresy is a common dispersal behavior among pseudoscorpions. Neotropical pseudoscorpions, mainly from the North and Northeast regions of Brazil, are known for their dispersal relationships with beetles and flies. Here, we report phoretic association among nymphs of Sphenochernes camponoti (Chernetidae) and Fannia flies (F. pusio, F. yenhedi, and F. canicularis) (Diptera, Fanniidae). Twelve flies, each carrying a young pseudoscorpion, were collected in Caatinga vegetation in Pernambuco State, Brazil.