Axel E. WALTER – Die (Re-)Konstruktion Altpreußischer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Who Were the Prusai ?
WHO WERE THE PRUSAI ? So far science has not been able to provide answers to this question, but it does not mean that we should not begin to put forward hypotheses and give rise to a constructive resolution of this puzzle. Great help in determining the ethnic origin of Prusai people comes from a new branch of science - genetics. Heraldically known descendants of the Prusai, and persons unaware of their Prusai ethnic roots, were subject to the genetic test, thus provided a knowledge of the genetics of their people. In conjunction with the historical knowledge, this enabled to be made a conclusive finding and indicated the territory that was inhabited by them. The number of tests must be made in much greater number in order to eliminate errors. Archaeological research and its findings also help to solve this question, make our knowledge complemented and compared with other regions in order to gain knowledge of Prusia, where they came from and who they were. Prusian people provinces POMESANIA and POGESANIA The genetic test done by persons with their Pomesanian origin provided results indicating the Haplogroup R1b1b2a1b and described as the Atlantic Group or Italo-Celtic. The largest number of the people from this group, today found between the Irish and Scottish Celts. Genetic age of this haplogroup is older than that of the Celt’s genetics, therefore also defined as a proto Celtic. 1 The Pomerania, Poland’s Baltic coast, was inhabited by Gothic people called Gothiscanza. Their chronicler Cassiodor tells that they were there from 1940 year B.C. Around the IV century A.D. -

Nicolaus Copernicus Immanuel Kant
NICOLAUS COPERNICUS IMMANUEL KANT The book was published as part of the project: “Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland” in the part of the activity concerning the publishing of the book “On the Trail of Outstanding Historic Personages. Nicolaus Copernicus – Immanuel Kant” 2 Jerzy Sikorski • Janusz Jasiński ON THE TRAIL OF OUTSTANDING HISTORIC PERSONAGES NICOLAUS COPERNICUS IMMANUEL KANT TWO OF THE GREATEST FIGURES OF SCIENCE ON ONCE PRUSSIAN LANDS “ElSet” Publishing Studio, Olsztyn 2020 PREFACE The area of former Prussian lands, covering the southern coastal strip of the Baltic between the lower Vistula and the lower Nemunas is an extremely complicated region full of turmoil and historical twists. The beginning of its history goes back to the times when Prussian tribes belonging to the Balts lived here. Attempts to Christianize and colonize these lands, and finally their conquest by the Teutonic Order are a clear beginning of their historical fate and changing In 1525, when the Great Master relations between the Kingdom of Poland, the State of the Teutonic Order and of the Teutonic Order, Albrecht Lithuania. The influence of the Polish Crown, Royal Prussia and Warmia on the Hohenzollern, paid homage to the one hand, and on the other hand, further state transformations beginning with Polish King, Sigismund I the Old, former Teutonic state became a Polish the Teutonic Order, through Royal Prussia, dependent and independent from fief and was named Ducal Prussia. the Commonwealth, until the times of East Prussia of the mid 20th century – is The borders of the Polish Crown since the times of theTeutonic state were a melting pot of events, wars and social transformations, as well as economic only changed as a result of subsequent and cultural changes, whose continuity was interrupted as a result of decisions partitions of Poland in 1772, 1793, madeafter the end of World War II. -

Besprechungen Und Anzeigen 453 Das Litauische Recht Nach Der
Besprechungen und Anzeigen 453 das litauische Recht nach der Eroberung des größten Teils der Kiever Rus’ durch das li- tauische Großfürstentum beeinflusst hatte, lässt sich kaum als „ausländisch“ bezeichnen. Es ließen sich noch mehr Beispiele anführen. So wirken die nachgezeichneten Einflüsse zumindest für die ältere Privatrechtsgeschichte anachronistisch. Der Vf. kommt immerhin seiner Aufgabe, die wichtigsten Daten der allgemeinen politi- schen Geschichte, der äußeren Rechtsgeschichte und der ausgewählten Beispiele aus den früheren Forschungen zu den zivilrechtlichen Quellen aus der baltischen Region zusam- menzuführen, relativ fleißig nach. Für einen Einstieg in das Thema und als eine zusam- menfassende Erläuterung älterer Forschungen nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch, Polnisch, Weißrussisch und Litauisch ist das Buch gut brauchbar. Tartu Marju Luts-Sootak Pietro Umberto Dini: Aliletoescvr. Linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel Cinquecento. Books & Company. Livorno 2010. 844 S. ISBN 978-88-7997- 115-7. (€ 50,–.) This volume by the Italian Baltist Pietro Umberto D i n i reveals new horizons not only in the studies of Baltic languages, but also in the spread of humanist ideas in the culture of the Baltic region. The monograph is appealing and relevant for scholars of various fields of human sciences. This recent work has an intriguing title and extends over an imposing number of pages. The large size of this book meets the eye, as well as the research mentioned in the intro- duction at the Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen and the W. F. Bessel Award of the Alexander von Humboldt-Stiftung, which undoubtedly contributed to the preparation of this monograph. -

Things, That Endure
CULTURE, PHILOSOPHY AND ARTS RESEARCH INSTITUTE Ancient Baltic Culture THINGS, THAT ENDURE Edited by Dr. Elvyra Usačiovaitė Vilnius 2009 KULTŪROS, FILOSOFIJOS IR MENO INSTITUTAS Senovės baltų kultūra TAI, KAS IŠLIEKA Vilnius 2009 UDK 008(=88) Se91 Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Redakcinė kolegija: akademikas Algirdas GAIŽUTIS Vilniaus pedagoginis universitetas prof, habil, dr. Juris URTANAS Latvijos kultūros akademija habil, dr. Saulius AMBRAZAS Lietuvių kalbos institutas habil, dr. Nijolė LAURINKIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas akademike Janina KURSYTĖ Latvijos universitetas dr. Radvile RACĖNAITĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas dr. Elvyra USAČIOVAITĖ Kultūros, filosofijos ir meno institutas dr. Eugenijus SVETIKAS Lietuvos istorijos institutas Sudarė dr. E. Usačiovaitė. Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos © Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009 © Viršelio nuotrauka, Vilmantė Matuliauskienė, 2009 © „Kronta“ leidykla, 2009 ISBN 978-609-401-027-9 Turinys Elvyra Usačiovaitė. Įvadas............................................................9 Gintaras Beresnevičius Vietos ir spalvos Lietuvos religinės geografijos bruožai XIII-XIV a.................... 31 Elvyra Usačiovaitė. Kristupas Hartknochas apie prūsų religiją.........................................................................39 Pranas Vildžiūnas. Auxtheias Vissagistis - supagonintas krikščionių Dievas........................................................................69 -

AUKCJA VARIA (28) 16 Lutego (Sobota) 2019, Godz
AUKCJA VARIA (28) 16 lutego (sobota) 2019, godz. 17.00 w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego w Gdańsku, ul. Długa 2/3 WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA: od 28 stycznia 2019 r. Gdańsk, ul. Długa 2/3 poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15 tel. (58) 301 05 54 Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl 1 Artysta nieokreślony (2 poł. XVIII w.) Pejzaż włoski olej, płótno dublowane, 45,5 × 75 cm cena wywoławcza: 5 000 zł 2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 2 Artysta nieokreślony (2 poł. XVIII w.) Pejzaż włoski z ruinami i posągiem olej, płótno dublowane, 45,5 × 75 cm cena wywoławcza: 5 000 zł AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 3 3 Thomas Bush Hardy (1842 Sheffield–1897 Londyn) Żaglowce na morzu olej, płótno, 51 × 76 cm sygn. p. d.: T… Hardy cena wywoławcza: 3 000 zł 4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 4 Carl Saltzmann (1947–1923) Statki na redzie, 1898 r. olej, płótno, 53,5 × 117 cm sygn. i dat. l. d.: C. Saltzmann 98 cena wywoławcza: 1 900 zł AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 5 5 Zbigniew Litwin (1914–2001) Łodzie na plaży, 1968 r. akwarela, papier, 36 × 51 cm sygn. i dat. p. d.: ZLitwin 1968 cena wywoławcza: 2 600 zł • 6 J. Makowski (XX w.) Jastarnia olej, tektura, 21 × 31 cm sygn. p. d.: J. Ma- kowski/Jastarnia cena wywoławcza: 1 000 zł 6 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 7 Marian Mokwa (1889 Malary – 1987 Sopot) Port olej, płótno, 50 × 80 cm sygn. p. d.: Mokwa cena wywoławcza: 10 000 zł • AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 7 8 Stanisław Gibiński (1882 Rzeszów – 1971 Katowice) Przy ognisku akwarela, tektura, 34 × 48,5 cm sygn. -

History of the Medieval Furnishings of the Franciscan Church in Toruń During The
RIHA Journal 0233 | 30 December 2019 History of the Medieval Furnishings of the Franciscan Church in Toruń during the Reformation Period* Juliusz Raczkowski (Wersja polska zob. RIHA Journal 0232 / For Polish version see RIHA Journal 0232) Abstract The article investigates the history of the medieval interior design and furnishings of the former Franciscan Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Toruń during the Reformation period. The Franciscan Friars were brought to the Old Town of Toruń in 1239; they used the conventual complex until 1557, when it was taken over by the Protestant congregation of the City of Toruń, the former Franciscan Church becoming the major Protestant church both in Toruń and the surrounding region. In 1724, the former Franciscan complex was returned to the Observant Order, who added a number of serious alterations to the church’s interior (including the provision of eighteenth-century furnishings and altars with their retables, and the removal of an old rood screen, etc.). The article elucidates the way medieval interior design and furnishings—mural paintings, tomb slabs, the pulpit, the organ casing, and matronea—functioned in the lay area of the church when used by the Lutheran congregation. In addition, the following furnishings of the former monastic ecclesia interioris are discussed: the high altar and its retable, the medieval choir stalls, the rood screen, and the late medieval sculpture of the Crucified Christ. The analysis of the alterations added to the church’s interior demonstrates that measures undertaken when converting the church for the needs of the Protestant congregation were of a * The article was created based on the paper delivered at the international scholarly conference "The Reformation and Monasteries, Monasteries and the Reformation. -

Wilno 1585 Colloquium
Odrodzenie i Reformacja w Polsce, XLIX 2005 PL ISSN 0029-8514 Darius Petkunas (Klaipeda) Wilno 1585 Colloquium — Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania On June 14, 1585, Duke Krzysztof Radziwiłł („Piorun") (1547-1603), Palatine of Wilno (Vilnius) and Hetman of Lithuania, convoked an impor- tant meeting of theologians representing the Lutheran and Reformed Churches in Lithuania to discuss the theological understanding of the Lord's Supper, which had become an occasion of disagreement and an obstacle to further collaboration between them. The aim of the meeting was to effect a reconciliation of the parties which had agreed to and signed the Sandomierz Consensus in 1570, and to address concerns raised by the Lutherans in their Wilno convocation of 1578 because of which they had renounced the terms of the Consensus. The future of united Protestantism lay in the balance. The outcome of this meeting was to have a strong bearing on future relations between the Reformed and Lutheran Churches and the course of Protestantism in Lithuania. Historians have usually passed over this meeting with little or no comment. Prussian theologian and church historian Georg Colbe (1594- 1670), in his Episcopo-presbyterologia Prussico-Regiomontana of 1657, reports simply that the meeting was convoked by Prince Radziwiłł and that Dr. Paul Weiss of the Königsberg Faculty participated. Colbe seems not to have had the protocol before him, because he errs in stating that the meeting was held on June 13th instead of June 14th. Another short report of the colloquium is given by Prussian Historian Christoph Hartknoch (1644-1687) in his Preußische Kirchenhistoria of 1686. -
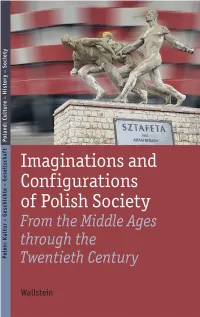
Imaginations and Configurations of Polish Society. from the Middle
Imaginations and Configurations of Polish Society Polen: Kultur – Geschichte – Gesellschaft Poland: Culture – History – Society Herausgegeben von / Edited by Yvonne Kleinmann Band 3 / Volume 3 Imaginations and Configurations of Polish Society From the Middle Ages through the Twentieth Century Edited by Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen and Tomasz Wiślicz WALLSTEIN VERLAG Gedruckt mit Unterstützung der Deutsch-Polnischen Wissenschafts- stiftung (DPWS) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Emmy Noether- Programm, Geschäftszeichen KL 2201/1-1). Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2017 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Garamond und der Frutiger Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf © SG-Image unter Verwendung einer Fotografie (Y. Kleinmann) von »Staffel«, Nationalstadion Warschau Lithografie: SchwabScantechnik, Göttingen ISBN (Print) 978-3-8353-1904-2 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2999-7 Contents Acknowledgements . IX Note on Transliteration und Geographical Names . X Yvonne Kleinmann Introductory Remarks . XI An Essay on Polish History Moshe Rosman How Polish Is Polish History? . 19 1. Political Rule and Medieval Society in the Polish Lands: An Anthropologically Inspired Revision Jürgen Heyde Introduction to the Medieval Section . 37 Stanisław Rosik The »Baptism of Poland«: Power, Institution and Theology in the Shaping of Monarchy and Society from the Tenth through Twelfth Centuries . 46 Urszula Sowina Spaces of Communication: Patterns in Polish Towns at the Turn of the Middle Ages and the Early Modern Times . 54 Iurii Zazuliak Ius Ruthenicale in Late Medieval Galicia: Critical Reconsiderations . -

Vilnius University Inga Leonavičiūtė Saint Bruno Of
VILNIUS UNIVERSITY INGA LEONAVIČIŪTĖ SAINT BRUNO OF QUERFURT AND THE MISSION OF 1009: SOURCE ANALYSIS Summary of doctoral dissertation Humanitarian sciences, history (05 H) Vilnius, 2014 Doctoral dissertation was prepared at Vilnius University in 2001–2014 Scientific supervisor: habil. dr. Edvardas Gudavičius (Vilnius University, Humanitarian Sciences, History – 05H). The dissertation is being defended at the Council of Scientific Field of History at Vilnius University: Chairman: prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilnius University, Humanitarian Sciences, History – 05H). Members: doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilnius University, Humanitarian Sciences, History – 05H); doc. dr. Mintautas Čiurinskas (The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Humanitarian Sciences, Philology – 04H); prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilnius University, Humanitarian Sciences, History – 05H); prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiauliai University, Humanitarian Sciences, History – 05H). Opponents: dr. Darius Baronas (The Lithuanian Institute of History, Humanitarian Sciences, History – 05H); doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilnius University, Humanitarian Sciences, History – 05H). The dissertation will be defended at the public meeting of the Council of Scientific Field of History in the in the 211 auditorium of the Faculty of History of Vilnius University at 3 p. m. on 11 April 2014. Address: Universiteto 7, Vilnius, Lithuania. The summary of the doctoral dissertation was distributed on 11 March 2014. A copy of the doctoral dissertation is available for review at the Library of Vilnius University. VILNIAUS UNIVERSITETAS INGA LEONAVIČIŪTĖ ŠV. BRUNONAS KVERFURTIETIS IR 1009 M. MISIJA: ŠALTINOTYRINIS ASPEKTAS Daktaro disertacijos santrauka Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) Vilnius, 2014 Disertacija rengta 2001–2014 metais Vilniaus universitete Mokslinis vadovas: habil. dr. Edvardas Gudavičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H). Disertacija ginama Vilniaus universiteto Istorijos mokslo krypties taryboje: Pirmininkas: prof. -
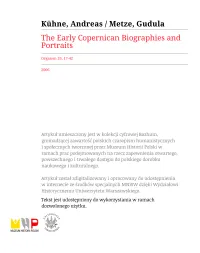
I the Reception of Copernicus As Reflected in Biographies* 1
ORGANON 35:2006 Andreas Kühne (Munich, Germany), Gudula Metze (Munich, Germany) THE EARLY COPERNICAN BIOGRAPHIES AND PORTRAITS I The reception of Copernicus as reflected in biographies* 1. Problems of the early modern Copernicus biographies The biographer of a person who was living in the 19th or 20th century is usually confronted with an abundance of material that he has to choose, sort and evaluate in order to separate substantial from insubstantial information. Nicolaus Copernicus’s early biographers, in contrast, had a rather small amount of biographical material that, in addition, sometimes seemed to be of questionable value or veracity. These meagre and dubious sources were determined by several events that mostly occurred in the first hundred years after Copernicus’s death and have a continuing influence up to now. Copernicus’s only disciple, Georg Joachim Rheticus (1514-1576), knew many details of his teacher’s life and a letter from Copernicus’s friend and Confrater Tiedemann Giese, dated July 26th, 15431, tells us that Rheticus had written a biography or at least made a draft of one shortly after Copernicus’s death. For unknown reasons, this manuscript has neither been printed nor even found. A few published biographical notes, for example, in Rheticus’s preface referring to the Ephemerides of 1551“, give us an impression of how much information about Copernicus’s life has been lost. Johannes Broscius (1581-1652) had also planned another and probably more important Copernicus biography, which he never wrote. Broscius, a doctor, theologian, astronomer at the University of Cracow and head of the Cracow observatory, travelled before 1612 to Prussia and Warmia in order to gather unknown material related to Copernicus’s life. -

Rtykuły I Materiały A
The history of the Landtag of the Duchy of Prussia in 1566 695 A RTYKUŁY I MATERIAŁY Janusz Małłek THE HISTORY OF THE LANDTAG OF THE DUCHY OF PRUSSIA IN 1566 Słowa kluczowe: Pruski sejm krajowy, Prusy książęce, Albrecht, książę Albrecht Fryderyk, stany pruskie Schlüsselwörter: Preußischen Landtag, Herzogtum Preußen, Herzog Allbrecht, Herzog Albrecht Friedrich, Preußischer Landtag Keywords: Prussian Landtag, Duchy of Prussia, Albrecht duke of Prussia, Albert Frederic Duke of Prussia, Prussian estates Introductory remarks In 1960, at Nicolaus Copernicus University in Toruń, I defended my Master’s thesis entitled “Dzieje sejmu Prus Książęcych w roku 1566” (The History of the Landtag of the Duchy of Prussia in 1566) written under the supervision of Prof. Karol Górski. A year later, I published in “Komunikaty Mazursko-Warmińskie” an extended and improved chapter III of this work devoted to the genesis of the Prussian Landtag we are interested in1. The next stage was originally to announce the publication of the following chapter of this work concerning the very course of the Landtag debates. This did not happen. It seemed to me then that a more urgent task would be to write an article about the criminal trial of the new Dukely advisors at the Landtag. Such a study appeared in print as early as 1963 also in the “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”2. The proceedings of the Lantag in the Duchy of Prussia in 1566 were different from those of the previous Landtag in Prussia. The royal commissioners, whose task was to alleviate a conflict that arose 1 J. Małłek, Geneza sejmu 1566 r. -

Yazma Miras / Written Heritage: the Image of the Polish-Lithuanian Tatars As a Transferred Stereotype in German Literature
Mieste HOTOPP-RIECKE Stephan THEILIG Institute for Caucasica, Tatarica and Turkestan Studies Germany YAZMA MIRAS / WRITTEN HERITAGE: THE IMAGE OF THE POLISH-LITHUANIAN TATARS AS A TRANSFERRED STEREOTYPE IN GERMAN LITERATURE Abstract: If we look at the subject of Islam and Eastern Europe in the context of the literatures of our countries, we encounter two paradoxes . On the one hand, there are two long-distance literatures that conveyed via translation narratives about Islam of the East into German literature . This is the Russian and Tatar literature . On the other hand, there are the near-dis- tance literatures, e .g . the Polish and Lithuanian literature, as well as in earlier times the German literature of the Baltics and Silesia . The following paradox seems worth investigating in this literary paradigm: while Tatar literature would have been able to mirror a real picture of Tatar Islam, German litera- ture has instead used almost exclusively narratives from Russian literature, often with a corresponding pejorative connotation . On the other hand, texts dealing with autochthonous Islam in Poland- Lithuania are very rarely translated into the German language . Neverthe- less, there is literature in German in this context . However, it is not written by Polish-Lithuanian Tatar, but written by German authors about them . In this article, we will concentrate on the following topics: the culture translations in texts from long-distance literatures of the Russians, short- distance literature translations from Polish and Lithuanian literature into German and the literatures originally written in German, e .g . Silesia, East Prussia and in today’s Germany concerning Tatars of Poland-Lithuania .