Mauern, Levitationen Und Leuchtende Steine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Case Study on the Two Turkısh Translatıons of Paul Auster's Cıty Of
Hacettepe University Graduate School of Social Sciences Department of Translation and Interpretation A CASE STUDY ON THE TWO TURKISH TRANSLATIONS OF PAUL AUSTER’S CITY OF GLASS İpek HÜYÜKLÜ Master’s Thesis Ankara, 2015 A CASE STUDY ON THE TWO TURKISH TRANSLATIONS OF PAUL AUSTER’S CITY OF GLASS İpek HÜYÜKLÜ Hacettepe University Graduate School of Social Sciences Department of Translation and Interpretation Master’s Thesis Ankara, 2015 iii ÖZET HÜYÜKLÜ, İpek. Paul Auster’ın Cam Kent adlı Eserinin İki Çevirisi üzerine bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015. Bu çalışmanın amacı, Paul Auster’ın Cam Kent romanının iki farklı çevirisinde çevirmene zorluk yaratacak öğelerin çevirmenler tarafından nasıl çevrildiğini Venuti’nin yerlileştirme ve yabancılaştırma kavramları ışığı altında analiz ederek çevirmenlerin uyguladıkları stratejileri tespit etmektir. Bunun yanı sıra Venuti’nin çevirmenin görünürlüğü ve görünmezliği yaklaşımları temel alınarak hangi çevirmenin daha görünür ya da görünmez olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çevirmenler için zorluk yaratan öğelerin sıklıkla kullanıldığı ve postmodern biçemiyle bilinen Paul Auster’a ait Cam Kent adlı eserin Yusuf Eradam (1993) ve İlknur Özdemir (2004) tarafından Türkçe’ye yapılan iki farklı çevirisi analiz edilmiştir. Bu eserin çevirisini zorlaştıran faktörler; özel isimler, kelime oyunları, bireydil, dilbilgisel normlar, tipografi, gönderme ve yabancı sözcükler olmak üzere yedi başlık altında toplanmış olup Cam Kent romanının iki farklı çevirisinde tercih edilen çeviri stratejileri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, Venuti’nin çevirmenin görünmezliği yaklaşımı temel alınarak hangi çevirmenin daha görünür ya da görünmez olduğunu incelemek üzere yapılmıştır. İki çevirinin karşılaştırmalı analizinin ardından, iki çevirmenin de farklı öğeler için yerlileştirme ve yabancılaştırma yaklaşımlarını bir çeviri stratejisi olarak kullandığı sonucuna varılmıştır. -

Download Article (PDF)
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 289 5th International Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2018) A Review of Paul Auster Studies* Long Shi Qingwei Zhu College of Foreign Language College of Foreign Language Pingdingshan University Pingdingshan University Pingdingshan, China Pingdingshan, China Abstract—Paul Benjamin Auster is a famous contemporary Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris in 2010, American writer. His works have won recognition from all IMPAC Award Longlist for Man in the Dark in 2010, over the world. So far, the Critical Community contributes IMPAC Award long list for Invisible in 2011, IMPAC different criticism to his works from varied perspectives in the Award long list for Sunset Park in 2012, NYC Literary West and China. This paper tries to make a review of Paul Honors for Fiction in 2012. Auster studies, pointing out the achievement which has been made and others need to be made. II. A REVIEW OF PAUL AUSTER‘S LITERARY CREATION Keywords—a review; Paul Auster; studies In 1982, Paul Auster published The Invention of Solitude which reflected a literary mind that was to be reckoned with. I. INTRODUCTION It consists of two sections. Portrait of an Invisible Man, the first part, is mainly about his childhood in which there is an Paul Benjamin Auster (born February 3, 1947) is a absence of fatherly love and care. His memory of his growth talented contemporary American writer with great is full of lack of fatherly attention: ―for the first years of my abundance of voluminous works. -

An Analysis Of" City of Glass" by Paul Auster in Terms of Postmodernism
International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 5, Issue 1, April 2017, p. 478-486 Received Reviewed Published Doi Number 17.01.2017 16.02.2017 24.04.2017 10.18298/ijlet.1659 AN ANALYSIS OF CITY OF GLASS BY PAUL AUSTER FROM A POSTMODERNIST PERSPECTIVE1 Mehmet Cem ODACIOĞLU 2 & Chek Kim LOI3 & Fadime ÇOBAN4 ABSTRACT This study analyzes City of Glass, a postmodernist detective novella (or anti-detective) of the New York Trilogy by Paul Auster in terms of postmodernist elements and techniques such as metafiction, parody, intertextuality, irony. In doing so, some information about Auster’s life and the plot of the work are also offered to the reader to make the analysis more concrete. Last but not least, this study is also thought to be useful for students enrolled in English Language and Literary Departments for them to understand the movement of postmodernism. Key Words: City of Class, postmodernist detective fiction, anti-detective, metafiction, parody, irony, intertextuality, pastiche. 1.Short Biography of Paul Auster Paul Auster is an American-Jewish essayist, novelist, translator, poet, screenwriter and memoirist, who was born in Newark, New Jersey on February 3, 1947. Auster lived in a middle class family and spent some of his childhood in the Newark suburbs of South Orange and Maplewood. However, in 1959, his family moved into a large Tudor house. Auster's uncle, Allen Mandelbaum was a translator and left his books for him to read there when he decided to make a journey to Europe. Auster read all of these books which encouraged him to be interested in writing and in literature. -

“Then Catastrophe Strikes:” Reading Disaster in Paul Auster's Novels and Autobiographies « Then Catastrophe Strikes
Université Paris-Est Northwestern University École doctorale CS – Cultures et Sociétés Weinberg College of Arts & Sciences Laboratoire d’accueil : IMAGER Institut des Comparative Literary Studies Mondes Anglophone, Germanique et Roman, EA 3958 “T HEN CATASTROPHE STRIKES :” READING DISASTER IN PAUL AUSTER ’S NOVELS AND AUTOBIOGRAPHIES « THEN CATASTROPHE STRIKES » : LIRE LE DÉSASTRE DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE ET AUTOBIOGRAPHIQUE DE PAUL AUSTER Thèse en cotutelle présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur de l’Université de Paris- Est, et de Doctor of Philosophy in Comparative Literature de Northwestern University, par Priyanka DESHMUKH Sous la direction de Mme le Professeur Isabelle ALFANDARY et de M. le Professeur Samuel WEBER Jury Mme Isabelle ALFANDARY , Professeur à l’Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle (Directrice de thèse) Mme Sylvie BAUER , Professeur à l’Université Rennes-2 (Rapporteur) Mme Christine FROULA , Professeur à Northwestern University (Examinatrice) Mme Michal GINSBURG , Professeur à Northwestern University (Examinatrice) M. Jean-Paul ROCCHI , Professeur à l’Université Paris-Est (Examinateur) Mme Sophie VALLAS , Professeur à l’Université d’Aix-Marseille (Rapporteur) M. Samuel WEBER , Professeur à Northwestern University (Co-directeur de thèse) In memory of Matt Acknowledgements I wish I had a more gracious thank-you for: Mme Isabelle Alfandary , who, over the years has allowed me to experience untold academic privileges; whose constant and consistently nurturing presence, intellectual rigor, patience, enthusiasm and invaluable advice are the sine qua non of my growth and, as a consequence, of this work. M. Samuel Weber , whose intellectual generosity, patience and understanding are unparalleled, whose Paris Program in Critical Theory was critical in more ways than one, and without whose participation, the co-tutelle would have been impossible. -

Download the Story of My Typewriter, Paul Auster, Sam Messer, D.A.P
The story of my typewriter, Paul Auster, Sam Messer, D.A.P., 2002, 1891024329, 9781891024320, 63 pages. This is the story of Paul Auster's typewriter. The typewriter is a manual Olympia, more than 25 years old, and has been the agent of transmission for the novels, stories, collaborations, and other writings Auster has produced since the 1970s, a body of work that stands as one of the most varied, creative, and critcally acclaimed in recent American letters. It is also the story of a relationship. A relationship between Auster, his typewriter, and the artist Sam Messer, who, as Auster writes, "has turned an inanimate object into a being with a personality and a presence in the world." This is also a collaboration: Auster's story of his typewriter, and of Messer's welcome, though somewhat unsettling, intervention into that story, illustrated with Messer's muscular, obsessive drawings and paintings of both author and machine. This is, finally, a beautiful object; one that will be irresistible to lovers of Auster's writing, Messer's painting, and fine books in general.. DOWNLOAD http://bit.ly/1bs6nlL Hand to Mouth A Chronicle of Early Failure, Paul Auster, Aug 1, 2003, Biography & Autobiography, 169 pages. From the streets of Manhattan to Paris, a poignant memoir explains a series of ingenious and farfetched attempts to survive on next to no money, showing both the humor and .... Office Collectibles 100 Years of Business Technology, Thomas A. Russo, Jun 1, 2000, , 224 pages. This book presents the most comprehensive collection of antique and collectible office technology that has appeared to date. -

In Search of Self: Explorations of Identity in the Work of Paul Auster
In Search of Self: Explorations of Identity in the Work of Paul Auster THESIS Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in the Department of English at Rhodes University, Grahamstown, South Africa by Andrew Edward van der Vlies 1998 II ABSTRACT Paul Auster is regarded by some as an important novelist. He has, in a relatively short space of time, produced an intriguing body of work, which has attracted comparatively little critical attention. This study is based on the premise that Auster's art is the record of an entertaining, intelligent and utterly serious engagement with the possibilities of conceiving of the identity of an individual subject in the contemporary, late-twentieth century moment. This study, focussing on Auster's novels, but also considering selected poetry and critical prose, explores the representation of identity in his work. The short Foreword introduces Paul Auster and sketches in outline the concerns of the study. Chapter One explores the manner in which Auster's early (anti-),detective' fiction develops a concern with identity. It is suggested that Squeeze Play, Auster's pseudonymous 'hard-boiled' detective thriller, provided the author with a testing ground for his subsequent appropriation and subversion of the detective genre in The New York Trilogy. Through a close consideration of City of Glass, and an examination of elements in Ghosts, it is shown how the loss of the traditional detective's immunity, and the problematising of strategies which had previously guaranteed him access to interpretive and narrative closure, precipitates a collapse which initiates an interrogation of the nature and construction of ideas about individual identity. -

Blue Gum 2 Complete
Blue Gum, No. 2, 2015, ISSN 2014-21-53, Observatori: Centre d’Estudis Australians, Australian Studies Centre, Universitat de Barcelona A Glimpse at Paul Auster and Jorge L. Borges through the Tinted Glass of Quantum Theory Myriam M. Mercader Varela Copyright©2015 Myriam M. Mercader Varela. This text may be archived and redistributed both in electronic form and in hard copy, provided that the author and journal are properly cited and no fee is charged. Abstract . The works of Jorge Luis Borges and Paul Auster seem to follow the rules of Quantum Theory. The present article studies a number of perspectives and coincidences in their oeuvre, especially a quality we have named “inherent ubiquity” which highlights the importance and of authorship and identity and the appearance of blue stones to mark the doors leading to new dimensions on the works of both authors. Keywords: Jorge L. Borges, Paul Auster, Authorship and Identity, Quantum Theory, Inherent Ubiquity, Blue Stones. Quantum Theory has ruled the scientific milieu for decades now, but it is not only for science that Quantum Theory makes sense. Literary critics have surrendered to its logic as a unique way to interpret literature because the world we live and write in is one and the same; it forms part of a whole. Although this article does not aim to analyze Quantum Theory, we would like to make a short summary of its basis in order to shape the arena we are stepping into. In 1982 a famous experiment undertaken by Alain Aspect proved that a very large percentage of the polarization angles of photons emitted by a laser beam was identical, which meant that particles necessarily communicate their position so that each photon’s orientation can parallel that of the one that serves as its pair. -
Chronique D'hiver
Extrait de la publication “LETTRES ANGLO-AMÉRICAINES” série dirigée par Marie-Catherine Vacher LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS Trente ans après L’Invention de la solitude, Paul Auster pose sur son existence le regard du sexagénaire qu’il est devenu. Bien loin, cependant, du journal intime ou du classique récit autobiographique, cette Chronique d’hiver aborde la méditation sur la fuite du temps sous l’angle du compagnonnage que tout individu entretient avec son propre corps. C’est en effet de respiration, de sensation, de jouissance ou de souffrance, d’épiphanies charnelles ou de confrontations plus ou moins traumatiques avec la matière du monde qu’il est question à travers l’évocation, à la deuxième personne, d’un simple petit Américain du nom de Paul Auster, né dans l’immédiat après-guerre, et requis d’apprivoiser les espaces et le temps qui lui ont été impartis. Dans ces pages aussi sincères que retenues, Paul Auster se décrit moins en littérateur qu’en acteur convoqué sur la scène troublée de l’existence pour y incarner, à son tour, toute l’ardeur des passions humaines. De cet homme-cicatrice dont le corps exulte ou somatise, de ce fils hanté par la mort prématurée de son père et tourmenté par le destin chaotique de sa mère, de l’heureux citoyen de Brooklyn, époux et père aujourd’hui comblé, de cet héritier d’une lointaine Europe, amateur de baseball, fumeur invétéré et romancier fécond, de cet homme, enfin, qui souffre de ne pouvoir ou de ne savoir pleurer, le lecteur entendra ici le “grain de la voix” surgissant du savant puzzle où se déconstruit toute représentation univoque du moi afin que se produise, sous le signe d’une humanité partagée, la plus loyale des rencontres. -

Spaces of Memory: Performing Identity In
FACULTADE DE FILOLOXÍA MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS E AS SÚAS APLICACIÓNS Spaces of Memory: Performing Identity in Travels in the Scriptorium Student: Beatriz Solla Vilas Advisor: Eduardo Barros Grela TFM June 2019 V.º B.º Facultade de Filoloxía Máster en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións Beatriz Solla Vilas 2 Table of Contents Abstract ............................................................................................................................. 3 Keywords .......................................................................................................................... 3 1. Introduction ............................................................................................................. 4 2. Context .................................................................................................................... 9 3. Theoretical Framework ......................................................................................... 12 4. Deconstructing Identity through Spaces and Memory .......................................... 15 5. Memory ................................................................................................................. 18 5.1 Writing Identity through Memory ................................................................... 18 5.2 Mr. Blank and the Rhizome: Multiplicity and Decentering ............................ 22 5.3 Spaces of Empathy ........................................................................................... 27 -
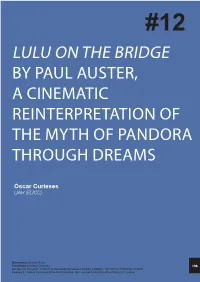
Lulu on the Bridge by Paul Auster, a Cinematic Reinterpretation of the Myth of Pandora Through Dreams
#12 LULU ON THE BRIDGE BY PAUL AUSTER, A CINEMATIC REINTERPRETATION OF THE MYTH OF PANDORA THROUGH DREAMS Óscar Curieses UAH (EUCC) Illustration || Beatriz Simón Translation || Sharyn Cameron 198 Article || Received on: 31/06/2014 | International Advisory Board’s suitability: 12/11/2014 | Published: 01/2015 License || Creative Commons Attribution Published -Non commercial-No Derivative Works 3.0 License. 452ºF Abstract || This article explores Paul Auster’s reinterpretation of the character of Pandora in the film Lulu on the Bridge (1998). Auster incorporates some features from Frank Wedekind and Georg Wilhelm Pabst’s previous versions, but ultimately transcends in order to connect them with elements of Hesiod´s original myth through dreams. Keywords || Rewriting | Film Adaptation | Rewriting | Comparative Literature | Myths and Symbols | Cinema and Dreams 199 0. Dreams: Form, meaning, narrative NOTES Without a doubt, the work that has had the most influence on 1 | Jung accepts the Freudian investigating the dream experience throughout the Western world idea that the symbol refers to a hidden meaning, but is Interpretation of Dreams (1899) by Sigmund Freud. The index that this meaning is not #12 (2015) 198-213. 452ºF. of this work reveals the great detailed efforts and the rigor of his connected to the repression theories, many of which are still valid today, regarding his methods of of the subject. For Jung, the symbolism comes from interpretation and function. This case does not concern the defence or the psyche when you delve opposition to one of the Austrian philosopher’s central theories which deep into the unknown proposes that the person who dreams releases repressed elements and the indescribable. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Intertextualität im Prosawerk Paul Austers Verfasserin Denise Fuchs angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl: A-393 Studienrichtung: Vergleichende Literaturwissenschaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachleitner 2 Danksagung Die vorliegende Diplomarbeit wurde am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Wien durchgeführt. Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Norbert Bachleitner für sein Engagement. Darüber hinaus möchte ich meinen Eltern danken, die mir das Studium ermöglichten und mich fortwährend unterstützten. Zudem möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. 3 4 INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG ………………………………………………………………………..7 2. INTERTEXTUALITÄT ……………………………………………………………...9 2.1. Der Ursprung von Intertextualität ……………………………………………..... 9 2.2. Formen von Intertextualität …………………………………………………..... 12 3. WIEDERKEHRENDE MOTIVE IM WERK PAUL AUSTERS …………………. 18 3.1. Die Identitätskrise …………………………………………………………....... 20 3.2. Die Suche …………………………………………………………………….... 21 3.3. Die Stadt ……………………………………………………………………...... 23 3.4. Das Judentum ………………………………………………………………….. 24 3.5. Der Zufall …………………………………………………………………........ 25 4. INTERTEXTUALITÄT IN DEN ROMANEN PAUL AUSTERS ………................26 4.1. Die Einsamkeit, der Künstler und die Kunst ……………………………...........26 4.2. Schelmenroman und Luftmensch ………………………………………………33 4.3. Vater und Sohn …………………………………………………………………38 4.4. Die Macht -

An Interview with Paul Auster
Revista de Estudios Norteamericanos, nº 12 (2007), pp. 57-67 SMOKE AND ILLUSIONS: AN INTERVIEW WITH PAUL AUSTER JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ Universidad de Cantabria When Paul Auster received the Príncipe de Asturias Award in October 2006 in Oviedo (Spain) he spoke about two fundamental needs: his own need to tell stories and “the universal craving for stories” shared by all humankind. In fact, he said, people need stories “as desperately as they need food, and however the stories might be presented –whether on a printed page or on a television screen– it would be impossible to imagine life without them.” In this interview, which took place a few days after this speech, Auster addresses his relationship not with written stories but with another type of stories he has always liked, films. A novelist, poet, critic and editor, Auster’s relationship with cinema comes from his apprenticeship years, when he wrote film reviews and even scripts for silent films, like the ‘written films’ described in his 2002 novel The Book of Illusions. His short story “Auggie Wren’s Christmas Story” led to his films with Wayne Wang (Smoke and Blue in the Face, 1995), which gave him the experience to direct on his own Lulu on the Bridge (1998) and the recent The Inner Life of Martin Frost (2007). Congratulations on your Príncipe de Asturias Award. You mentioned in Oviedo that you have been attracted to film-making since your student days. Apparently both Wim Wenders and you tried to join the Institute des Hautes Études Cinématographiques in Paris, but neither of you was accepted.