GCP Oldenburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
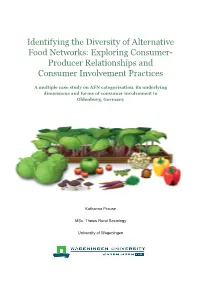
Identifying the Diversity of Alternative Food Networks: Exploring Consumer- Producer Relationships and Consumer Involvement Practices
Identifying the Diversity of Alternative Food Networks: Exploring Consumer- Producer Relationships and Consumer Involvement Practices A multiple case study on AFN categorisation, its underlying dimensions and forms of consumer involvement in Oldenburg, Germany Katharina Prause MSc. Thesis Rural Sociology University of Wageningen Identifying the Diversity of Alternative Food Networks: Exploring Consumer- Producer Relationships and Consumer Involvement Practices A multiple case study on AFN categorisation, its underlying dimensions and forms of consumer involvement in Oldenburg, Germany 28 June 2016 Wageningen University – Department of Social Science MSc. Program: MSc. Organic Agriculture Specialisation: Consumer and Market MSc. Thesis Rural Sociology Thesis Code: RSO-80436 Registration number: 900217670040 Student: Katharina Prause E-Mail: [email protected] Supervisor: Dr.ir. D. Roep Examiner: Prof.dr.ir. J.S.C. Wiskerke MSc. Thesis Abstract The heterogeneity of alternative food networks is increasing. First generation AFNs are linked to direct sales, whereas second generation AFNs focus more on the consumer roles within AFNs. Those AFNs can be categorised in many ways based on different theories and characteristics. Over time AFNs evolve and adapt and it is questionable if those categories still apply. Therefore the aim of this thesis is to investigate AFNs in order to gain more insight in AFN categorisation. This thesis seeks to find an answer on how consumer-producer relationships in operational AFNs in Oldenburg can be categorised. This is done by an inventory, a preliminary categorisation, an in-depth analysis of AFN characteristics based on interviews and observations and a final cate- gorisation. It is complemented with an exploration of the underlying dimensions ‘proxi- mity’, ‘type of interaction’ and ‘type of exchange’ as well as consumer involvement practices within AFNs in Oldenburg. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Die Drosten Und Amtmänner Des Alten Amtes Apen Und Westerstede
Die Drosten und Amtmänner des alten Amtes Apen und Westerstede Die Drosten und Amtmänner des alten Amtes Apen - Westerstede Nach archivalischen Quellen zusammengestellt von Heinrich Borgmann, Westerstede 15. November 1957 Unter Verwendung von Ratsprotokollen um die Bürgermeister und Gemeindedirektoren der Gemeinde Apen ab 1931 ergänzt und erweitert, sowie in verschiedenen Abschnitten durch Hin- weise in Kursivschrift aktualisiert am 10.05.1983 von Karl Janßen, Apen und fortgeführt von Willi Epkes, Apen im Januar 2002 Die Drosten und Amtmänner des alten Amtes Apen - Westerstede 1. Der Kreis Ammerland einst und jetzt Zur Zeit Karls des Großen gab es um 800 n. Chr. in unserer engeren Heimat schon einen "pagus Ameri" oder den Gau Ammerland, dessen Grenzen bestimmt waren durch die ihn im Norden, Süden, Osten und Westen umschließenden Randmoore. Eine kartenmäßig genau festgelegte Grenzlinie, wie wir sie heute kennen, hat es damals noch nicht gegeben. Ihren vermutlichen Verlauf hat Sello in seinem Atlas über die territoriale Entwicklung des Herzogtums Oldenburg an- gezeigt. Danach gehörten derzeit zum Gau Ammerland 1. das Gebiet der heutigen Stadt Oldenburg links der Hunte und Haaren sowie der Raum der früheren Gemeinde Ohmstede, -1- 2. ein Teil der Gemeinde Jade westlich des Flusses gleichen Namens, 3. ferner die auch heute noch im wesentlichen den Bestand des Kreises Am- merland bildenden Gemeinden Rastede, Wiefelstede mit Conneforde und Spohle, Zwischenahn, Edewecht, Westerstede mit Bredehorn und Jührden, Apen ohne Vreschen Bokel. Im Süden bildeten das Godensholter Tief und die Vehne die Grenze des Gaues gegen den Lerigau, das spätere Münsterland. 1531 wurde die infolge der Reformation aufgehobene Johanniterkommende Bredehorn mit dem Klosterhofe Jührden politisch zu Bockhorn gelegt. -

Hebammenliste 2019
Hebammenliste Landkreis Cloppenburg Berufliche Kontakt Leistungen Anmerkung Niederlassung Hebammenpraxis Aufgebauer, Doris Frühe Hilfen, Geburtsvorbereitung, Hilfe bei Haselünne Mobil: 0171/6984759 Schwangerschaftsbeschwerden, Rückbildungskurse, Dammstraße 20 E-Mail: [email protected] Wochenbettbetreuung, Ernährungsberatung/ 49740 Haselünne/ Einführung der Beikost, Herzton- u. Wehenmessung Raum Löningen Bösel, Cappeln, Bohlken, Katja Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Cloppenburg, Emstek, Mobil: 0172-4286805 Schwangerenbetreuung / Hilfe bei Beschwerden, Garrel, Molbergen E-Mail: [email protected] Wochenbettbetreuung Barßel, Saterland Bothur, Heike Schwangerenbetreuung / Hilfe bei Beschwerden, Tel: 04952-9249963 Wochenbettbetreuung Mobil: 0160-2666483 E-Mail: [email protected] Cappeln, Broermann, Laura Rückbildungskurse, Schwangerenbetreuung / Hilfe bei Cloppenburg, Emstek, Mobil: 01590-3760628 Beschwerden, Wochenbettbetreuung Garrel, Molbergen E-Mail: [email protected] Sonstige Leistungen: Reikibehandlungen auf Anfrage Bösel, Garrel Cobold, Ruth Schwangerenbetreuung / Hilfe bei Beschwerden, Tel: 04407-20686 Wochenbettbetreuung Mobil: 0152-23176117 E-Mail: [email protected] Essen, Lastrup, Ebeling, Manuela Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Löningen, Bevern, Tel: 05431-900964 Schwangerenbetreuung / Hilfe bei Beschwerden, Hemmelte Mobil: 0176-21634109 Wochenbettbetreuung E-Mail: info@lichtblick-die- Hebammenpraxis.de St. Josefs-Hospital Eropkin, Irina Wochenbettbetreuung ausschließlich im Krankenhausstr. -

ISEK Friesoythe 2030 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Für Die Stadt Friesoythe Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
ISEK Friesoythe 2030 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Friesoythe Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen Bearbeitung Grontmij GmbH, Bremen Impressum Auftraggeber: Stadt Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) Auftragnehmer: Grontmij GmbH Postfach 34 70 17 28339 Bremen Friedrich-Mißler-Straße 42 28211 Bremen Bearbeitung: Dr. Monika Nadrowska Dipl.-Ing. Horst Heinicke M. Sc. Simone Irmscher Bearbeitungszeitraum: März 2014 – September 2014 www.grontmij.de Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung und Übersicht über den Planungs- und Beteiligungsprozess 7 1.1 Die Aufgabenstellung 7 1.2 Die Bausteine der Bürgerbeteiligung 9 2 Planungsvorgaben und Rahmenbedingungen 11 2.1 Lage im Raum und Gliederung der Stadt 11 2.2 Übergeordnete Planungen, regionale Zusammenarbeit 14 2.3 Demographische Entwicklung 15 2.4 Historische Entwicklung der Stadt 19 2.5 Überblick über den Stand der kommunalen Planungen 21 3 Bestandsanalyse: Stärken, Schwächen und Potenziale 22 3.1 Einzelhandel und Innenstadt als Versorgungszentrum 22 3.2 Wohnen 27 3.3 Arbeit und Wirtschaft 32 3.4 Verkehr 39 3.5 Soziale Infrastruktur und Bildung 42 3.6 Energie und Umwelt 44 3.7 Kultur, Sport, Freizeit und Erholung 48 4 Ziele und Leitbilder der Stadtentwicklung 52 4.1 Strategische Entwicklungsziele 52 4.2 Leitbild „Friesoythe 2030“ 56 5 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 57 5.1 Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung 57 5.2 Stadt zum Fluss – Erlebbarkeit der Soeste 58 5.3 Innenstadtentwicklung 60 6 Handlungskonzept 61 6.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen 61 6.2 Maßnahmenkatalog 63 0310-13-025 x 140924_Friesoythe_ISEK_Bericht.docx Seite III Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Eindrücke von der ersten Bürgerinformation am 02.04.2014 9 Abbildung 2: Übersicht über den Beteiligungsprozess zur parallelen Erarbeitung der Vorbereitenden Untersuchungen und des ISEK Friesoythe 10 Abbildung 3: Stadt Friesoythe im Landkreis Cloppenburg (Quelle: Wikipedia, o. -

Presseinfo-Busverkehr-Ammerland
Presseinformation /19 9. Dezember 2019 Regional- und Stadtbusverkehr zwischen Ammerland-Oldenburg verbessert Region wächst enger zusammen Oldenburg. Mehr Busse von und nach Oldenburg sind das Herzstück eines erheblich aufgewerteten Busverkehrs zwischen dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg. Das verdichtete Verkehrsangebot, das am 15. Dezember 2019 startet , haben der Landkreis Ammerland und die Stadt Oldenburg gemeinsam mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) und den Verkehrsunternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG),Firma Hanekamp Busreisen GmbH, Firma Gerdes Reisen und Firma Bruns GmbH erarbeitet. Mit der Unterzeichnung der Verträge im August hatten der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede und Wiefelstede, die Stadt Oldenburg und der ZVBN die Umsetzung des kombinierten Regional- und Stadtbusverkehrs Ammerland-Oldenburg auf den Weg gebracht. Heute trafen sich alle Beteiligten am Knotenpunkt der neuen Verbindungen in Oldenburg und reisten im Rahmen einer „Sternfahrt“ eine Woche vor Betriebsaufnahme probeweise mit der Linie 309 aus Friedrichsfehn, der Linie 330 aus Wiefelstede, der Linie 340 aus Rastede sowie der Linie 350 aus Bad Zwischenahn an. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann begrüßte die ersten „Pendler“ bei der pünktlichen Ankunft und freut sich über gleich mehrere positive Effekte: „Das neue Busangebot ist eine gute Alternative zum Auto. Mit dem kombinierten Regional- und Stadtbusverkehr Ammerland-Oldenburg verbessern wir das Angebot des ÖPNV ganz erheblich und tragen zur Reduktion des Schadstoffausstoßes in und um Oldenburg und somit zum Klimaschutz bei“, sagt Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Für Landrat Jörg Bensberg beginnt quasi eine neue Zeitrechnung: „Das deutlich erweiterte Angebot zwischen dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg ist für den gesamten Verbundraum Bremen/Niedersachsen einmalig und ein echter Quantensprung. -

Heft Freisprechung W19.Indd
Lehrlingsfreisprechung Winter 2019 Samstag, 9. Februar 2019 in der Stadthalle Cloppenburg Programm der Freisprechungsfeier am 9. Februar 2019 Begrüßung durch den Kreishandwerksmeister Günther Tönjes Grußworte: Sven Stratmann, Bürgermeister der Gemeinde Friesoythe OStDir. Marlies Bornhorst-Paul, Berufsbildende Schulen Friesoythe Verleihung des August-Bruns-Preises Freisprechung der Lehrlinge Auszeichnungen Aushändigung der Gesellenbriefe Musik: Stimmenbar Die Fotos der Freisprechungsfeier stehen im Internet ab dem 13. Februar 2019 zum freien Download bereit unter: www.handwerk-cloppenburg.de Freisprechung Winter 2018/2019 der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg - bestandene Gesellen- bzw. Abschlussprüfungen - insgesamt 204 Gesellinnen und Gesellen in 18 Ausbildungsberufen Innung Sanitär-, Heizungs-, Klima- u. Klempnertechnik Cloppenburg Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs– und Klimatechnik Max Albrecht, Garrel kl. Stüve Heizung-Sanitär GmbH, Garrel Pascal Benkendorf, Cloppenburg Wulfekuhl GmbH & Co. KG, Hemmelte Marcel Brake, Friesoythe HELPO Sanitär- und Heizungsinstallations GmbH, Sedelsberg Jannis Brouwer, Großenkneten-Bissel Ludger Elberfeld GmbH, Bösel Pascal Martin Chukwudelunzu, Cloppenburg Peter Kampe Heizung, Sanitär und Lüftung, Cloppen- burg Jens Dänekamp, Barßel Bahlmann GmbH, Barßel Christian Gövert, Lastrup Wulfekuhl GmbH & Co. KG, Lastrup - Hemmelte Emanuel Kisselev, Molbergen Klaus Olliges GmbH, Molbergen - Peheim Tobias Klaas, Lastrup Wulfekuhl GmbH & Co. KG, Lastrup - Hemmelte Robert Knuck, Lindern Peter Stammermann, -

20120817 Adressverzeichnis J-M OL-LD
Kreis Oldenburg- Anschriftenverzeichnis Stand 17.08.12 L./Delmenhorst Vereinsnr. Vereinsname Typ Name Strasse Plz Ort Telefon Privat Mobil Email 1075020 Adelheider TV e.V. Juniorenfußball Werner Baier Wildeshauser Landstr. 72 27777 Ganderkesee 04222-941282 015202452200 [email protected] 1075203 SV Atlas Delmenhorst e.V. Juniorenfußball Erhard Borrmann Kastanienplatz 19 27751 Delmenhorst 04221-42633 0162-2066675 [email protected] 1075205 SV Baris Delmenhorst e.V. Juniorenfußball Önder Caki Mörikestr. 11 B 27753 Delmenhorst 04221-15319 017664861096 [email protected] 1075210 Borussia Delmenhorst e.V. Juniorenfußball Jörg Schüßler Auf dem Streek 42 27753 Delmenhorst 0175-2050974 [email protected] 1075220 Delmenhorster BV v.1912 e.V. Juniorenfußball Dirk Musiol Hohe Wende 7b 27753 Delmenhorst 04221-8500330 0176-36138592 [email protected] 1075230 Delmenhorster TB v.1875 e.V. Juniorenfußball Jens Düßmann An der Riede 101 27751 Delmenhorst 04221-87371 [email protected] 1075232 SV Hicretspor Delmenhorst e.V. Juniorenfußball Murat Kalmis Fröbelstr. 17 27749 Delmenhorst 04221-65612 0172-4373476 [email protected] 1075250 TV Jahn Delmenhorst e.V. Juniorenfußball Nadine Bayer Blücherweg 43a 27755 Delmenhorst 04221-2839777 0152/53738468 [email protected] 1075360 TUS Hasbergen v.1921 e.V. Juniorenfußball Roland Bonk Friesenstr. 46 27751 Delmenhorst 04221-53530 0162-1383679 [email protected] 1075380 TUS Heidkrug v.1919 e.V. Juniorenfußball Jens Hiller Bürgerkampweg 26 27751 Delmenhorst 0176 - 13918205 1075385 SV Turabdin e.V. Juniorenfußball Suleymann Celik Victoriastr. 4 27749 Delmenhorst 04221-52795 0176 22731633 1080020 SV Achternmeer e.V. Juniorenfußball Armin Raschen Am Ring 8 26203 Wardenburg 04407-6576 0160-94629195 [email protected] 1080040 Ahlhorner SV v.1921 e.V. -

Sixth Periodical Report Presented to the Secretary General of the Council of Europe in Accordance with Article 15 of the Charter
Strasbourg, 19 February 2018 MIN-LANG (2018) PR 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Sixth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter GERMANY Sixth Report of the Federal Republic of Germany pursuant to Article 15 (1) of the European Charter for Regional or Minority Languages 2017 3 Table of contents A. PRELIMINARY REMARKS ................................................................................................................8 B. UPDATED GEOGRAPHIC AND DEMOGRAPHIC INFORMATION ...............................................9 C. GENERAL TRENDS..........................................................................................................................10 I. CHANGED FRAMEWORK CONDITIONS......................................................................................................10 II. LANGUAGE CONFERENCE, NOVEMBER 2014 .........................................................................................14 III. DEBATE ON THE CHARTER LANGUAGES IN THE GERMAN BUNDESTAG, JUNE 2017..............................14 IV. ANNUAL IMPLEMENTATION CONFERENCE ...............................................................................................15 V. INSTITUTE FOR THE LOW GERMAN LANGUAGE, FEDERAL COUNCIL FOR LOW GERMAN ......................15 VI. BROCHURE OF THE FEDERAL MINISTRY OF THE INTERIOR ....................................................................19 VII. LOW GERMAN IN BRANDENBURG.......................................................................................................19 -

Bekanntmachungen
Gemeinsame Wahlbekanntmachung Aufgrund §§ 16 und 45 a des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) wird für die am 11. September 2011 stattfindenden Kommunalwahlen (Kreiswahl und Gemeindewahlen sowie Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters in den Gemeinden Apen und Rastede) bekannt gemacht: 1. Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter a) in den Kreistag des Landkreises Ammerland 46 Abgeordnete b) in den Gemeinderat der Gemeinde Apen 28 Ratsmitglieder in den Gemeinderat der Gemeinde Bad Zwischenahn 36 Ratsmitglieder in den Gemeinderat der Gemeinde Edewecht 34 Ratsmitglieder in den Gemeinderat der Gemeinde Rastede 34 Ratsmitglieder in den Stadtrat der Stadt Westerstede 34 Ratsmitglieder in den Gemeinderat der Gemeinde Wiefelstede 30 Ratsmitglieder. 2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche (§ 7 NKWG) a) für die Kreiswahl im Landkreis Ammerland 3 Wahlbereiche I Stadt Westerstede und Gemeinde Apen II Gemeinden Bad Zwischenahn und Edewecht III Gemeinden Rastede und Wiefelstede, b) für die Gemeindewahl sowie die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters in der Gemeinde Apen 1 Wahlbereich c) für die Gemeindewahl in der Gemeinde Bad Zwischenahn 2 Wahlbereiche I Bauerschaften Bad Zwischenahn, Elmendorf, Helle, Kayhausen, Rostrup I, Rostrup II, Specken II Bauerschaften Aschhausen, Bloh, Dänikhorst, Ekern, Kayhauserfeld, Ofen, Ohrwege, Petersfehn I, Petersfehn II, Wehnen, Westerholtsfelde. d) für die Gemeindewahl in der Gemeinde Edewecht 2 Wahlbereiche I Ortschaften Friedrichsfehn, Wildenloh, Jeddeloh I, Jeddeloh II, Kleefeld, Klein Scharrel, Portsloge II Ortschaften Husbäke, Nord-Edewecht I, Nord-Edewecht II, Osterscheps, Süddorf, Süd-Edewecht, Westerscheps, Wittenberge. e) für die Gemeindewahl sowie die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters in der Gemeinde Rastede 1 Wahlbereich f) für die Gemeindewahl in der Stadt Westerstede 2 Wahlbereiche I Stadtgebiet Westerstede einschl. -

Der Gemeinden Rastede, Wiefelstede, Bad Zwischenahn Und Der Stadt Westerstede
Gemeinsame B E K A N N T M A C H U N G der Gemeinden Rastede, Wiefelstede, Bad Zwischenahn und der Stadt Westerstede Planfeststellungsverfahren für den Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochter- sen, Abschnitt 2 von der A 29 bei Jaderberg bis zur B 437 bei Schwei (Bau-km 200+000 bis Bau-km 222+450) I. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg hat für das o. g. Vorhaben die Durchführung eines Planfest- stellungsverfahrens nach den §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in Verbindung mit den §§ 15 bis 27 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, beantragt. Für das Vorhaben besteht eine gesetzlich festgelegte Pflicht zur Durchführung einer Umweltver- träglichkeitsprüfung gemäß § 6 UVPG i.V.m. Anlage 1, Nr. 14.3 (Bau einer Bundesautobahn). Für das Straßenbauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz- maßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Rastede (Gemeinde Rastede), Jade (Gemeinde Jade), Großenmeer und Strückhausen (Gemeinde Ovelgönne), Schwei (Gemeinde Stadland) sowie Varel (Stadt Varel) beansprucht. Darüber hinaus sind folgende Gemeinden durch Lärmzuwachs im nachgeordneten Straßennetz be- troffen: Stadt Brake (Unterweser), Gemeinde Butjadingen, Stadt Elsfleth, Gemeinden Filsum und Nortmoor (Samtgemeinde Jümme), Stadt Leer, Gemeinde Uplengen, Stadt Westerstede, Ge- meinde Bad Zwischenahn, Gemeinde Wiefelstede. Die vorliegende Planung umfasst den Neubau der Küstenautobahn A 20 im Abschnitt 2 zwischen der A 29 bei Jaderberg und der B 437 bei Schwei. Die Baustrecke beginnt östlich des geplanten Autobahnkreuzes A 20/A 29, umfährt zunächst in einem Linksbogen, gefolgt in einem Rechtsbogen ein Waldgebiet bei Gut Hahn, um dann in einer relativ gestreckten Linienführung Richtung Osten zu verlaufen. -

The Economic Impact of Different Foot-And-Mouth Disease Control Strategies in Northwest Germany – a Pilot Study
Wageningen University & Research Centre Department of Social Sciences – Business Economics Group MSc Thesis – Management Studies BEC-80430 in the Double Degree programme on Management, Economics and Agriculture and Food Consumer Studies & Economics (Wageningen UR) (University of Bonn) The economic impact of different foot-and-mouth disease control strategies in northwest Germany – a pilot study Submitted by Thomas G. Böcker Student-ID (Wageningen): 890726077020 Student-ID (Bonn): 2231932 Submitted on 29th January 2015 1st examiner: Dr. Helmut Saatkamp (Wageningen UR) 2nd examiner: Prof. Dr. Robert Finger (University of Bonn) i ABSTRACT In case of an outbreak of foot-and-mouth disease (FMD) veterinary authorities have to decide whether a culling or a vaccination strategy shall be applied for controlling disease. In Germany, the last outbreak was in the late 80’s and little is known about the economic consequences of different mitigation strategies. For this reason, a static epidemiological and economic model was created using geo-reference data on municipality level. The model needs epidemiological input about infected premises, the size of movement re- striction zones and the duration of epidemic events. FMD epidemics for two animal dense regions in northwest Germany, the Jade-Weser region and the County of Grafschaft Bent- heim, were simulated and its costs analysed. In collaboration with epidemiologists of the veterinary authorities, three different scenarios were designed for each of the two strategies and regions (a best case, a probable/medium case and a worst case). In the economic model part, the costs were estimated for farmers and for the animal disease fund (the authorities). Thereby, the costs were divided into the categories Direct Costs (DC), Direct Consequen- tial Costs (DCC) and Indirect Consequential Costs (ICC).