Handbuch ILEK Vorlage.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
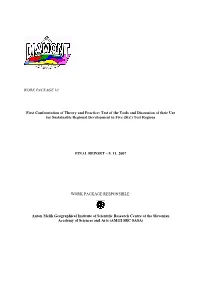
Part Report for Each Region Was Prepared
WORK PACKAGE 10 First Confrontation of Theory and Practice: Test of the Tools and Discussion of their Use for Sustainable Regional Development in Five (Six!) Test Regions FINAL REPORT – 9. 11. 2007 WORK PACKAGE RESPONSIBLE: Anton Melik Geographical Institute of Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (AMGI SRC SASA) CONTENT I. Introduction II. Methodology III. Searching for sustainable regional development in the Alps: Bottom-up approach IV. Workshops in selected test regions 1. Austria - Waidhofen/Ybbs 1.1. Context analysis of the test region 1.2. Preparation of the workshop 1.2.1. The organizational aspects of the workshop 1.3. List of selected instruments 1.4. List of stakeholders 1.5. The structure of the workshop 1.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 1.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 1.7. Revised answers 1.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 1.9. Starting points for the second workshop 1.10. Conclusion 2. France – Gap 2.1. Context analysis of the test region 2.2. Preparation of the workshop 2.2.1. The organizational aspects of the workshop 2.3. List of selected instruments 2.4. List of stakeholders 2.5. The structure of the workshop 2.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 2.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 2.7. Revised answers 2.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 2.9. Starting points for the second workshop 2.10. -

Überarbeitete Fassung 02.04.20
LAG „Traun-Alz-Salzach“ Lokale Entwicklungsstrategie LEADER 2014 - 2020 Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Überarbeitete Fassung vom 02.04.2020 Seite 1 LAG „Traun-Alz-Salzach“ Inhaltsverzeichnis Seite A Inhalte des Evaluierungsberichts Leader 2007-2013 entfällt B Inhalte der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) 1. Festlegung des LAG-Gebiets 4 2. Lokale Aktionsgruppe 6 2.1 Rechtsform, Zusammensetzung und Struktur 6 2.2 Aufgaben und Arbeitsweise 10 2.3 LAG-Management 11 3. Ausgangslage und SWOT-Analyse 13 3.1 Beschreibung Ausgangslage und Analyse Entwicklungsbedarf und -potenziale 13 3.1.1 Landschaft und Umwelt 13 3.1.2 Klimaschutz 15 3.1.3 Land- und Forstwirtschaft 16 3.1.4 Bevölkerung und demographischer Wandel 18 3.1.5 Siedlungsentwicklung, Versorgung und Soziales 21 3.1.6 Verkehr und Mobilität 22 3.1.7 Kultur, Tourismus und Freizeit 23 3.1.8 Wirtschaft und Bildung 25 3.2 Bestehende Planungen und Initiativen 26 3.3 Bürgerbeteiligung 28 4. Ziele der Entwicklungsstrategie und ihre Rangfolge 30 4.1 Innovativer Charakter für die Region 30 4.2 Beitrag zu den übergreifenden ELER-Zielsetzungen 30 4.3 Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels 31 4.4 Mehrwert durch Kooperationen 31 4.5 Regionale Entwicklungsziele 33 4.6 Beschreibung der Ziele und Indikatoren 35 4.7 Finanzplanung 47 5. LAG-Projektauswahlverfahren 48 5.1 Regeln für das Projektauswahlverfahren und Förderhöhe -

Grund- Und Mittelschulen Im Landkreis Traunstein Schulanschrift Schul-Nr
Staatliches Schulamt im Landkreis Traunstein Grund- und Mittelschulen im Landkreis Traunstein Schulanschrift Schul-Nr. Schulkontaktdaten Schulleitung Grundschule Altenmarkt 2882 GS Tel.: 08621 1720 Schwan Sabine (Rin) Schulweg 15 2914 MS Fax: 08621 63635 Zehentmaier Gertraud (StRGS/STV) 83352 Altenmarkt [email protected] Frau Geerk (VA) Grundschule Bergen 1277 GS Tel.: 08662 8306 Mitterer Monika (Rin) Tannhäuserweg 10 2915 MS Fax: 08662 419723 Leitenstorfer Christine (L/STV) 83346 Bergen [email protected] Frau Gehmacher (VA) Grund- und Mittelschule Chieming 1278 GS Tel.: 08664 9849-0 Röhr Sabine (Rin) Josef-Heigenmooser-Straße 45 2916 MS Fax: 08664 9849-22 n. n. 83339 Chieming [email protected] Frau Wimmer (VA) Grundschule Engelsberg 2917 GS Tel.: 08634 620730 Unterforsthuber Christine (Rin) Raiffeisenplatz 6 Fax: 08634 620750 Brüche Christine (L/STV) 84549 Engelsberg [email protected] Frau Hamberger (VA) Grund- und Mittelschule Salzachtal in Fridolfing 2869 GS Tel.: 08684 240 Stehböck Thomas (R) Schulweg 6 2919 MS Fax: 08684 9194 Baumann Wolfgang (KR) 83413 Fridolfing [email protected] Frau Stettmeier (VA), Frau Mörtl (VA) Grundschule Grabenstätt 2920 GS Tel.: 08661 241 Zeitel Johannes (R) Am Eichbergfeld 11 Fax: 08661 8058 Gebert-Schwarm Birgit (StRGS/STV) 83355 Grabenstätt [email protected] Frau Ganser (VA) Grund- und Mittelschule Grassau 1279 GS Tel.: 08641 2125 Tischler Georg (KR 1/SLei) Birkenweg 12 2921 MS Fax: 08641 697552 n. n. 83224 Grassau [email protected] -

Organisation Sparkassen-Pokalturniere Stefan Fritzenwenger, Thumberg 2, 83317 Teisendorf Tel
Organisation Sparkassen-Pokalturniere Stefan Fritzenwenger, Thumberg 2, 83317 Teisendorf Tel. 08666/545 p; Fax 08666/981566; E-Mail [email protected] Verteiler: Teilnehmende Vereine Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Sparkasse Berchtesgadener Land Presse Teisendorf, den 17.03.2018 39. Sparkassen - Pokalturniere 2018 Liebe Sportfreunde, für die diesjährigen Sparkassen-Pokalturniere der E-, D- und C-Junioren wurden in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land mit insgesamt 62 Mannschaften aus 34 Vereinen zwar nicht mehr so viele Teilnehmer gemeldet als in den Vorjahren, trotzdem darf ich mich für die zahlreiche Beteiligung herzlich bedanken. Aufgrund der am 14.03.2018 vorgenommenen Auslosung kommt es in den Vorrunden zu folgenden Paarungen: U15 (C-Jun.), Landkreis Traunstein Spielkennung: Gruppe 1: 510299200 Sa., 24.03.18 10:00 SG Palling/Traunwalchen – SG Siegsdorf/Vachendorf (in Palling) 510299201 10:00 SG Petersk./Tachert./Engelsb. – SG TuS/FC Traunreut (in Tacherting) 510299202 Mi., 28.03.18 18:00 SG Siegsdorf/Vachendorf – SG Petersk./Tachert./Engelsb. (in Siegsdorf) 510299203 18:00 SG TuS/FC Traunreut – SG Palling/Traunwalchen (TuS-Platz) 510299204 Mi., 04.04.18 18:00 SG Palling/Traunwalchen – SG Petersk./Tachert./Engelsb. (in Palling) 510299205 18:00 SG Siegsdorf/Vachendorf – SG TuS/FC Traunreut (in Siegsdorf) Für die weiterführenden Spiele qualifizieren sich alle 4 Mannschaften. Die Halbfinalspiele sind für Fr., 06.07.18, 18:30 Uhr, geplant mit folgenden Paarungen: Spiel 1: Erster Gruppe 1 : Vierter Gruppe -

Unsere Kandidaten Für Den Landkreis Traunstein Oder 70 Gute Gründe Die ÖDP Zu Wählen 1
Wichtige Erfolge der ÖDP in Bayern: Die ÖDP im Landkreis Traunstein steht für: 2019 … Volksbegehren Artenvielfalt - Rettet die Bienen im Jahr 2019 • Konsequenten Schuldenabbau 2018 … Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Buchner ins Europaparlament • Erhalt der kommunalen Kliniken im Landkreis 2017 … Sieg beim Bürgerentscheid zur Abschaltung des Kohlekraftwerks • Förderung und Ausbau der Versorgung für Senioren München-Nord • Erarbeitung und Umsetzung eines ÖPNV-Konzepts für den 2014 … Prof. Dr. Klaus Buchner wird erstmalig ins Europaparlament gesamten Landkreis gewählt • Optimierung des Radwegenetzes 2013 … Studiengebühren in Bayern werden abgeschafft • Unterstützung von Car-Sharing Projekten 2010 … Erfolgreiches Volksbegehren zum konsequenten Nichtraucherschutz • Erhalt einer kleinstrukturierten bäuerlichen Landwirtschaft 2009 … Genmais-Anbau in Bayern gestoppt • Keine Olympischen Winterspiele - “NOlympia“ 2008 … Abschaffung des Büchergeldes an bayerischen Schulen • Gute Arbeitsplätze und Wohnmöglichkeiten in der Region 2000 ... 5 Standorte für neue Atomkraftwerke per Volksbegehren verhindert • Klimafreundlicher Landkreis 2030 Unsere Kandidaten für den Landkreis Traunstein oder 70 gute Gründe die ÖDP zu wählen 1. Dr. Ute Künkele, 65, Petting, Biologin 36. Claudia Kaleve, 66, Tacherting, Musiklehrerin in Rente 2. Dr. med. Thomas Graf, 69, Traunstein, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 37. Stephan Obermeyer, 45, Fridolfing, Selbst. Kranführer 3. Andreas Huber, 58, Traunstein, Bio-Landwirt 38. Jürgen Sandner, 52, Traunstein, Dipl.-Ing. (FH) Landespflege 4. Christine Otto, 59, Grassau, Med.Dok.-Assistentin 39. Arno Zandl, 54, Chieming, Berufsschullehrer, Waldbauer 5. Helmut Kauer, 59, Traunreut, Service-Techniker 40. Michaela Ober, 51, Traunstein, Fahrdienstleiterin 6. Renate Jodelsberger-Schrott, 60, Trostberg, Dipl.-Soziologin 41. Franz Deser, 56, Tittmoning, Berufsschullehrer 7. Bruno Siglreitmaier, 59, Chieming, Bautechniker 42. Jutta Jackl, 56, Ruhpolding, Angestellte öffentl. Dienst 8. Maria Dirnaichner, 59, Schnaitsee, Familienfrau 43. -

Projekt ‚Solidarische Landwirtschaft
Donnerstag, 24. Mai 2018 LOKALES SWA Nummer 118 27 Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ Verbraucher unterstützen bei Tettenberg Gärtnerei durch feste Abnahmegarantien – „Acker-Frühstück“ am Samstag Von Hans Eder Wochen noch leeren Felder be- Sauerkirschen. Die Auswahl an reits teilweise von allerlei Pflan- Obst und auch an Beeren wird im Otting. Bei der Ortschaft Tet- zen bedeckt sind – gefördert durch Laufe der nächsten Jahre noch zu- tenberg in der Nähe von Otting die nach wochenlanger Trocken- nehmen. Johannisbeeren aller- entsteht auf einer 1,3 Hektar gro- heit jetzt doch endlich eingetroffe- dings sind bereits reichlich vor- ßen Anbaufläche ein gemein- nen Regenfälle. Es sind vor allem handen, da sie schon vor einigen schaftlich getragenes Gemüse- verschiedene Salatsorten sowie Jahren gepflanzt wurden. Auch bau-Projekt der „Solidarischen Radieschen und einige Kräuter, Kräuter und Teepflanzen werden Landwirtschaft“ (SoLaWi). Wer die inzwischen bereits geerntet angebaut. sich daran beteiligt, kann sich Wo- werden können. Die beiden Ver- Demnächst werden noch zwei che für Woche mit einem breit ge- teilungsstellen sind im ehemali- Gewächshäuser aufgebaut, die fächerten Gemüse-Paket versor- gen Rossstall am Ottinger Pfarr- zunächst hauptsächlich für Toma- gen. Inhaberin ist Demeter-Land- hof und an der Zentrale des Kreis- ten gedacht sind, in denen dann wirtin Kristine Rühl aus Siegsdorf; bildungswerks im Campus St. Mi- aber in der kalten Jahreszeit die Elfriede Brenner ihre Nichte Karoline Widur und chael an der Kardinal-Faulhaber- winterharten Salate und Gemüse- eine Gruppe von weiteren freiwil- Straße in Traunstein. sorten angebaut werden sollen. wird heute 89 ligen Helfern arbeiten dabei mit. Das Konzept dieses biodynami- Was aktuell in den kommenden schen Gemüsebau-Projekts: In- Wochen vor allem geerntet wer- Waging am See. -

Die Erzeuger in Der Ökomodellregion
DIE ERZEUGER IN DER ÖKOMODELLREGION hier steckt regionale Bioqualität drin ABOKISTE GEMÜSE Hans Lecker Niederheining 1 83410 Laufen 08682 953224 [email protected] BIER Privatbrauerei Wieninger Poststraße 1 83317 Teisendorf 08666 8020 [email protected] Schlossbrauerei Stein Schlosshof 2 83373 Stein an der Traun 08621 983226 [email protected] BROT/SEMMELN Bäckerei Neumeier Marktstraße 13 83317 Teisendorf 08666 267 [email protected] Bäckerei Seidl Stadtplatz 45 84529 Tittmoning 08683 7898 Bäckerei Wahlich Laufener Straße 24 83416 Saaldorf-Surheim 08654 7795474 [email protected] Matthias Spiegelsperger Wimmern 20 83317 Teisendorf 08666 1527 [email protected] BUTTER Andechser Molkerei Scheitz Biomilchstraße 1 82346 Andechs 08152 3790 [email protected] Molkerei Berchtesgadener Land Hockerfeld 5-8 83451 Piding 08651 70040 [email protected] EIER Andreas und Katharina Buchwinkler Haberland 12 83416 Saaldorf-Surheim 08654 65270 [email protected] Andreas Maier Waldering 3 84529 Tittmoning 08683 1346 [email protected] Hans Lecker Niederheining 1 83410 Laufen 08682 953224 [email protected] Hans Glück Grassach 15 84529 Tittmoning 08683 932 [email protected] Leonhard Martl Gröbn 1 84556 Kastl 08679 6928 [email protected] Robert Zeilinger Niederstockham 1 84529 Tittmoning 08687 633 [email protected] Sebastian Kettenberger Kettenberg 1 84529 Tittmoning 08687 468 [email protected] FLASCHLBROT MIT LAUFENER LANDWEIZEN Jessica Romstötter Am Sandberg 36 83329 Waging am See -

Einzelhandelskonzept Für Die Marktgemeinde Waging Am See
München Stuttgart Forchheim Einzelhandelskonzept für die Marktgemeinde Köln Leipzig Lübeck Ried(A) Waging am See CIMA Beratung + Management GmbH Brienner Straße 45 80333 München T 089-55 118 154 F 089-55 118 250 [email protected] www.cima.de Stadtentwicklung Marketing Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement Untersuchungsbericht Immobilien Organisationsberatung Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Achim Gebhardt (Projektleitung) B.Sc. Geogr. Christoph Rohrmeier Kultur Tourismus München, März 2017 Einzelhandelskonzept für die Marktgemeinde Waging am See CIMA Beratung + Management GmbH Es wurden Fotos, Grafiken u.a. Abbildungen zu Layoutzwecken und als Platzhalter verwendet, für die keine Nutzungsrechte vorliegen. Jede Weitergabe, Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung kann Ansprüche der Rechteinhaber auslösen. Wer diese Unterlage -ganz oder teilweise- in welcher Form auch immer weitergibt, vervielfältigt oder veröffentlicht übernimmt das volle Haftungsrisiko gegenüber den Inhabern der Rechte, stellt die CIMA Beratung+ Management GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei und trägt die Kosten der ggf. notwendigen Abwehr von solchen Ansprüchen durch die CIMA Beratung+ Management GmbH. Der Auftraggeber kann die vorliegende Unterlage für Druck und Verbreitung innerhalb seiner Organisation verwenden; jegliche - vor allem gewerbliche - Nutzung darüber hinaus ist nicht gestattet. Diese Entwurfsvorlagen und Ausarbeitungen usw. fallen unter §2, Abs. 2 sowie § 31, Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Urhe- berrechte. Sie sind -

Urlaub & Freizeit in Fridolfing
m Wir wünschen allen Besuchern erholsame Momente, viel Freude und einen rundum schönen Aufenthalt. Urlaub & Freizeit in Fridolfing Herausgegeben von der Tourist-Info Fridolfing Rupertistr. 16 83413 Fridolfing Tel: 08684 9889 26 [email protected] www.fridolfing.de Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8:00-12:00 Uhr Freitag 9:00-12:00 Uhr Stand: 21.06.2021 Inhalt Unsere Gastgeber: Gasthäuser Urlaub auf dem Bauernhof Ferienwohnungen und Gästezimmer Gastronomie Regionaler Genuss Wanderlust Rauf aufs Rad Badevergnügen Rund ums Pferd Bauernhoferlebnis Rund um den Garten Spiel und Sport Kultur Kirchen in und um Fridolfing Kapellen, Bildstöcke und Kreuze Kunst Schönheit und Wohlbefinden Veranstaltungshighlights Fridolfinger A – Z Unsere Gastgeber - Gasthäuser Gasthaus Unterwirt Das historische Gasthaus mit einem Margit und Bernd Weinhart Kellergewölbe aus dem 16. Jh. Hadrianstr. 26 befindet sich in der Dorfmitte von 83413 Fridolfing Fridolfing neben dem Rathaus und Tel.: 08684- 9697609 der Kirche. Liebevoll bis ins Detail [email protected] wurden die 5 Gästezimmer mit www.gasthaus-unterwirt.de modernen Bädern eingerichtet. Gasthof Gruber Unser ruhig gelegener Gasthof Sebastian Gruber befindet sich im Ortsteil Pietling. Hauptstraße 27 Unser beheiztes Hallenbad, 83413 Fridolfing Liegewiese und Fitnessgeräte Tel.: 08684- 236 stehen all unseren Gästen zur [email protected] Verfügung. Unter dem Motto www.gasthof-gruber.de „gutbürgerliche Küche neu definiert“ zaubern wir jedem Gast ein Lächeln auf´s Gesicht. Unsere Gastgeber - Gasthäuser Dorfwirt Fridolfing Alfred Mitterer Der Dorfwirt erwartet Sie mit 5 neu renovierten Gäste- Laufener Straße 4 83413 Fridolfing zimmern zu moderaten [email protected] Preisen, leckerem Frühstück, sowie einer hervorragenden www.dorfwirt-fridolfing.de regionalen und saisonalen Küche. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Traunstein
AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS TRAUNSTEIN Herausgegeben vom Landratsamt Traunstein 83278 Traunstein, 15.03.2019 Zu beziehen unmittelbar beim Landratsamt Traunstein oder über die Gemeindeverwaltung sowie unter www.traunstein.bayern Erscheint in der Regel wöchentlich. Nr. 14 Seite 65 Inhaltsverzeichnis: Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ 32/19 Sturmwarndienst für den Chiemsee und den Waginger-/Tachinger See 33/19 Vollzug der Baugesetze; Neubau von einem Mehrfamilienhaus "Theresienpark Siegsdorf" Bauabschnitt 1, Gebäude 1 auf dem Grundstück 44/1 der Gemarkung Obersiegsdorf, Gemeinde Siegsdorf 34/19 Sitzung des Zweckverbandes Holzknechtmuseum Ruhpolding am Donnerstag, 03.04.2019, um 10.00 Uhr im Haus des Gastes, Sitzungszimmer (DG), Rathausplatz 2, 83324 Ruhpolding 35/19 Seite 66 Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 14 32/19 Az.: 1742.08-190011 Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ Bekanntmachung Nach § 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung zum Schutze des Waginger und Tachinger Sees und der umliegenden Landschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.1980 (Amtsblatt für den Landkreis Traunstein, Seite 25) ist es verboten, im Schutzgebiet ohne Erlaubnis mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Plätze zu fahren und zu parken. Von den Beschränkungen ist der land- und forstwirtschaftliche Verkehr ausgenommen. Zur Durchführung notwendiger und rechtlich zulässiger Arbeiten, die das Fahren und Parken mit dem Kraft- fahrzeug im Landschaftsschutzgebiet erfordern, wird hiermit für die Monate April und Oktober 2019 allge- mein eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom Fahr- und Parkverbot zugelassen. Die Gemeinden Kirchanschöring, Petting, Taching am See und Waging am See werden hiermit ermächtigt, hinsichtlich der im Landschaftsschutzgebiet gelegenen und nach der StVO für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrten öffentlichen Wege entsprechend zu verfahren. -

Die Fibelgräber Der Frühmittelalterlichen Nekropole Von Petting (Oberbayern)
Bayerische Vorgeschichtsblätter 78, 2013, S. 205–234 Die Fibelgräber der frühmittelalterlichen Nekropole von Petting (Oberbayern) Brigitte Haas-Gebhard und Franz Weindauer, München Der Fundort Petting spielte in der Erforschung der früh- Fundgeschichte mittelalterlichen Siedlungsentwicklung Südbayerns bis- lang kaum eine Rolle. Grund dafür ist eine ausgespro- chen problematische Fundgeschichte, die dazu führte, Die Ausgrabung des frühmittelalterlichen Gräberfeldes dass das Gräberfeld im Rahmen einer archäologisch-his- von Petting wurde notwendig, weil das Areal als Bau- torischen Auswertung nur unzureichend zur Kenntnis gebiet ausgewiesen worden war. Da die Grundstücke genommen werden konnte. für den Bau von Einfamilienhäusern bereits vor der Grabung an verschiedene Bauherren verkauft worden waren, ergab sich aufgrund der in Bayern bestehenden Rechtslage der Fall, dass der Freistaat Bayern als Finder Lage und Ausgrabung (= Ausgräber) den hälftigen Anteil an allen Fundstücken erworben hatte. Die andere Hälfte des Fundanteiles lag dagegen in den Händen von insgesamt 19 Grundei- Der Ort Petting befindet sich etwa 1 km südlich des Süd- gentümern, mit denen Verhandlungen über den end- ufers des Waginger Sees (Abb. 1). Der Abstand zu den gültigen Verbleib der Funde zu führen waren. Diese nördlichsten Ausläufern der Berchtesgadener Alpen be- Situation war zugegebenermaßen nicht ganz einfach trägt rund 10 km, zur Salzach 8 km, bis Salzburg sind es und konnte erst nach mehreren Anläufen von der Ar- etwa 25 km und bis nach Waging am See 7 km. chäologischen Staatssammlung und dem Bayerischen Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 2010 gelöst wer- führte in den Jahren 1991 bis 1993 eine großflächige den. Nur Dank des Einsatzes des Ersten Bürgermeisters archäologische Grabung auf der Flur „Am Mühlfeld“ in von Petting, Karl Lanzinger, und seinen Mitarbeitern Petting durch. -

Immobilienmarktbericht Gewerbe 2012
2012 - 2015 2 Chiemgau – unsere Heimat SEHR GEEHRTE LESERIN, SEHR GEEHRTER LESER, die Verfügbarkeit verlässlicher Daten des Immobilienmarktes ist ein wichtiger Standortfaktor. Der Gutachterausschuss gibt hier einen Überblick über Preise für Gewerbebauland im Landkreis Traunstein. Außerdem finden Sie in diesem Bericht Verkaufszahlen, Geldumsätze und Informationen zur räumlichen Verteilung von Gewerbebaulandverkäufen. Der vorliegende Immobilienmarktbericht zum Gewerbebauland umfasst die Jahre 2012 bis Mitte 2015. Anliegen des Berichtes ist es, - Verkäufern und Käufern, - Banken, Versicherungen, Steuerberatern, Firmen, Behörden und Bewertungssach - verständigen verlässliche Zahlen zum baureifen Gewerbe- bauland anzubieten. Dieser Bericht wird kostenfrei im Internet zum Ansehen und zum Selbstausdruck zur Verfügung gestellt. Ihr Siegfried Walch Landrat des Landkreises Traunstein 3 Inhalt 1. Gutachterausschuss und Geschäftsstelle 4 1.1 Ziele und Aufgaben 4 1.2 Mitglieder des Gutachterausschusses am Landratsamt Traunstein 4 1.3 Geschäftsstelle im Landratsamt 5 1.4 Vorbemerkung zur Auswertung 5 1.5 Datenbasis, Datenschutz 6 2. Verkaufszahlen, Umsätze bei Gewerbebauland 6 3. Private und kommunale Verkäufe, 2012 - 2015 7 4. Marktreaktionen auf bezahlte/nicht bezahlte Erschließung 8 5. Flächengröße - Preis - Relation 9 6. Regionale Strukturdaten, Landkreis Traunstein 11 7. Räumliche Verteilung der Kaufverträge, 2012 - 2015 12 8. Allgemeines, wertbildende Standortfaktoren für Gewerbebauland 14 9. Standortbeurteilung durch vorhandene Betriebe 14 10.