Radschnellweg-Koeln-Frechen-Bericht.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Mobilpass Ticket Vergünstigte Abos, Monats- Und 4Ertickets
gültig ab 1. Januar 2020 MobilPass Ticket Vergünstigte Abos, Monats- und 4erTickets. Verkehrsverbund Rhein-Sieg Günstiger unterwegs Das brauchen Sie mit Bus und Bahn. für Ihre Fahrt. Neu Der erste Schritt: Der MobilPass 4erTicket MonatsTicket MonatsTicket Viele Menschen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) MobilPass MobilPass MobilPass im Abo können beim zuständigen Jobcenter oder Sozialamt bzw. beim Landschaftsverband Rheinland einen MobilPass Zuname) und (Vor- Unterschrift PLZ/Wohnort bekommen – und damit vergünstigte VRS-Tickets kaufen. 4erTicket Kundenkarte + Nr. Straße eTicket Das gilt für Empfänger von: Vorname verkehr erforderlich) verkehr (nur im Ausbildungs- im (nur WertmarkeLichtbild Name ●● ALG II und Sozialgeld (SGB II) MobilPass 1a KUNDENKART ●● Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei 4er-Ticket er it hnen nteres. Erwerbsminderung sowie laufender Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII) Nur gültig mit Entwerteraufdruck MobilPass 1a Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungs gesetz ●● Monat/Jahr (auch für unbegleitete minderjährige Geflüchtete) ●● laufenden Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach Kundennummer dem Bundesversorgungsgesetz Kölner und Bonner Bürger/innen können mit ihrem + + + Köln-Pass bzw. Bonn-Ausweis MobilPassTickets nutzen. MobilPass, Köln-Pass oder Bonn-Ausweis Nähere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Ämtern Ihrer Stadt. Der zweite Schritt: Tickets kaufen Hier gibt es MobilPassTickets: ●● Bei den Verkaufsstellen der VRS- Verkehrsunternehmen – hier bekommen Sie auch die Kundenkarte für das + MonatsTicket MobilPass gültiger Lichtbildausweis ● An den meisten Ticketautomaten und bei vielen Bus- ● (z. B. Personalausweis / Reisepass / Führerschein) fahrern (kein Abo) Bestellscheine erhalten Sie bei den Verkehrsunternehmen im VRS sowie unter vrs.de/bestellscheine Maßgeblich für die genauen Preise und Leistungen aller Tickets sind die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW und die Tarif- bestimmungen des VRS, die Sie unter vrs.de finden. -

The Second-Generation Turkish-Germans Return 'Home'
LUND UNIVERSITY The Second-Generation Turkish-Germans Return ‘Home’: Gendered Narratives of Renegotiated Identities Nilay Kılınç Supervisor: Eleonora Narvselius August 2013 Abstract Turkish migration to Germany which started in the 1960s as ‘guestworker’ migration soon matured to a permanent settlement. Today, Turkish labour diaspora is the largest migrant group in Germany and Europe. The daughters and sons of the first generation Turkish migrants have a different understanding of ‘home’ compared to their parents. Their upbringing in Germany and transnational links to Turkey create a tension between their constructions of ‘belonging’ and ‘home’. This thesis evaluates the second generation’s constructions of ‘home’ within their ‘Turkish’ upbringing in Germany and their ‘return’ orientations and post-return experiences in Turkey. The special focus is given to gender roles and renegotiations in the second generation’s return journey. The empirical evidence comes from in-depth, semi-structured interviews carried out with a non-random sample of Turkish-Germans, interviewed in and around Istanbul in 2012. The analysis section of the thesis is built around answers and insights into three main sets of research questions. First, how did their upbringing within a Turkish family construct and affect their senses of ‘belonging’ and ‘home’? To what extent are nostalgia and family narratives effective on their ‘home’ constructions? Second, how did their childhood memories from Turkey affect their motivations to return to the parental homeland? Third, how does the second generation renegotiate their diasporic and gender identity in the parental homeland? Do they feel that they belong to Turkey? How do they reflect upon their diasporic past in Germany? The thesis analyses these questions with a reference to diaspora, memory, return migration, generation and gender theories. -

Clusters Results of the EPCA Think Tank Sessions Organized and Sponsored by EPCA
A Paradigm Shift : Supply Chain Collaboration and Competition in and between Europe’s Chemical Clusters Results of the EPCA Think Tank Sessions organized and sponsored by EPCA With contribution of the INSEAD team, Technology and Operations Management, Fontainebleau, France • Prof. Luk Van Wassenhove • Baptiste Lebreton • Paolo Letizia and the Editorial Committee Luk Van Wassenhove, INSEAD • Frank Andreesen, Bayer • Philip Browitt, Agility Logistics Solutions • Cathy Demeestere, EPCA • Fred du Plessis, European Chemical Site Promotion Platform • Paul Gooch, The Logical Group THE EUROPEAN PETROCHEMICAL ASSOCIATION August 2007 DISCLAIMER : All information contained in the report was collected from the participants and EPCA does not guarantee the accuracy thereof nor can it be held liable in case it is not. Participants have guaranteed that information relating to cases summarised in the report was in the public domain and did not consist in sensitive business information. EPCA did not check the individual compliance with competition rules of cases summarised nor can it be held liable if all or part thereof would violate competition rules. Competition law compliance is the individual responsibility of the individual companies concerned. 2 INDEX Note on Competition Law 6 1. Management Summary 9 2. Introduction 13 2.1 European Chemical Industry – A Major Force under Threat? 13 2.2 Clusters & Competitiveness 14 2.3 The EPCA Study 15 3. Presentation of the ARRR and Tarragona chemical clusters 17 3.1 Definition of chemical clusters 17 3.2 Presentation of the ARRR and Tarragona clusters 20 3.2.1 ARRR Cluster 20 3.2.1.1 Antwerp subcluster 22 3.2.1.2 Rotterdam subcluster 24 3.2.1.3 Rhine Ruhr subcluster 27 3.2.1.4 Rhine Main subcluster 30 3.2.2 Tarragona cluster 30 4. -

DOWNLOAD (.Pdf)
Standorte HSU Rhein-Erft-Kreis 2019/20 Sprache Stadt Schule Albanisch Bergheim GGS Tierpark, Bergheim Albanisch Frechen GGS Ringschule, Frechen Albanisch Wesseling GGS Goetheschule, Wesseling Albanisch Wesseling GHS Wilhelm Busch, Wesseling Arabisch Bergheim GGS Am Schwarzwasser, Bergheim-Ahe Arabisch Bergheim GGS Fortuna, Bergheim-Oberaußem Arabisch Bergheim GHS Erich Kästner, Bergheim Arabisch Brühl GHS Clemens-August, Brühl Arabisch Erftstadt GGS Donatusschule Arabisch Hürth GY Ernst-Mach, Hürth Arabisch Kerpen GS Clemensschule Arabisch Kerpen GS Rathausschule Arabisch Kerpen RS Kerpen Arabisch Pulheim Geschwister-Scholl-Gymnasium Arabisch Wesseling GGS J.-Gutenberg.-S., Wesseling Bosnisch Hürth GY Ernst-Mach, Hürth Griechisch Brühl GGS Franziskus, Brühl Griechisch Brühl GHS Clemens-August, Brühl Griechisch Frechen GHS Herbertskaul, Frechen Griechisch Wesseling GGS Johannes Gutenberg, Wesseling Griechisch Wesseling GHS Wilhelm Busch, Wesseling Italienisch Bedburg GHS Bedburg Italienisch Bergheim GGS Gudrun-Pausewang, BM- Quadrath Italienisch Elsdorf KGS Elsdorf, Jahnstr. Italienisch Frechen GHS Herbertskaul, Frechen Italienisch Hürth GS Don Bosco Italienisch Hürth GHS Hürth-Kendenich Italienisch Hürth KGS Martinus, Hürth-Fischenich Polnisch Bergheim Gy Gutenberg-Gym. Bergheim Polnisch Brühl GHS Clemens-August, Brühl Polnisch Frechen GHS Herbertskaul, Frechen Portugiesisch Frechen GHS Herbertskaul, Frechen Russisch Brühl GHS Clemens-August, Brühl Russisch Frechen GGS Ringschule, Frechen Russisch Wesseling KGS Goetheschule, Wesseling -
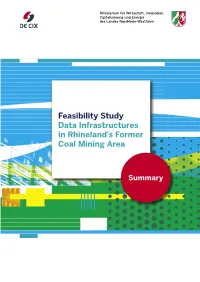
Feasibility Study – Data Infrastructures in Rhineland's Former
Feasibility Study Data Infrastructures in Rhineland’s Former Coal Mining Area Summary This study was prepared for the Ministry for Economic Affairs, Innovation, Digitalisation and Energy (MWIDE) of the State of North Rhine-Westphalia by a consortium of contractors under the content and project management of DECIX Management GmbH. The consortium of contractors comprises Deutsche Telekom Business Solutions GmbH, DECIX Management GmbH, Detecon International GmbH, WIK-Consult GmbH and Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH. The following text uses a gender-neutral language. When referring to persons in the abstract and in the singular, the gender-neutral singular ‘they’ shall be used, which shall be understood to include all gender identifications equally. If, inadvertently or for reasons of improved legibility, only the masculine pronoun or form of a word is used, this should be taken to refer also to persons of other gender identifi- cations. We are committed to gender equality in all matters, especially with regard to equal opportunities. This feasibility study is subject to copyright. Unless otherwise agreed with the client, the reproduction, sharing or publication of this feasibility study, in whole or in part, shall only be permitted with prior approval and with a citation of the source. Machbarkeitsstudie zu digitalen Infrastrukturen im Rheinischen Revier 3 © MWIDE NRW/E. Lichtenscheid Preamble Dear reader The coal mining areas in the Rhineland are faced with the in the US or Asia, and their business model seems to be challenges of the century – which we have preferred to based on ‘once you’re in, we make it as hard as possible to embrace as the opportunity of the century. -

Industrial Market Profile
Industrial Market Profile Cologne | 4th quarter 2019 January 2020 Industrial Market Profile | 4th quarter 2019 Cologne Warehousing Take-up Weakest take-up for the past ten years Around 89,000 sqm of space larger than 5,000 sqm was taken up in the market for warehousing and logistics space (owner-occupiers and lettings) in the Cologne region* in 2019; this was over 50% below the previous year’s result and below the five-year average. In contrast to previous years, no deals were concluded for units larger than 20,000 sqm and the average size of deals concluded in 2019 was around 9,900 sqm. The largest letting of the year was registered by Logwin AG, in which the logistics com- with a total area of around 17,000 sqm. Companies in the pany signed a contract for around 18,000 sqm in a project distribution/logistics segment accounted for around 50% in Kerpen. The second-largest contract was also conclu- of total take-up, while manufacturers accounted for 26%. ded by a logistics company for an existing unit in Bedburg, In the Cologne urban area, the supply of space available at short notice remains scarce, and no easing of this situation is foreseeable in the coming months. The situation is some- Prime Rent ≥ 5,000 sqm what different in some of the surrounding communities: for example, in Kerpen and Euskirchen, thanks to speculative new construction, there are available units larger than 5,000 sqm. The prime rent for warehousing space larger than 5,000 sqm achieved in the Cologne urban area has remained stable over the past twelve months at €5.10/sqm/month. -

Guest Workers in the School? Turkish Teachers and the Production of Migrant Knowledge in West German Schools, 1971 –1989
Guest Workers in the School? Turkish Teachers and the Production of Migrant Knowledge in West German Schools, 1971 –1989 by Brian Van Wyck* Abstract: This article examines policies and practices related to Turkish teachers in West German schools in the 1970s and 1980s. Different stakeholders in Turkish edu- cation in West Germany – school administrators, parents, consular officials, and the teachers themselves – understood the role of these teachers in different ways over time, reflecting contrasting and shifting notions about the knowledge teachers were expected to pass on to Turkishpupils. In the late 1970s, West German officials began to privilege teachers’ status as migrants capable of modeling their own successful in- tegration for pupils, reflecting new assumptions about Turks in West Germany and their futures in the country. In early 1972, Hasan Akıncı arrived in Osnabrück, Lower Saxony, to take up a post as a teacher for native language lessons (muttersprachlicher Unterricht) for the area’s Turkish children.1 Akıncı had interviewed for the position with the Turkish consulate in Hannover and had had no contact with either the Osnabrück school office (his future employer), the Lower Saxon Ministry of Education (Kultusministerium), or the schools where he would be working. For personal use only. Indeed, when he arrived at the school office, no one was expecting him. Nor did anyone know who, what, or where he would teach. After the officials’ confusion cleared up, Akıncı presented himself at the five primary schools to which he was assigned.2 The heads of these schools were similarly confused about his presence and the lessons he would offer. -

North Rhine-Westphalia for 2019
MARKET REPORT ON THE LETTING OF LOGISTICS PROPERTIES AND INDUSTRIAL SPACES North Rhine-Westphalia for 2019 Market report on the letting of logistics properties and industrial spaces in North Rhine-Westphalia* for 2019 n Take-up rises by 3% to 1,001,000 sqm >> Take-up of logistics properties and industrial spaces in North Rhine-Westphalia n Increases for the Ruhr region and Düsseldorf, but a decrease by over a third for Cologne n A strong focus on existing properties and a decline in new construction activity, particu- larly of build-to-suit buildings n Land options remain limited n Only two major deals over 50,000 sqm n Retail still has the highest take-up n Logistics service providers conclude longer terms to secure space n Higher demand in specific logistics such as >> Take-up of logistics propertyies and industrial spaces by regions in North Rhine-Westphalia 2019 temperature-controlled logistics n Rent increases of up to 8% n Muted forecast for 2020 We have analysed letting activities on the top industrial and logistics markets of North Rhine-Westphalia (NRW) in the past twelve months. According to this, take-up by all market participants in 2019 totalled 1,001,000 sqm. This is the third-best result in the last five years (2016: 1,502,000 sqm, 2017: 1,144,000 sqm). Although January to December 2019 posted a 3% increase compared with the previous year (971,000 sqm), >> Take-up of logistics properties and industrial spaces by industry in North Rhine-Westphalia 2019 overall take-up was 10% below the five-year av- erage (1,074,200 sqm) due to the exceptional per- formance in 2016. -

Rund Um Den Zapfhahn Köbes, Noch E Kölsch
Rund um den Zapfhahn Köbes, noch e Kölsch || 01 Gegen die „Preisliste“ einer Gaststätte hatte der Bürgermeister in Buir 1846 „nichts zu bemerken gefunden“, womit sie genehmigt war. (Stadtarchiv Kerpen, Amt Buir, 938) || 02 || 04 Theke einer Gastwirtschaft in Liblar, 1920er Jahre (Archiv RWE Power AG 140/190) (Festbuch zur Feier des XXXI. Verbands- Tages des Rhein.-Westf. Wirte-Verbandes am 16., 17. und 18. Juni 1914 in Köln am Rhein, Stadtarchiv Pulheim) || 03 (Festbuch zur Feier des XXXI.Verbands-Tages des Rhein.-Westf. Wirte-Verbandes am 16., 17. und 18. Juni 1914 in Köln am Rhein, Stadtarchiv Pulheim) || 05 Gartenrestaurant Schugt in Brau - || 06 weiler, um 1912 „Nettchen“, Inhaberin der Gast - (Verein für Geschichte e.V. - Pulheim, Bildarchiv, 15/21/82 – 27A/11/82, Reprodution Peter stätte zur Linde, um 1930 Schreiner) (Stadtarchiv Erftstadt, Sammlung Maxfield/Pütz) || 08 Die Gaststätte von Georg Kuhn befand sich in Türnich. Das Foto entstand in den 1920er Jahren. (Stadtarchiv Kerpen, Fotos) || 09 || 07 Der Besitzer der Gaststätte „Zum Treppchen“ in Pulheim, Jakob Textoris, feierte 1965 seinen 75. Vor der „Restauration“ von Geburtstag – zu diesem Zeitpunkt ist die Gast - Christian Herweg in Götzen - stätte 110 Jahren im Besitz der Familie. kirchen, Ende der 1920er Jahre. (Stadtarchiv Pulheim, I/P 282) (Stadtarchiv Kerpen, Sammlung Herrmann) Bier-lokal Geschichte der Brauereien und Gaststätten in der Region Rhein-Erft-Rur Rund um den Zapfhahn Klönen und Klüngeln Gaststätten waren und sind ein wichtiger Kommunikationsort. Hier trafen und treffen sich Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, um Neuigkeiten auszutauschen, Freundschaften zu pflegen und Feste zu feiern . In den Gaststätten ließen sich auch geheime Vereinbarungen zum persönlichen Vorteil treffen. -

Übersicht Der Schnelltestanbieter Im Rhein-Erft-Kreis
Übersicht der Schnelltestanbieter im Rhein-Erft-Kreis Name Adresse Telefon Bemerkungen Bedburg Linden Apotheke Langemarckstr. 2, 02272/3225 Termine nach Vereinbarung 50181 Bedburg Teststelle Krankenhaus Bedburg Zugang Hundsgasse 02272-402810 Testung derzeit nur am ehemalige Orthopädie-Praxis Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8:00 - 13:00 Uhr Termin/Voranmeldung erforderlich www.schnelltest-bedburg.de Teststelle Drive-In Kaster Zufahrt über die Graf-Wilhelm-Str. 02272-402810 Testung derzeit nur am gegenüber REWE-Markt Dienstag und Freitag von 8:00 - 13:00 Uhr in die Anlieferstr. bis zum Testzelt Termin/Voranmeldung erforderlich www.schnelltest-bedburg.de Praxis Dres. Werth/ Werth-Haas Arnold-Freund-Str. 15, 50181 02272/3063 Termine nach telefonischer Vereinbarung Bedburg Praxis Dr. Reiner Weber Lindenstraße 3, 50181 Bedburg 02272/930139 Termine nach telefonischer Vereinbarung Facharzt für Allgemeinmedizin Praxis Dr. Ulrike Brockmann Harffer-Schlossallee 3c, 02272/83374 Schnelltests werden nur für eigene Praxispatienten angeboten. 50181 Bedburg Bergheim Testzentrum Am Jobberath Am Jobberath 2, Walk-In vor dem alten Hit-Markt 50126 Bergheim Testzentrum Parkplatz hinter dem Kraftwerk PoC/PCR, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa und So 8-16 Uhr. Bergheim-Niederaußem Niederaußem, 50129 Bergheim Anfahrt: Niederaußem Richtung Rheidt, unmittelbar nach dem Kraftwerk links, ab dann ausgeschildert („Corona-Test“) Rochus Apotheke Pfarrer-Tirtey-Str. 2, 02238/41522 Anmeldung ausschließlich über www.ia.de 50129 Bergheim Mohren Apotheke Hauptstr.1, 50126 Bergheim 02271/42270 Kreis Apotheke Kölner Str. 16, 50126 Bergheim 02271/42665 Mo-Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr Anmeldung notwendig über www.testtermin.de , telefonische Hilfe zur Anmeldung unter 02271/42665. MVZ für integrativ/ Kosterstraße 12-14, 02272/43992 POC-Antigen-Test nur für Bestandspatientinnen an. -

1 „Agri-Urban Settlement Models“
„Agri-urban settlement models“ Student competition for the S.U.N. region Announcement for the summer semester 2021 1 Contents Occasion and challenge ________________________________________3 Competition objectives _________________________________________4 Agri-urban settlement models ___________________________________7 Documents for participation _____________________________________8 Conditions for participation ____________________________________10 Selection procedure, award by the jury ___________________________11 Organisation ________________________________________________12 Picture credits All sketches by Anja Neuefeind 2 Occasion and challenge The City of Cologne, the Rhine-Erft district and the towns of Bedburg, Bergheim, Brühl, Elsdorf, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim, Wesseling and Dormagen as well as the municipality of Rommerskirchen have joined forces in the “Stadt-Umland-Netzwerk” (S.U.N.) to coordinate regional development. The region is growing rapidly. On the left bank of the Rhine, an increase of up to 170,000 people is expected in the next few years. New living space is urgently needed. In the past decades, numerous land-intensive new housing estates have been built in the surrounding area of Cologne. Large building plots and car-friendly development met the demand for living space and the dream of owning a home in the countryside. The land demands of development and traffic are in strong competition with agriculture and the open space of the landscape. This is seen by the actors in the region as a considerable sustainability problem. If settlement development were to “continue as is”, not only would more and more productive soil, which is valuable for agriculture, be sealed, but the identity of the 2,000-year-old cultural and agricultural landscape would also be lost. Therefore, the NACHWUCHS research project, funded by the BMBF, is looking for innovative agri-urban settle- ment models for sustainable regional development. -

CHAPTER FOUR Particular the Cultural Mind-Set of Citizens Tends to Be Neglected in Contem- Porary Planning Theory
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Symbolic markers and institutional innovation in transforming urban spaces Dembski, S. Publication date 2012 Link to publication Citation for published version (APA): Dembski, S. (2012). Symbolic markers and institutional innovation in transforming urban spaces. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:27 Sep 2021 4 Making symbolic markers happen: the role of power asymmetries in the shaping of new urban places [Dembski, S. (submitted)] Many urban regions are experimenting with new planning strategies using symbolic markers in order to instil new meanings into the fluid, yet anonymous landscape of the urban fringe. This paper considers the specific institutional conditions needed to successfully engage in the symbolisation of these changing areas.