Paul Eber (1511–1569)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Sources of the Christmas Interpolations in J. S. Bach's Magnificat in E-Flat Major (BWV 243A)*
The Sources of the Christmas Interpolations in J. S. Bach's Magnificat in E-flat Major (BWV 243a)* By Robert M. Cammarota Apart from changes in tonality and instrumentation, the two versions of J. S. Bach's Magnificat differ from each other mainly in the presence offour Christmas interpolations in the earlier E-flat major setting (BWV 243a).' These include newly composed settings of the first strophe of Luther's lied "Vom Himmel hoch, da komm ich her" (1539); the last four verses of "Freut euch und jubiliert," a celebrated lied whose origin is unknown; "Gloria in excelsis Deo" (Luke 2:14); and the last four verses and Alleluia of "Virga Jesse floruit," attributed to Paul Eber (1570).2 The custom of troping the Magnificat at vespers on major feasts, particu larly Christmas, Easter, and Pentecost, was cultivated in German-speaking lands of central and eastern Europe from the 14th through the 17th centu ries; it continued to be observed in Leipzig during the first quarter of the 18th century. The procedure involved the interpolation of hymns and popu lar songs (lieder) appropriate to the feast into a polyphonic or, later, a con certed setting of the Magnificat. The texts of these interpolations were in Latin, German, or macaronic Latin-German. Although the origin oftroping the Magnificat is unknown, the practice has been traced back to the mid-14th century. The earliest examples of Magnifi cat tropes occur in the Seckauer Cantional of 1345.' These include "Magnifi cat Pater ingenitus a quo sunt omnia" and "Magnificat Stella nova radiat. "4 Both are designated for the Feast of the Nativity.' The tropes to the Magnificat were known by different names during the 16th, 17th, and early 18th centuries. -

Stories from the Road
Issue No. 7 | August 2021 STORIES FROM THE ROAD. In this issue... MADAGASCAR REFORMATION MINISTRY RELIEF FUND HYMNODY: A GIFT ACROSS FOR ALL TIME DENOMINATIONS P. 3 P. 5 P. 9 Published by Southwestern Pennsylvania Synod MISSION: INSIDE THIS ISSUE TO SERVE, CONNECT, AND EQUIP ELCA 02 The Global Church CONGREGATIONS IN SOUTHWESTERN 04 iServe PENNSYLVANIA TO TELL THE STORY OF JESUS 05 Reformation Hymnody 07 The Power of Data “O sing to the Lord a new song, for he has done 08 marvelous things.” Meeting Our Neighbors Grants –Psalm 98:1 09 Ministry Across Denominations 11 Health & Wellness Ministry 12 Eating Again at the Table Cover Photo: Luther in the circle of his family, by Gustav Adolph 13 Staff Book Picks that Inspire Spangenberg, edited 14 Colleague Connections CONTACT: 1014 PERRY HWY, SUITE 200 15 Calendar of Causes PITTSBURGH, PA 15237 412-367-8222 SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA SYNOD WWW.SWPASYNOD.ORG Rev. Kurt F. Kusserow SYNOD COUNCIL BISHOP Jennifer Armstrong-Schaefer Rev. James V. Arter III BISHOP & ASSISTANTS Barbara Nugent Rev. Kerri L. Clark [email protected] VICE-PRESIDENT Rev. Beth Clementson [email protected] Dr. Wendy Farone [email protected] Rev. William Schaefer Myra L. Fozard SECRETARY Beryl Gundy RESOURCE MINISTRY Rev. Brenda Henry Gary N. Teti [email protected] Rev. Susan A. G. Irons TREASURER Rev. Allyn Itterly ACCOUNTING Janice Jeletic [email protected] Dennis T. Lane Rev. Peter D. Asplin Fiona Lubold ADMINISTRATIVE SUPPORT ASSISTANT TO THE BISHOP Rev. J.J. Lynn [email protected] Rev. Sarah Rossing Rev. Melissa L. -

Concordia Theological Quarterly
teach the faithful, reach lost, and care for all. Forming servants in Jesus Christ who CONCORDIA THEOLOGICAL QUARTERLY CONCORDIA THEOLOGICAL SEMINARY THEOLOGICAL CONCORDIA CONCORDIA Fort Wayne, IN 46825-4996 Fort Wayne, 6600 North Clinton Street THEOLOGICAL QUARTERLY Volume 81 Number 3–4 July/October 2017 REFORMATION 500 ANNIVERSARY ISSUE The Ninety-Five Theses Cameron A. MacKenzie Luther on Galatians as the Banner of the July/Oct 2017 Reformation Naomichi Masaki Pfarramt, Geography, and the Order of the Church Mark D. Nispel Luther’s Use of Apologetics Adam S. Francisco Antichrist in the Scriptures and Lutheran Confessions 81:3–4 Charles A. Gieschen ORGANIZATION Berne, IN 46711 NON-PROFIT NON-PROFIT Permit No. 43 Will the Real Martin Luther Stand Up? U.S. Postage PAID David P. Scaer Luther Lessons for the Present Crisis Peter J. Scaer The Great Litany Benjamin T. G. Mayes US ISSN 0038-8610 Concordia Theological Quarterly Concordia Theological Quarterly, a continuation of The Springfielder, is a theological journal of The Lutheran Church—Missouri Synod, published for its ministerium by the faculty of Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana. Editor: David P. Scaer ([email protected]) Associate Editor: Charles A. Gieschen ([email protected]) Assistant Editor: Benjamin T.G. Mayes ([email protected]) Book Review Editor: Peter J. Scaer ([email protected]) Members of the Editorial Committee James G. Bushur, Paul J. Grime, John G. Nordling, and Lawrence R. Rast Jr. Editorial Assistant: Eamonn M. Ferguson The Faculty James G. Bushur Naomichi Masaki David P. Scaer Carl C. Fickenscher II Benjamin T.G. -

Living the Lutheran Lectionary a Weekly Study of the Scriptures for the Coming Sunday Since May 4, 2014
Page 1 of 12 11th Sunday after Pentecost August 16, 2020 10th Sunday after Trinity Proper 15 (20) Lectionary Year A – the Gospel of Matthew Living the Lutheran Lectionary A weekly study of the Scriptures for the coming Sunday since May 4, 2014. An opportunity to make Sunday worship more meaningful and to make the rhythms of the readings part of the rhythms of your life. Available on line at: www.bethlehemlutheranchurchparma.com/biblestudies Through www.Facebook.com at “Living the Lutheran Lectionary”, “Bethlehem Lutheran Church Parma”, or “Harold Weseloh” All links in this on-line copy are active and can be reached using Ctrl+Click Gather and be blessed: Thursdays at 10 AM (5pm Kenya/Uganda): At Bethlehem Lutheran Church, 7500 State Road, Parma, OH 44134 and on line through https://zoom.us/j/815200301 Wednesdays at 7 PM in a house church setting: For details, contact Harold Weseloh at [email protected] Tuesdays at 1:00 PM (8pm Kenya time) via Zoom to the Lutheran School of Theology - Nyamira , Kenya (Suspended due to Covid 19 restrictions in Kenya) On Facebook through Messenger in a discussion group shared by people throughout the United States, Kenya and Uganda. Contact Harold Weseloh on Facebook Messenger. https://steadfastlutherans.org/2017/08/jesus-and-the-canaanite-woman-sermon-on-matthew-1521-28- by-pr-charles-henrickson/ See quote on page 12 Hymn of the Day Lutheran Service Book (LSB) 653 The Lutheran Hymnal (TLH) Not Listed “In Christ there is no east or west” Lutheran Service Book (LSB) 615 The Lutheran Hymnal (TLH) 522 “When in the hour of deepest need” Page 2 of 12 “In Christ there is no east or west” “First presented at a 1908 exhibition of the London Missionary Society, the hymn “In Christ There Is No East or West” was intended to encourage missions and evangelism. -

Luther's Hymn Melodies
Luther’s Hymn Melodies Style and form for a Royal Priesthood James L. Brauer Concordia Seminary Press Copyright © 2016 James L. Brauer Permission granted for individual and congregational use. Any other distribution, recirculation, or republication requires written permission. CONTENTS Preface 1 Luther and Hymnody 3 Luther’s Compositions 5 Musical Training 10 A Motet 15 Hymn Tunes 17 Models of Hymnody 35 Conclusion 42 Bibliography 47 Tables Table 1 Luther’s Hymns: A List 8 Table 2 Tunes by Luther 11 Table 3 Tune Samples from Luther 16 Table 4 Variety in Luther’s Tunes 37 Luther’s Hymn Melodies Preface This study began in 1983 as an illustrated lecture for the 500th anniversary of Luther’s birth and was presented four times (in Bronxville and Yonkers, New York and in Northhampton and Springfield, Massachusetts). In1987 further research was done on the question of tune authorship and musical style; the material was revised several times in the years that followed. As the 500th anniversary of the Reformation approached, it was brought into its present form. An unexpected insight came from examining the tunes associated with the Luther’s hymn texts: Luther employed several types (styles) of melody. Viewed from later centuries it is easy to lump all his hymn tunes in one category and label them “medieval” hymns. Over the centuries scholars have studied many questions about each melody, especially its origin: did it derive from an existing Gregorian melody or from a preexisting hymn tune or folk song? In studying Luther’s tunes it became clear that he chose melody structures and styles associated with different music-making occasions and groups in society. -

Paul Eber (1511
Daniel Gehrt | Volker Leppin (Hrsg.) Paul Eber Paul Eber (1511–1569) war nach Melanchthons Tod die zentrale Ge- (1511–1569) stalt der Wittenberger Theologie und wirkte reichs- und europaweit als Ratgeber für zahlreiche lutherische Städte und Territorien. Dieser umfassenden Bedeutung wird die bisher recht schmale Forschung Paul Eber zu seinem Leben und Werk nicht gerecht, die ihn immer noch im Schatten Luthers und Melanchthons sieht. Der vorliegende Band erschließt daher weitgehend Neuland: Ausgehend von Ebers um- (1511–1569) fangreichen Nachlass in der Forschungsbibliothek Gotha schärfen die Beiträge das Profi l dieses stillen Akteurs. Neu beleuchtet werden Humanist und Th eologe der zweiten Generation sein facettenreiches akademisches, geistliches und kirchenpolitisches Wirken, sein wissenschaftliches und dichterisches Schaffen, seine der Wittenberger Reformation vermittelnde Haltung in den theologischen Kontroversen seiner Zeit sowie seine zeitgenössische Rezeption in Wort und Bild. LStRLO 16 ISBN 978-3-374-03056-9 9 7 8 3 3 7 4 0 3 0 5 6 9 EUR 68,00 [D] LStRLO_16_Umschlag.indd 1 03.07.14 16:04 Paul Eber (1511–1569) Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie (LStRLO) Herausgegeben von Irene Dingel, Armin Kohnle und Udo Sträter Band 16 Daniel Gehrt | Volker Leppin (Hrsg.) Paul Eber (1511–1569) Humanist und Theologe der zweiten Generation der Wittenberger Reformation EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT Leipzig Die Herausgeber danken der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt und der Stadt Erfurt für die großzügige Unterstützung bei der Drucklegung des Tagungsbandes. Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. -

“Angels and Ministers”
St. Michael and All Angels (September 29) “Lord God, to Thee We Give All Praise” (Lutheran Service Book, #522; Christian Worship, #196) “Angels and Ministers” One of the benefits of observing the festival of St. Michael and All Angels is that it not only breaks up the long “green” season of Pentecost, it also gives us a moment to contemplate those extraordinary creatures of God’s vast cosmos—his heavenly beings. These “messengers” of his profound grace are continually praising him around his throne in heaven (Revelation 12:7-9) , are particularly watchful over children (Matthew 18:10) , rejoice over every penitent sinner (Luke 15:10), and most of all, counter the efforts of their (and our) eternal adversary—Satan. In fact, our version of (Martin Luther’s good friend) Philipp Melanchthon’s hymn proclaims the virtues of angels in six of the stanzas but also warns us of Satan’s presence and actions in three of them. What a comfort to know that they stand around us as we resist the devil’s wiles and schemes. How important they are to us in our daily walk of faith! Everlasting God, you have ordained and constituted in a wonderful order the ministries of angels and mortals. Mercifully grant that, as your holy angels always serve and worship you in heaven, so by your appointment they may help and defend us here on earth; through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. (P. S. What other mentions of angels in the Bible come to your mind? (A beginning list of texts includes Daniel 10:13, 12:1; Jude 9, 2 Kings 6:15-17, Malachi 2:7…) Barry L. -

Tifh CHORALE CANTATAS
BACH'S TREATMIET OF TBE CHORALi IN TIfh CHORALE CANTATAS ThSIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State College in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By Floyd Henry quist, B.A. Denton, Texas August, 1950 N. T. S. C. LIBRARY CONTENTS Page LIST OF ILLUSTRATIONS. ...... .... v PIEFACE . vii Chapter I. ITRODUCTION..............1 II. TECHURCH CANTATA.............T S Origin of the Cantata The Cantata in Germany Heinrich Sch-Utz Other Early German Composers Bach and the Chorale Cantata The Cantata in the Worship Service III. TEEHE CHORAI.E . * , . * * . , . , *. * * ,.., 19 Origin and Evolution The Reformation, Confessional and Pietistic Periods of German Hymnody Reformation and its Influence In the Church In Musical Composition IV. TREATENT OF THED J1SIC OF THE CHORAIJS . * 44 Bach's Aesthetics and Philosophy Bach's Musical Language and Pictorialism V. TYPES OF CHORAJETREATENT. 66 Chorale Fantasia Simple Chorale Embellished Chorale Extended Chorale Unison Chorale Aria Chorale Dialogue Chorale iii CONTENTS (Cont. ) Chapter Page VI. TREATMENT OF THE WORDS OF ThE CHORALES . 103 Introduction Treatment of the Texts in the Chorale Cantatas CONCLUSION . .. ................ 142 APPENDICES * . .143 Alphabetical List of the Chorale Cantatas Numerical List of the Chorale Cantatas Bach Cantatas According to the Liturgical Year A Chronological Outline of Chorale Sources The Magnificat Recorded Chorale Cantatas BIBLIOGRAPHY . 161 iv LIST OF ILLUSTRATIO1S Figure Page 1. Illustration of the wave motive from Cantata No. 10e # * * # s * a * # . 0 . 0 . 53 2. Illustration of the angel motive in Cantata No. 122, - - . 55 3. Illustration of the motive of beating wings, from Cantata No. -

Johann Brenz's Role in the Sacramentarian Controversy of the Sixteenth Century
/ This dissertation has been microfilmed exactly as received 67-10,879 CONSTABLE, John Wesley, 1922- JOHANN BRENZ'S ROLE IN THE SACRAMENTARIAN CONTROVERSY OF THE SIXTEENTH CENTURY. The Ohio State University, Ph.D., 1967 History, medieval University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan Copyright by John Wesley Constable 1967 JOHANN BRENZ'S ROLE IN THE SACRAMENTARIAN CONTROVERSY OP THE SIXTEENTH CENTURY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By John Wesley Constable, B. A . , M. A. The Ohio State University 1967 Approved byoy a . t I*— * m o fAdviser Department of History ( CONTENTS Vita ill 1. Introduction 1 2. Theological Issues In The Controversy 35 3. The Beginnings Of The Controversy 70 4. The Height Of The Controversy 105 5. Resolution In The Formula of Concord 156 6. Conclusions 180 Bitollography 193 ( ii VITA March 20, 1922 B o m - Baltimore, Maryland 1 9 ^ 6 ................ B. A . , Concordia Seminary St. Louis, Missouri 194.9 - 1 9 5.......... 6 University Pastor, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1956-196^............ University Pastor, The State University of Iowa, Iowa City, Iowa I960 ........ M. A . , The State University of Iowa, Iowa City, Iowa 1961-1962 .......... Danforth Scholar, The Ohio State University, Columbus, Ohio 196^f................ Assistant Professor, Historical Theology, Concordia Seminary, St. Louis, Missouri 1966-1967 .......... Acting Chairman, Historical Theology, Concordia Seminary -

PDF Musical Excellence: the Spiritual Panacea of the Future
222 HARVARD SQUARE SYMPOSIUM | THE FUTURE OF KNOWLEDGE Musical Excellence: The Spiritual Panacea of the Future Cristian Caraman ABSTracT: The present paper presents The biblical reference points of music, The manifestations of Protestant music culture and The excellence in music. The Protestant music started with Luther, Calvin and continued with Bach, Handel, Brahms, asserting itself in Europe, North America, Africa, and recently in Asia. The Protestant culture, especially the musical one, has penetrated all aspects of civilization, being by far, through its representatives, one of the most powerful spiritual dimensions in human history. The future of a better world consists of a more educated and more sensible generation in which music can make people better. The values of the Protestant–Evangelical music can contribute to the human spiritual dimension and to the beauty of its culture and civilization. KEY WORDS: culture, music, religion, Bible, Protestantism. The Biblical Reference Points of Music Through music, future generations of young people will develop out differenteasier and attitudes they will toward become society the artist and willof thebe ablefuture. to discover Music is the a benefits of art. Furthermore, the groups they are part of will stand correctly and only then how to sing. The study of violin will best developvibration. their The hearing, young voice and the student study will of guitar first learn will gain how the to breathestudent more self-confidence and will gain a bigger power of concentration 222 Caraman: Musical Excellence: The Spiritual Panacea of the Future 223 then the other young people. The grace of playing the violoncello or the piano will in the same time correct the position of the back. -
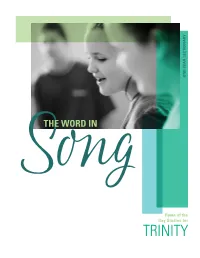
LCMS Worship
ONE-YEAR LECTIONARY ONE-YEAR SongTHE WORD IN Hymn of the Day Studies for TRINITY Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from Quotations from the Lutheran Confessions are from Concordia: the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), The Lutheran Confessions, copyright © 2005, 2006 by copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good Concordia Publishing House. Used by permission. All rights News Publishers. Used by permission. All rights reserved. reserved. To purchase a copy of Concordia, call 800-325-3040. Lutheran Service Book © 2006 Concordia Publishing House. This work may be reproduced by a congregation for its own © 2018 Used with permission. use in the study of the Scriptures. Commercial reproduction, The Lutheran Church—Missouri Synod Lutheran Service Book Propers of the Day © 2007 Concordia or reproduction for sale, of any portion of this work or of the St. Louis, MO 63122-7295 Publishing House. Used with permission. work as a whole, without the written permission of the copyright holder, is prohibited. lcms.org/worship Quotations from the Small Catechism are © 1986 Concordia Publishing House. ONE-YEAR Hymn of the Day Studies for TRINITY LECTIONARY Contents To God the Holy Spirit Let Us Pray . 1 A Multitude Comes from the East and the West . 3 Lord Jesus Christ, You Have Prepared . 5 Lift High the Cross . 7 Lord, to You I Make Confession . 9 O God, My Faithful God . .11 When All the World Was Cursed . .13 Lord Jesus Christ, the Church’s Head . .15 “Come, Follow Me,” the Savior Spake . .17 From East to West . .19 All Mankind Fell in Adam’s Fall . -

STUDIES in LUTHERAN CHORALES by Hilton C
STUDIES IN LUTHERAN CHORALES by Hilton C. Oswald Edited by Bruce R. Backer ! Copyright 1981 by Dr. Martin Luther College, New Ulm, Minnesota All Rights Reserved Printed in U.S.A. • Redistributed in Digital Format By Permission TABLE OF CONTENTS EDITOR’S PREFACE! iii ABOUT THE AUTHOR! v 1!THREE REPRESENTATIVE CHORALES OF DR. MARTIN LUTHER! 1 1.1!A MIGHTY FORTRESS IS OUR GOD! 1 1.2!WE NOW IMPLORE GOD, THE HOLY GHOST! 3 1.3!IN THE MIDST OF EARTHLY LIFE! 4 2!CHORALES BY CONTEMPORARIES OF LUTHER! 7 2.1!MY SOUL, NOW BLESS THY MAKER! 7 2.2!IN THEE, LORD, HAVE I PUT MY TRUST! 8 3!THE UNFAMILIAR CHORALES OF DR. MARTIN LUTHER! 10 3.1!MAY GOD BESTOW ON US HIS GRACE! 10 3.2!WE ALL BELIEVE IN ONE TRUE GOD! 12 3.3!IN PEACE AND JOY I NOW DEPART! 14 3.4!O LORD, LOOK DOWN FROM HEAVEN, BEHOLD! 16 3.5!IF GOD HAD NOT BEEN ON OUR SIDE! 17 4!THE GREAT CHORALES OF LUTHER’S CONTEMPORARIES! 19 4.1!IN THEE, LORD, HAVE I PUT MY TRUST! 19 4.2!PRAISE GOD, THE LORD, YE SONS OF MEN! 20 4.3!ALL GLORY BE TO GOD ON HIGH! 22 4.4!LAMB OF GOD, PURE AND HOLY! 22 4.5!WHEN IN THE HOUR OF UTMOST NEED! 24 5!GREAT CHORALES OF THE 17TH CENTURY! 27 5.1!ZION MOURNS IN FEAR AND ANGUISH! 27 5.2!O DARKEST WOE! 28 5.3!ON CHRIST’S ASCENSION I NOW BUILD! 30 5.4!NOW THANK WE ALL OUR GOD! 31 5.5!O LORD, WE WELCOME THEE! 32 6!LUTHER’S ADAPTATIONS FROM THE HYMNODY OF THE OLD CHURCH! 33 6.1!JESUS CHRIST, OUR BLESSED SAVIOR! 33 6.2!O LORD, WE PRAISE THEE! 34 6.3!ALL PRAISE TO THEE, ETERNAL GOD! 35 6.4!CHRIST JESUS LAY IN DEATH’S STRONG BANDS! 37 6.5!COME, HOLY GHOST, GOD AND LORD! 39 i TABLE OF CONTENTS 7!THE CATECHISM CHORALES OF DR.