Ranunculus Aconitifolius) Im Ebbegebirge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Goals and Management of the Ruhr Reservoir System Since the Beginning of Our Century
Scientific Procedures Applied to the Planning, Design and Management of Water Resources Systems (Proceedings of the Hamburg Symposium, August 1983). IAHSPubi. no. 147. Goals and management of the Ruhr reservoir system since the beginning of our century F, W, RENZ Ruhr Reservoir Association, Kronprinzenstrasse 37, D-4 300 Essen 1, FR Germany ABSTRACT In the last 85 years a system of reservoirs has provided augmentational low flows in the Ruhr drainage area. The necessary discharge of the reservoirs compared with the water losses of the basin (i.e. the amount of water pumped over the watershed into adjacent areas for public water supply and the losses due to evaporation within the Ruhr basin) gives the gross efficiency rating of the reservoir system with respect to the goals of water management. The periods when parts of the reservoir system are not fully available for water manage ment are presented as a duration curve. Moreover the predicted water demand in the Ruhr area is compared with the measured amount. Today, the time which is needed to introduce a new reservoir within the system is longer than the period of time for which reliable forecasts of water demand are possible. Objectifs et aménagement du système de réservoirs de la Ruhr depuis le début de notre siècle RESUME Au cours des 85 dernières années, un système de réservoirs a été réalisé sur le bassin versant de la Ruhr en vue d'augmenter le débit de basses eaux. Le débit sortant exigé des réservoirs comparé aux pertes en eau du bassin (c'est à dire le volume d'eau pompée dans le bassin vers les zones voisines pour la fourniture d'eau au public et les pertes par evaporation dans le bassin de la Ruhr) conduit au calcul de l'efficacité globale du système de réservoirs par rapport aux objectifs de l'aménagement des eaux. -
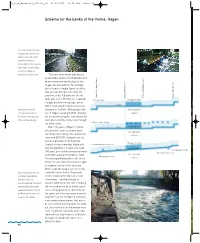
Scheme for the Banks of the Volme, Hagen
E_03_a_dreiseitl_078-111_16 20.09.2005 11:15 Uhr Seite 98 Scheme for the banks of the Volme, Hagen The Volme inside the town of Hagen was constrained within a box profile with embankment walls 3 metres high. As the concrete bed slowly crumbled away, a complete change of direction was envisioned. There are some towns that have a considerable number of inhabitants and whose names are familiar, but do not trigger any associations. For example, you’ve heard of Hagen, but it’s unlikely that you can describe more than the platform on the ICE train line. It’s the Weir at Kaufmannschule Weir Bridge at Rathausstraße at Marktstraße Weir Bridge at Badstraße same with rivers. The Ennepe is familiar 1. Previous state 100 year floodline enough, but how many people know that it flows into the Volme, which is a Volme Hydraulic assessment tributary of the Ruhr? Only people who Laid aggregate of the previous state of live in Hagen, you might think. Anyway, riverbed the Volme and projected the rivers come together just outside the effects of a new design town gates, and the Volme runs through the town centre. 2. Effects of the design But in the case of Hagen’s inhabit- Volme Rise of water level ants you can’t even be certain about Laid aggregate the Volme. As in many other places, this riverbed town with 200,000 inhabitants at the southern gateway of the Ruhr has 100 year floodline treated its river somewhat shabbily. It 3. Compensatory measures was downgraded to a canal in the past Steeper slope Volme Laid aggregate ramp 100 years, polluted with industrial waste Raised riverbed level and hidden away behind factory halls. -

EEG Anlagenstammdaten 2016
EIC-Netzbetreiber 11YR000000018733 BNetzA-Nr 10001905-01 Kennungen Standort / Lage der Anlage Technische Anlageninformationen Aggregatzustand Einsatzstoffe (nur bei Biomasse) Einspeisemanag Installierte Lastgang- Einspeise- Inbetriebnahmeda Außerbetrieb- Stromsteuerbef Regionalnach Bundesland- Netzzugangs- Netzabgangs- ement-Typ Anlagenschlüssel (!!! 33-stellig !!!) Zählpunktbezeichnung (!!! 33-stellig!!!) Ort / Gemarkung PLZ Straße / Flurstück Gemeindeschlüssel (optional) Leistung gemessen spannungs- Energieträger tum nahmedatum fest flüssig gasförmig reiung weise kürzel datum [TT.MM.JJJJ] datum [TT.MM.JJJJ] 0, 1, 2, 3 (siehe § [kW] Ja/Nein ebene [TT.MM.JJJJ] [TT.MM.JJJJ] [x] [x] 9 EEG 2014) E31905010000000000020407040100000 DE0002525823900000000000204070401 Schwerte 58239 Bergerhofweg 24 NW 3,60 Nein NS SOL 22.10.2002 22.10.2002 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729000000 DE0074095823900000000001000007290 Schwerte 58239 Am Winkelstück 14 NW 96,00 Ja MS SOL 19.12.2007 19.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729100000 DE0074095823900000000001000007291 Schwerte 58239 Goethestr. 17 NW 9,52 Nein MS SOL 17.12.2007 17.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100001166600000 DE0074095823900000000001000011666 Schwerte 58239 Gut Halstenberg 5 NW 99,66 Ja MS SOL 28.06.2010 28.06.2010 31.12.2012 2 E3190501NEM00RLM00000005701600001 DE00740958239NEM00RLM000000057016 Schwerte 58239 Hagener Str. 400 NW 78,72 Ja MS SOL 09.03.2012 09.03.2012 31.12.2012 2 E31905010000000000018556930100001 DE0002525170900000000000185569301 Marienheide 51709 Kempershöher -

Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung Und Geoinformation
Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation Begründung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Lüdenscheid (Ausschnitt) 1. Anlass und Ziel der Planung Aufgrund einer von der Bahn AG durchgeführten Entbehrlichkeitsprüfung sind im Bereich des Bahnhofes Brügge nicht mehr bahnnotwendige Flächen frei geworden und der Stadt Lüdenscheid zum Kauf angeboten worden. Die Stadt Lüdenscheid hat die nicht mehr benö- tigten Flächen erworben, um diese z. T. brachliegenden und untergenutzten Flächen städte- baulich aufzuwerten und zu entwickeln. Für einen östlichen Teilbereich der Gesamtfläche soll diese 6. Änderung des Flächennut- zungsplanes aufgestellt werden. Hieraus wird der Bebauungsplan Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ entwickelt werden. Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig am Einmündungsbereich der Bun- desstraßen 54 (Volmestraße) und 229 (Talstraße) und soll zukünftig durch den Bau einer neuen Brücke über die Volme erschlossen werden. Die Stadt Lüdenscheid beabsichtigt, auf dem ehemaligen Bahngelände ein sonstiges Son- dergebiet gem. § 11 BauNVO sowie ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO zu entwickeln. Das sonstige Sondergebiet soll u. a. der Aufnahme von großflächigem Einzelhandel dienen. Aus dem im Jahre 2005 durch das Büro Junker und Kruse Stadtforschung Planung erarbei- teten gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept geht hervor, dass im Ortsteil Brügge sowie im angrenzenden Ortsteil Stüttinghausen ein Defizit bezüglich der Nahversorgung -

Kulturentwicklungsplan „Oben an Der Volme“ Ein Interkommunales Modellprojekt Der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1
Kulturentwicklungsplan „Oben an der Volme“ Ein interkommunales Modellprojekt der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1. Kontext ......................................................................................................................6 1.1. REGIONALE 2013 - Südwestfalen ....................................................................................... 6 1.1.1. RIEHK und das OadV-Leitbild ..................................................................................... 6 1.1.2. Das Kulturfestival „Lampenfieber“ .......................................................................... 10 1.2. Die (Kultur)region Südwestfalen und der Märkische Kreis ................................................. 12 1.2.1. Die regionale Kulturpolitik [RKP] .............................................................................. 12 1.2.2. Tourismus ................................................................................................................ 13 1.3. Kulturagenda Westfalen .................................................................................................. 16 2. Bestandsaufnahme OadV ......................................................................................18 2.1. Bevölkerung..................................................................................................................... 18 2.2. Kulturlandschaft .............................................................................................................. 26 2.2.1. Institutionen und private Kulturakteure -

In Elektrischer Mission Wie Der Caritasverband Aufs Fahrrad Kam Ab Seite 4 Caritaz Heft 2.2012 Caritaz Heft 2.2012
CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZDIE HAGENER CARITASZEITUNG · HEFT 2 · 2012 · 22. JAHRGANG IN ELEKTRISCHER MISSION Wie der Caritasverband aufs Fahrrad kam ab Seite 4 CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZ Heft 2.2012 CaritaZDIE HAGENER CARITASZEITUNG · HEFT 2 · 2012 · 22. JAHRGANG MEHR ALS 6 UNTERSTÜTZEN IN ELEKTRISCHER PLANTSCHEN UND SPIELEN MISSION Wie der Caritasverband aufs Fahrrad kam ab Seite 4 Frühe Hilfen bieten Babyschwimm-Kursus dank Spenden der WP-Leser an GLÜCKLICHE GESICHTER STATT 28 KINDER Liebe Leser, UNENDLICH VIELER KARTONS Die ersten Tage in St. Christophorus – TITELBILD: Christof Becker Das Foto zeigt Sandra Schablack ein persönlicher Bericht und Michael Sonntag vom Integrationsfachdienst. Worum es geht, Das Dach der Caritas – es bietet jedem Platz. Und es wird immer größer: Zwei neue lesen Sie ab Seite 4 Einrichtungen unter dem roten Caritas-Kreuz bieten den Menschen in Hagen nun ihre Dienste an. Die beiden Neuen in unserer Gemeinschaft spiegeln gleichzeitig die Vielfalt CaritaZ – die Hagener Caritaszeitung und Breite unseres Angebotes wider: An der Hochstraße 61 erfüllt in der Kindertages- 22. Jahrgang, Ausgabe 2 | 2012 TÜR AN TÜR MIT DER CWH 40 BEHINDERUNG stätte St. Christophorus nun Kinderlachen das ehemalige Gemeindezentrum der Stadt- Neue Räume für die St. Laurentius-Werkstätte kirchengemeinde. Und auf Emst sind die Mieter in das neu erbaute Senioren-Service- HERAUSGEBER Caritasverband Hagen e. V. für Menschen mit Behinderung Wohnen am Köhlerweg eingezogen. Hierbei ist der Verband eine Kooperation mit einer Hochstraße 83 a, 58095 Hagen am Konrad-Adenauer-Ring Hagener Wohnungsgesellschaft eingegangen. Telefon (0 23 31) 91 84 - 0 Telefax (0 23 31) 18 30 07 Dies sind zwei sehr eindrückliche Beispiele für die Dynamik, die uns täglich antreibt. -

City County Lat-Long Aabauerschaft Hopsten 522157N0073734E
City County Lat-Long Aabauerschaft Hopsten 522157N0073734E Aabauerschaft Laer 520409N0072239E Aabauerschaft Wettringen 521143N0072015E Aachen Aachen 504629N0060504E Aacherhof Königswinter 504110N0071557E Aamühlen Brilon 512408N0083246E Aaperhöfe Wesel 513838N0063924E Abbenburg Brakel 514722N0091140E Abbenhaus Rosendahl 520239N0071114E Abbenroth Nümbrecht 505608N0073226E Abbing Borken 515414N0064543E Abel Dorsten 514424N0070256E Abelkath Wesel 514047N0063925E Abelmannshof Rheinberg 513421N0063316E Abelshof Wesel 514048N0063834E Abelsnaaf Overath 505611N0072311E Abenden Nideggen 504026N0062823E Aberham Hamminkeln 514750N0063234E Abrahamstal Lindlar 510208N0072139E Abt Dülmen 514905N0071934E Abtei Mariawald Heimbach 503712N0062912E Abtsküche Heiligenhaus 512009N0065947E Achenbach Siegen 505206N0075859E Achermer Mühle Mechernich 503847N0063651E Achterathsheide Moers 512406N0063544E Achterberg Kempen 512439N0063126E Achterhoek Kevelaer 513456N0062110E Achterhook Bocholt 514749N0063511E Achtermann Werne 514100N0074033E Ackenbrock Iserlohn 512207N0074106E Acker Aachen 504803N0060438E Ackermannshof Rheinberg 513138N0063642E Ackersiepen Ennepetal 511434N0071834E Ackfeld Ahlen 514317N0075330E Ackfeld Hamm 514315N0074910E Ackfeld Wadersloh 514537N0081510E Ackfeld Wadersloh 514536N0081234E Ackhof Kalletal 521001N0090022E Adalbertshöhe Hemer 512242N0074431E Adendorf Wachtberg 503658N0070307E Adener Mühle Lünen 513532N0073530E Adick Hopsten 522230N0073919E Adrian Verl 515314N0082807E Adscheid Hennef (Sieg) 504525N0072109E Aechterhoek Emsdetten 521136N0072959E -

Annual Report Foreword by the Chair of the B-It Foundation
2020 Annual Report Foreword by the Chair of the b-it Foundation Like most sectors of society, the Covid- as RWTH Aachen’s b-it scientific director to 19-pandemic is seriously challenging the in- Professor Stefan Decker. The foundation is ternational higher education system. In such very grateful to Professor Jarke for his pio- a crisis, the international digitalization-orient- neering initiative towards the internationaliza- ed master and doctoral education pursued tion of German Computer Science education by the Bonn-Aachen International Center on as early as 2001, declining an attractive offer Information Technology (b-it) with topic such from a top US university. Personally, I would as Life Science Informatics, Media Informat- very much like to thank Professor Jarke for Annette Storsberg ics, and Autonomous Systems around a his commitment to b-it and the outstanding shared data science kernel are more impor- services he has rendered the foundation. tant than ever. Several research projects are directly contributing to preventing further Concluding, we would like to thank the b-it spreading of the virus. The high impact of b-it directors, study program coordinators, and was also emphasized by the international b-it especially the faculty and supporting staff for Advisory Board. their additional efforts in difficult times, with best wishes for the future. The Ministry is glad to learn that the social media-based network set up by b-it has dealt Annette Storsberg State Secretary at the Ministry of Culture and very efficiently with this challenging situation. Science of the German State of North Rhine- It offered successful bridging courses and Westphalia even a virtual welcome party for the incom- Chair of the b-it Foundation Council ing students in the fall of 2020, even includ- ing those who could not yet physically arrive in North Rhine-Westphalia due to Covid- b-it Mission Statement 19-related travel restrictions. -

Rund Um Den Bigge-Stausee
Impressionen vom Bigge-Stausee 1. Der Bigge-Stausee (nach http://de.wikipedia.org/wiki/Biggesee) Der Biggesee liegt im Südteil des Sauerlands zwischen den Städten Attendorn im Norden und Olpe im Süden. Er erstreckt sich etwa im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge. Durchflossen wird der Stausee vom Lenne-Zufluss Bigge und unter anderem von Bieke, Brachtpe, Bremgebach, Dumicke und Lister gespeist. An der Lister erstreckt sich westlich direkt an den Biggesee angrenzend auf dem Gebiet der Städte Drolshagen (Kreis Olpe) und Meinerzhagen (Märkischer Kreis) die ehemals selbstständige Listertalsperre. Im Biggesee befindet sich die etwa 34 ha große Gilberginsel, die zusammen mit der benachbarten Uferregion ein Naturschutzgebiet bildet. Vor allem dient der Biggesee der Speicherung von Rohwasser für das Ruhrgebiet, um eine gleichmäßige Wassermenge in der Ruhr sicherzustellen. Aus dem Stausee können über Bigge und Lenne bis zu 40 % des erforderlichen Zuschusswassers aller Talsperren im Flusssystem der Ruhr abgegeben werden. Weiterhin ist eine wichtige Aufgabe der Hochwasserschutz. In der hochwassergefährderten Zeit vom 1. November bis zum 1. Februar wird ein Hochwasserschutzraum von 32 Mio. m³ freigehalten; dieser wird in der Zeit vom 1. Februar bis zum 1. Mai für den Aufstau freigegeben. Daneben erzeugt ein Wasserkraftwerk ca. 22 Mio. kWh Strom im Jahr. Die Ausbauleistung der drei großen und einer kleinen Francis-Turbine beträgt 15,6 MW. Die Wasserentnahme aus dem Stausee erfolgt vorzugsweise über das Kraftwerk. Betreiber der Talsperre ist der Ruhrverband. Mit der benachbarten Listertalsperre bildet der Biggestausee ein großes Talsperrensystem. 1956 verabschiedete der Landtag von Nordrhein-Westfalen ein Gesetz für die Finanzierung der Biggetalsperre. Am 1. August 1956 trat das Biggetalsperrengesetz in Kraft. -
Ruhrverband. We Know What Water Is Worth. 2 Our Values, Our Work
Ruhrverband. We know what water is worth. 2_ Our values, our work At the Ruhrverband, we preserve water for the people in our region. With our eight reservoirs and 69 sewage treatment plants, we work to make sure that there’s enough water of high quality. With our knowledge about water we safeguard the basis of human life and the protection of nature. To ensure quality, we continuously moni- tor the condition of our rivers and lakes. We try to reach our goals in the most economical manner. Our work is about the wellbeing of people and not about striving for profit. We use innovative and modern tech- niques and develop new ideas. Leisure and recreation along our rivers and lakes and in our forests are a real joy for many people. Contents _3 Contents Introduction 4 Tasks 6 Organisational structure, finances 7 Catchment area 8 Water supply 12 Water quantity 13 Water quality 16 Laboratory 18 Quality management 20 Water management in NRW 21 Subsidiaries 24 Leisure activities 26 Facts and figures 28 Further information 30 4_ Introduction The Ruhr River: providing water and a name to a whole region. Introduction _5 A river of great service. The Ruhr is the lifeline and name giver for one of the largest conurbations in Europe, the Ruhr area. Around 4.6 million people get their drinking and service water from the Ruhr and its tributaries. The dense population and the high number of commercial and industrial enter prises lead to a water consumption per unit of area in the region which is around seven times higher than the national average. -

Plenary Hall R Oom AB C Plenaryplenary Hall
3rd Bonn Conference on International Development Policy Programme GLOBAL LIFESTYLES – NEW PATHWAYS FOR DEVELOPMENT POLICY 30th and 31st January 2012 at World Conference Center Bonn (WCCB), Germany The offi cial conference language is German; the entire conference will be translated simultaneously into English. Conference chair: Melinda Crane, DW-TV Monday, 30th January 2012 12.00 P.M. LUNCH BREAK FROM 9.00 A.M. REGISTRATION AND WELCOME COFFEE 01.00 P.M. PARALLEL FORUMS 1 AND 2 09.40 A.M. OFFICIAL OPENING FORUM 1 „Relevance of consumption habits and lifestyles Angelica Schwall-Düren for development policy“ Minister of Federal Affairs, Europe and the Media of Cheryl D. Hicks, SPREAD Sustainable Lifestyles 2050, North Rhine-Westphalia UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) 09.55 A.M. WELCOME ADDRESS Mohan Munasinghe, Chairman, Munasinghe Hall Mayor Jürgen Nimptsch Institute for Development (MIND), Sri Lanka, and City of Bonn Professor of Sustainable Development, University Manchester, United Kingdom 10.00 A.M. KEYNOTE Bernd Nilles, General Secretary, CIDSE - “Rio+20: the role of development policy in the international alliance of Catholic development preparation process” agencies, Belgium Brice Lalonde Imme Scholz, Deputy Director, German Executive Coordinator Rio+20, UNCSD 2012, France ABC Room Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 10.20 A.M.Plenary KEYNOTE Chair: Christiane Grefe, German weekly “DIE ZEIT” “Food security – also a question of consumption habits and global lifestyles“ FORUM 2 „Political responsibility: Joachim von Braun Strategies for sustainable development policy“ Director, Center for Development Research (ZEF) Alfredo Benjamin Candia Torrico, Chargé d‘affaires at the University of Bonn of the Plurinational State of Bolivia in Germany* Yoke Ling Chee, Programme Director, Third World 10.45 A.M. -

Download Here
Treasure map for the Sauerland Rothaar Mountains Nature Park Treasure hunting in the Sauerland Rothaar Mountains Nature Park Welcome to the Sauerland Rothaar underground cave worlds, impres- Mountains Nature Park! Our new sive cliffs and moors, rare species of treasure map leads you to the most animals and plants, historic factory beautiful and exciting places in the buildings, castles and fortresses. region. These are true jewels, For a total of 35 jewels now fill our proposed by the inhabitants and six information centres, the so- guests of the nature park in a called “treasure chests“, in Bad competition and exclusively selected Berleburg, Hemer, Lennestadt & for you. People in all participating Kirchhundem, Medebach, Meinerz- communities were called upon to hagen and Burbach (from 2021). name places that touch them Here you will learn everything about personally, that tell a story or want the natural and cultural treasures of to be discovered. the largest nature park in North Your treasure hunt leads you to Rhine-Westphalia, where famous 2 - 3 rivers such as the Ruhr, Eder and Sieg have their source. Discover the Content scenic diversity of the typical low mountain range region and set off The information centres are to explore the most exciting places veritable treasure chests for yourself. At interactive tables you the jewels in the nature park: can click your way through the information about our jewels and 4 Hemer get great tips and suggestions for 16 Meinerzhagen your next trip to the Sauerland 30 Lennestadt/Kirchhundem Rothaar Mountains Nature Park. 44 Bad Berleburg So start your own personal treasure 58 Burbach (from 2021) hunt! 72 Medebach HE Info centre Hemer The Nature Park Information Centre Hemer is located directly at the Deilinghofer Straße entrance to the Sauerland Park in Hemer, the former Blücher barracks.