Der Outsider
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ECOMYSTICISM: MATERIALISM and MYSTICISM in AMERICAN NATURE WRITING by DAVID TAGNANI a Dissertation Submitted in Partial Fulfill
ECOMYSTICISM: MATERIALISM AND MYSTICISM IN AMERICAN NATURE WRITING By DAVID TAGNANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WASHINGTON STATE UNIVERSITY Department of English MAY 2015 © Copyright by DAVID TAGNANI, 2015 All Rights Reserved © Copyright by DAVID TAGNANI, 2015 All Rights Reserved ii To the Faculty of Washington State University: The members of the Committee appointed to examine the dissertation of DAVID TAGNANI find it satisfactory and recommend that it be accepted. ___________________________________________ Christopher Arigo, Ph.D., Chair ___________________________________________ Donna Campbell, Ph.D. ___________________________________________ Jon Hegglund, Ph.D. iii ACKNOWLEDGEMENTS I wish to thank my committee members for their hard work guiding and encouraging this project. Chris Arigo’s passion for the subject and familiarity with arcane source material were invaluable in pushing me forward. Donna Campbell’s challenging questions and encyclopedic knowledge helped shore up weak points throughout. Jon Hegglund has my gratitude for agreeing to join this committee at the last minute. Former committee member Augusta Rohrbach also deserves acknowledgement, as her hard work led to significant restructuring and important theoretical insights. Finally, this project would have been impossible without my wife Angela, who worked hard to ensure I had the time and space to complete this project. iv ECOMYSTICISM: MATERIALISM AND MYSTICISM IN AMERICAN NATURE WRITING Abstract by David Tagnani, Ph.D. Washington State University May 2015 Chair: Christopher Arigo This dissertation investigates the ways in which a theory of material mysticism can help us understand and synthesize two important trends in the American nature writing—mysticism and materialism. -

{PDF EPUB} Introduction to the New Existentialism by Colin Wilson the NEW EXISTENTIALISM
Read Ebook {PDF EPUB} Introduction to the New Existentialism by Colin Wilson THE NEW EXISTENTIALISM. “It is extremely important to grasp the notion that man does not yet exist. This is not intended as a paradox or a play on words; it is literally true.” Colin Wilson, Introduction to The New Existentialism. Given the name, the new existentialism and its revolutionary philosophical proposition might seem to suggest a summary or synthesis of the premises known to us as existentialist philosophy. Nothing could be further from the truth. If the new existentialism is the heir to any philosophy, it is Romanticism. Each shares a boldness and creative impulse, as well as an impassioned dream of immortality and desire to be on an equal footing with the gods. The new existentialism has more in common with Nietzsche and Goethe than with Sartre or Camus. The shift in consciousness and the new ideal of man forged by the Romantics find unparalleled and vital expression in the new existentialism. They were the first to speak of the unconscious and its inherent power, and to reclaim certain concepts and beliefs generally held to have become obsolete. And like Colin Wilson, they did so with unprecedented enthusiasm and verve, recognizing that the last word had not been said as regards man. Romantics upheld the central importance of man in the cosmos; the existentialists saw man as contingent. Romantics made the infinite mystery that surrounds us the basis of their enquiries and everything they went on to create, and, compelled by its heroic spirit, they viewed this mystery not as an affront but as proof of the existence of the sacred and of God; existentialists renounced imagination and its creative power and sought refuge in the narrow limitations of daily life with all its many trifles, thereby losing sight of the majestic and with it the idea of God and transcendence. -

Existentialism and Ecstasy: Colin Wilson on the Phenomenology of Peak Experiences
PhænEx 13, no. 1 (Spring 2019): 46-85 © 2019 Biagio Gerard Tassone Existentialism and Ecstasy: Colin Wilson on the Phenomenology of Peak Experiences BIAGIO GERARD TASSONE Abstract This paper critically examines the philosophical foundations of Colin Wilson’s New Existentialism. I will show how Wilson’s writings promoted a phenomenological strategy for understanding states of ecstatic affirmation within so-called ‘peak experiences’. Wilson subsequently attempted to use the life affirming insights bestowed by peak states to establish an ontological ground for values to serve as a foundation for his New Existentialism. Because of its psychological focus however, I argue that Wilson’s New Existentialism contains an ambivalent framework for establishing ontological categories, which leads his thought into theoretical difficulties. More precisely, Wilson’s strategy runs into problems in coherently integrating its explicitly psychological interpretation of Husserl’s theory of intentionality within a broader, and philosophically coherent, phenomenological framework. Wilson’s psychological reading of Husserl’s transcendental reduction, for example, manifests tensions in how it reconciles the empirical basis of acts of transcendence with an essentialist conception of the self as a transcendental ego. The above tensions, I argue, ultimately render the New Existentialism susceptible to criticism from a Husserlian-transcendental perspective. After outlining a Husserlian critique of Wilson’s position, I end the paper by suggesting how some of the central -

Books and Coffee Past Presenters
Books and Coffee Past Presenters Year Speaker Author Title 1951 William Braswell Hemingway Across the River and Into the Trees Chester Eisinger Miller Death of a Salesman Paul Fatout -- “Mark Twain” Robert Lowe Pound Letters Barriss Mills Faulkner Collected Stories Herbert Muller Niebuhr Faith in History Albert Rolfs Fatout Ambrose Bierce Louise Rorabacher Orwell Animal Farm Emerson Sutcliffe Kent Declensions in the Air 1952 Welsey Carroll Boswell London Journal Richard Voorhees Greene The Power and the Glory Richard Cordell Irvine The Universe of George Bernard Shaw Harold Watts Mann The Holy Sinner Roy Curtis Hall Leave Your Language Alone! Richard Greene Altick The Scholar Adventurers R. W. Babcock -- “On Reading Shakespeare” Richard Crowder Williams Later Collected Poems 1953 Herbert Muller Ceram Gods, Graves, and Scholars William Hastings Wouk The Cain Mutiny J. H. McKee Ferril I Hate Thursday Arthur Koenig Dostoievsky The Diary of a Writer George Schick Boswell Boswell in Holland Darrel Abel Steinbeck East of Eden H. B. Knoll Walton The Compleat Angler Raymond Himelick Cabell Quiet Please 1954 Paul Fatout Boswell Boswell on the Grand Tour George S. Wykoff Bonavia-Hunt Pemberley Shades Lewis Freed Eliot The Cocktail Party R. M. Bertram Cary The Horse's Mouth Laird Bell Smith Man and His Gods Bernard Schmidt Michener The Bridges at Toki-Ri Victor Gibbens Randolf & Wilson Down in the Holler William Braswell Thurber Thurber Country 1955 Richard Cordell Larson An American in Europe Arnold Drew Jarrell Pictures from an Institution Russell Cosper Kafka The Castle M. W. Tillson Ives Tales of America Maurice Beebe Faulkner A Fable Walter Maneikis Algren The Man with the Golden Arm Virgil Lokke West The Day of the Locusts Robert Ogle White The Second Tree from the Corner 1956 Lewis Freed Alberto Moravia A Ghost at Noon R.W. -

Reflections on the Work of Colin Wilson
Reflections on the Work of Colin Wilson Reflections on the Work of Colin Wilson Proceedings of the Second International Colin Wilson Conference University of Nottingham July 6-8, 2018 Edited by Colin Stanley Reflections on the Work of Colin Wilson Edited by Colin Stanley This book first published 2019 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2019 by Colin Stanley and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-2774-3 ISBN (13): 978-1-5275-2774-4 CONTENTS Acknowledgement .................................................................................... vii Preface ....................................................................................................... ix Colin Stanley Introduction ................................................................................................ 1 John Morgan Voyager and Dreamer:’s Autobiographical Colin Wilson.......... Writing 7 .. Nicolas Tredell The Evolutionaryhors of Metap Colin Wilson..................... .................... 27 David J. Moore The Outsider and the Work: Coliny ..... Wilson, 41 Gurdjieff and Ouspensk Gary Lachman Consistent Patternsations in of -

Kingsley Amis's Criticism
https://theses.gla.ac.uk/ Theses Digitisation: https://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/ This is a digitised version of the original print thesis. Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten: Theses https://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Agnieszka Ksiqzek The Communication of Culture: Kingsley Amis’s Criticism Submitted to the Faculty of Arts University of Glasgow for the degree of M.Phil. December 2000 ProQuest Number: 10647787 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uesL ProQuest 10647787 Published by ProQuest LLO (2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLO. ProQuest LLO. 789 East Eisenhower Parkway P.Q. -

Colin-Wilson-The-Occult.Pdf
2 CONTENTS PREFACE INTRODUCTION PART ONE A Survey of the Subject 1. Magic – The Science of the Future 2. The Dark Side of the Moon 3. The Poet as Occultist PART TWO A History of Magic 1. The Evolution of Man 2. The Magic of Primitive Man 3. Adepts and Initiates 4. The World of the Kabbalists 5. Adepts and Impostors 6. The Nineteenth Century – Magic and Romanticism 7. The Beast Himself 8. Two Russian Mages PART THREE Man's Latent Powers 1. Witchcraft and Lycanthropy 2. The Realm of Spirits 3. Glimpses 3 PREFACE A SINGLE OBSESSIONAL IDEA RUNS THROUGH ALL my work: the paradoxical nature of freedom. When the German tanks rolled into Warsaw, or the Russians into Budapest, it seemed perfectly obvious what we meant by freedom; it was something solid and definite that was being stolen, as a burglar might steal the silver. But when a civil servant retires after forty years, and finds himself curiously bored and miserable, the idea of freedom becomes blurred and indefinite; it seems to shimmer like a mirage. When I am confronted by danger or crisis, I see it as a threat to freedom, and my freedom suddenly becomes positive and self-evident – as enormous and obvious as a sunset. Similarly, a man who is violently in love feels that if he could possess the girl, his freedom would be infinite; the delight of union would make him undefeatable. When he gets her, the whole thing seems an illusion; she is just a girl... I have always accepted the fundamental reality of freedom. -

Ann Quin's Reading List Novels (1864-‐1903) Émile Zola Anna
Ann Quin’s Reading List Novels (1864-1903) Émile Zola Anna Karenina (1877) Leo Tolstoy The Duchess of Malfi (1613) John Webster Boswell’s London Journal 1762-1763 (p.) James Boswell The White Goddess (1948) Robert Graves The Divine Comedy (1321) Dante Alighieri StranGe Case of Dr Jeykll & Mr Hyde (1886) Robert Louis Stevenson Don Quixote (I 1605; II 1615) Miguel de Cervantes Confessions (1769) Jean-Jacques Rousseau Frankenstein (1818) Mary Shelley Novels (1899-1943) Herman Hesse Iliad (c.850BC) Homer Of the Imitation of Christ (c.1418-1427) Thomas à Kempis The Turn of the Screw (1898) Henry James Journal Eugène Delacroix Kim (1901) Rudyard Kipling Plays (c.1944-1964) Jean Genet The Thief’s Journal (1949) Our Lady of the Flowers (1943) Lorna Doone (1869) R.D. Blackmore Lycidas (1638) John Milton Madame Bovary (1857) Gustave Flaubert Man in the Iron Mask (1847) Alexandre Dumas Man’s Fate (1933) André Malraux The MarriaGe of Heaven & Hell (1793) William Blake Mary Stuart (1800) Friedrich Schiller The Medici (p.1920) G.F. Young The Outsider (1956) Colin Wilson Narrative Poems (c.1884-1913) Rabindranath Tagore Northwest PassaGe (1937) Kenneth Roberts The Pied Piper of Hamlin (1842) Robert Browning The PilGrim’s ProGress (1678) John Bunyan The Adventures of Pinocchio (1883) Carlo Collodi (Lorenzini) The Raven (1845) Edgar Allen Poe Grimm’s Fairy Tales (1812) Jacob & Wilhelm Grimm Crime & Punishment (1866) Fyodor Dostoyevsky The Waves (1931) Virginia Woolf Collected Stories (c.1914-1930) D.H. Lawrence The Collected Poems of D H Lawrence (1928) -

Dion Fortune and Her Inner Plane Contacts: Intermediaries in the Western Esoteric Tradition
1 Dion Fortune and her Inner Plane Contacts: Intermediaries in the Western Esoteric Tradition Volume 1 of 2 Submitted by John Selby to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Theology June 2008 This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from this thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has been previously submitted and approved for the award of a degree at this or any other University. 2 _________________________ Abstract Whereas occultists of the standing of H. P. Blavatsky, Annie Besant, C. W. Leadbeater, and especially Aleister Crowley have been well served by academic enquiry and by published accounts of their lives and work, Violet Evans, neé Firth (aka ‘Dion Fortune’), has suffered comparative neglect, as has her concept of the ‘Masters’ who inspired and informed her work. These factors, alongside the longevity of her Society of the Inner Light (still flourishing), are the catalysts for my embarking on this thesis. Chapter 1 discusses the method of approach, covers Fortune’s definitions of frequent occult terms, and compares observations of her work by fellow occultists and outside observers. Chapter 2 is a comprehensive review of mainly recent academic research into the role of intermediaries in magic and religion from ancient times, and serves as a background to Fortune’s own esoteric philosophy, showing that she was heir to a tradition with a long history. -
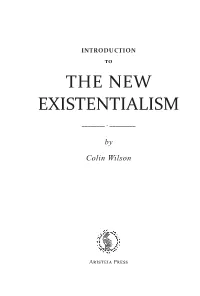
New Existentialism
INTRODUCTION to THE NEW EXISTENTIALISM ________ . _________ by Colin Wilson Aristeia Press For MAURICE CRANSTON Colin Wilson, novelist, critic, historian and philosopher, was born in Leicester in 1931. His novels and non-fiction books share a common interest in consciousness and the meaning and purpose of existence. His philosophy, which he called “New Existentialism,” is built on an optimistic approach to “Old Existentialism.” His first book, The Outsider, was internationally acclaimed and became an instant bestseller. Wilson’s work has been translated into more than thirty languages. He died in Cornwall in 2013. CONTENTS PUBLISHER’S NOTE xi INTRODUCTION BY NICOLAS TREDELL xvii ________ . _________ PREFACE TO THIS EDITION 1 PREFACE 5 Part One THE CRISIS IN MODERN THOUGHT Introductory 9 Chapter One: The Old Existentialism 15 Chapter Two: What Is Phenomenology? 31 Chapter Three: The Meaning of Husserl’s Revolution 49 Chapter Four: The New Picture of The Universe 73 Part Two THE NEW EXISTENTIALISM Chapter One: The Man in The Fog 93 Chapter Two: The Extension of Consciousnes 101 Chapter Three: Inside The Dark Room 113 Chapter Four: Language And Values 131 Chapter Five: Everyday Consciousness is a Liar 149 Chapter Six: The Power of The Spectre 159 PART ONE THE CRISIS IN MODERN THOUGHT INTRODUCTORY MY OWN APPROACH TO THE PROBLEM T IS NECESSARY to begin with a definition of existentialism. IIt is, then, a philosophy that asks the kind of questions that were once regarded as ‘religious’: questions about the meaning of human existence, freedom and the existence of God. Modern philosophy was founded by Descartes, who was a scientist and mathematician. -

The Best of Colin Wilson Ebook
The Best of Colin Wilson A Free PDF eBook by Maurice Bassett Publishing Coming in January, 2004: • The Magician from Siberia • The Anatomy of Human Greatness www.ReinventingYourself.com Free Sample Chapters for Colin Wilson eBooks Use the “Find” feature (Ctrl+F) to search these sample chapters by keyword. To be notified when new eBooks are available, please use this contact form to request updates. Note: The following Electronic Books are for personal, non-commercial use only, and are not for resale. Download (1) Frankenstein's Castle 1-56 148-169 $9.95 Download (2) Access to Inner Worlds 1-69 $4.95 Download (3) New Pathways in Psychology: Maslow and the Post-Freudian Revolution 1-47 179-196 $6.95 Download (4) The Ladder of Selves / The Search for Power Consciousness 1-23 98-110 $6.95 Download (5) Origins of the Sexual Impulse 1-96 $6.95 Download (6) The Age of Defeat (previously published in the US as The Stature of Man) 1-64 166-169 $6.95 Download (7) G.I. Gurdjieff: The War Against Sleep 1-37 128-133 $9.95 Download (8) The Strange Life of P.D. Ouspensky 1-46 150-154 $9.95 Download Special Offer: eBooks # 7 and # 8 (Gurdjieff / Ouspensky) in one eBook. $18.95 Produced January 4, 2004 Maurice Bassett Publishing, PO Box 4663, Chapel Hill, NC 27515 [email protected] Frankenstein’s Castle. Copyright © 1980, 2001 by Colin Wilson. Contributions by Michael Pastore are Copyright © 2001 by Zorba Press. All rights reserved. No part of this ebook may be reproduced or copied in any form without permission from the publisher, Maurice Bassett: [email protected] Colin Wilson asserts the moral right to be identified as the author of this work. -

1.5 the Emergence of Angry Young Men′S Literature
The Political and Social Reality of Post World War II in Britain as Reflected in the Novel Room at the Top by John Braine ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎ رواﻳﺔ ﺟﻮن ﺑﺮﻳﻦ: ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ Prepared by: Waad Suleiman Al-Zoubi Supervised by: Dr. Sabbar S. Sultan A thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For Master of Arts in English Language and Literature Department of English Language and Literature Faculty of Arts and Sciences Middle East University December, 2012 II III IV Acknowledgments I am grateful to my supervisor Dr. Sabbar Sultan for both his precious guidance and valuable time. I would like to express my gratitude to the examining committee members, Prof. Ekbal Al-Jabbari and Dr. Nayera El Miniawi for their dedicated work and valuable comments. Thanks are also extended to the faculty members of the Department of English at Middle East University. I wish to thank my husband for his support both morally and financially towards the completion of this thesis. V Dedications I dedicate this humble thesis to my country Syria and to the Syrians. I dedicate it to the soul of my beloved late father, my precious mother and family. I also dedicate the thesis to my beloved husband for both his patience and support; and to all the people who helped me to complete this thesis. VI Table of Contents Thesis Title………………………………………………… i Authorization……………………………………………… ii Thesis Committee Decision……………………………….. iii Acknowledgments………………………………………… iv Dedications………………………………………………… v Table of Contents………………………………………….. vi-viii Arabic Abstract……………………………………………. ix English Abstract…………………………………………….