Volume 22, 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Western Front the First World War Battlefield Guide: World War Battlefield First the the Westernthe Front
Ed 2 June 2015 2 June Ed The First World War Battlefield Guide: Volume 1 The Western Front The First Battlefield War World Guide: The Western Front The Western Creative Media Design ADR003970 Edition 2 June 2015 The Somme Battlefield: Newfoundland Memorial Park at Beaumont Hamel Mike St. Maur Sheil/FieldsofBattle1418.org The Somme Battlefield: Lochnagar Crater. It was blown at 0728 hours on 1 July 1916. Mike St. Maur Sheil/FieldsofBattle1418.org The First World War Battlefield Guide: Volume 1 The Western Front 2nd Edition June 2015 ii | THE WESTERN FRONT OF THE FIRST WORLD WAR ISBN: 978-1-874346-45-6 First published in August 2014 by Creative Media Design, Army Headquarters, Andover. Printed by Earle & Ludlow through Williams Lea Ltd, Norwich. Revised and expanded second edition published in June 2015. Text Copyright © Mungo Melvin, Editor, and the Authors listed in the List of Contributors, 2014 & 2015. Sketch Maps Crown Copyright © UK MOD, 2014 & 2015. Images Copyright © Imperial War Museum (IWM), National Army Museum (NAM), Mike St. Maur Sheil/Fields of Battle 14-18, Barbara Taylor and others so captioned. No part of this publication, except for short quotations, may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the permission of the Editor and SO1 Commemoration, Army Headquarters, IDL 26, Blenheim Building, Marlborough Lines, Andover, Hampshire, SP11 8HJ. The First World War sketch maps have been produced by the Defence Geographic Centre (DGC), Joint Force Intelligence Group (JFIG), Ministry of Defence, Elmwood Avenue, Feltham, Middlesex, TW13 7AH. United Kingdom. -

Hansel and Gretel” to America: a Study and Translation of a Puppet Show
BRINGING POCCI'S “HANSEL AND GRETEL” TO AMERICA: A STUDY AND TRANSLATION OF A PUPPET SHOW Daniel Kline A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS August 2008 Committee: Dr. Christina Guenther, Advisor Bradford Clark, Advisor Dr. Kristie Foell Margaret McCubbin ii ABSTRACT Dr. Christina Guenther, Co-Advisor; Bradford Clark, Co-Advisor My thesis introduces the German-puppet character Kasperl to English-language scholars. I provide historical background on the evolution of the Kasperl figure and explore its political uses, its role in children’s theatre, and the use of puppet theatre as an alternative means of performance. The section on the political uses of the figure focuses mainly on propaganda during the First and Second World Wars, but also touches on other developments during the Weimar Republic and in the post-war era. The television program Kasperl and the use of Kasperl for education and indoctrination are two major features in the section concerning children’s theatre. In the second section of the thesis, my study focuses on the German puppet theatre dramatist Franz von Pocci (1807-1876) and his works. I examine Pocci’s theatrical texts, positing him as an author who wrote not only for children’s theatre. Within this section, I interpret several of his texts and highlight the way in which he challenges the artistic and scientific communities of his time. Finally, I analyze and translate his puppet play Hänsel und Gretel: Oder der Menschenfresser. In the analysis I explore issues concerning science, family, government agencies, and morality. -

Wydawnictwa Xix - Xxi Wieku
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU 1. ALEXANDROWICZ Aleksander Witold ppłk. - Atlas do „Rozwoju historycznego fortyfikacji w zarysie”. Toru ń 1924. Nakł. Oficerskiej Szkoły Artylerji. Czc. Pomorskiej Druk. Rolniczej. 8 podł., 43 tablice z rysunkami, mapkami, przekrojami, okł. oryg. Podpis, ślad zło żenia. 80,- ——————————— 2. ARCISZEWSKI B[azyli ks. ] T. J. - Wykład historyczny i moralny świ ąt, obrz ędów, zwyczajów Ko ścioła Katolickiego. Lwów 1852. Druk. Ossol. 16d, s. X,11-360, opr. pł. Oprawa przetarta, 1 karta z małym ubytkiem dolnego rogu. Wykład z podziałem na 2 cz ęś ci: 1: Wykład historyczny i moralny świ ąt K. K., 2:: Wykład historyczny i moralny obrz ędów i zwyczajów K. K. 120,- ——————————— 3. M. ARCTA Słownik ilustrowany j ęzyka polskiego. Wyd.3. W-wa 1929. Wyd. M. Arcta. 8,s. [4],1211, liczne ilustracje w tek ście, opr. pł. oryg. Oprawa lekko przetarta, poza tym stan dobry. 150,- ——————————— 4. L'ARDECHE Laurent de - Histoire de l'empereur Napoléon. Illustrée par Horace Vernet . Paris 1840. J. J. Dubochet et Cie. 4, s.832, 46 barwnych litografii , ponad 600 drzeworytów w tek ście , frontispis , inicjały , opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Oprawa p ękni ęta przy grzbiecie, niewielkie ślady zawilgocenia na marginesach ko ńcowych kart.. 2 wydanie. Hagiografia Napoleona. Pi ęknie ilustrowane dzieło przez H. Verneta, przyczyniło si ę do budowania mitu „romantycznego cesarza”. Na szczególn ą uwag ę zasługuj ą barwne litografie przedstawiaj ące kostiumologi ę armii cesarskiej. Drzeworyty w wi ększo ści ze scenami batalistycznymi. H. Vernet (1789-1863), malarz i grafik franc., twórca obrazów historycznych, bitew napoleo ńskich, scen wojs- kowych, my śliwskich. -

The Jewish Kulturbund in Bavaria, 1934-‐1938
The Jewish Kulturbund in Bavaria, 1934-1938: Art and Jewish Self-Representation under National Socialism Dana LeiGh Smith Submitted in partial fulfillment of the requirements of the DeGree of DoCtor of Philosophy 1 I, Dana LeiGh Smith, Confirm that the researCh inCluded within this thesis is my own work or that where it has been carried out in collaboration with, or supported by others, that this is duly aCknowledGed below and my Contribution indiCated. Previously published material is also acknowledged below. I attest that I have exercised reasonable care to ensure that the work is original, and does not to the best of my knowledGe break any UK law, infrinGe any third party’s copyright or other Intellectual Property Right, or contain any confidential material. I aCCept that the ColleGe has the riGht to use plaGiarism deteCtion software to check the electronic version of the thesis. I Confirm that this thesis has not been previously submitted for the award of a degree by this or any other university. The CopyriGht of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written Consent of the author. Signature: Date: 16 July 2015 Details of collaboration and publications (published as of 16 July 2015): “‘Münchens Ruf als erste deutsChe Kunststadt…”: Der JüdisChe Kulturbund in Bayern, Ortsgruppe München (1934-1938)’ in Münchner Beiträge zur Jüdischen Geschichte und Kultur (Autumn 2014). ‘Die Arbeit des JüdisChen Kulturbundes’ in Das Jahr 1938: Kunstleben im Nationalsozialismus, ed. Julia Voss and Raphael Gross (Wallstein: DeCember 2013). -
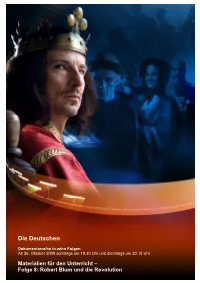
Die Deutschen
Die Deutschen Dokumentarreihe in zehn Folgen Ab 26. Oktober 2008 sonntags um 19.30 Uhr und dienstags um 20.15 Uhr Materialien für den Unterricht – Folge 8: Robert Blum und die Revolution Die Deutschen - Folge 8: Robert Blum und die Revolution 1. Inhalt des Films Im Mittelpunkt der achten Folge der Serie „Die Deutschen“ steht die Revolution von 1848/49. Thematisiert werden kurz die Ursachen, ausführlicher dagegen Verlauf und Begleiterscheinungen sowie die Folgen. Eng verknüpft werden die Ereignisse mit einem wichtigen Protagonisten der damaligen Zeit, dem Revolutionär Robert Blum (1807-1848), einer Symbolfigur der demokratischen Bewegung in Deutschland. Die wichtigsten Schauplätze sind Leipzig, der deutsche Südwesten, Berlin, Frankfurt am Main und schließlich Wien, wo Blum am 9. November 1848 erschossen wurde. Die Verkündung und der Vollzug des Todesurteils bilden die Rahmenhandlung der achten Folge. Die Darstellung beginnt mit einer Szene, die Robert Blum in einer Gefängniszelle beim Schreiben des Abschiedsbriefes an seine Ehefrau Eugenie, genannt „Jenny“, (geb. 1810) zeigt. Bevor das Todesurteil vollstreckt wird, erfolgt ein Rückblick in das Leipzig des Jahres 1844, wo Blum seit 1832 am Stadttheater beschäftigt und wegen eines kritischen Zeitungsartikels schon einmal verhaftet worden war. Als Autor und Herausgeber der regimekritischen Zeitung „Sächsische Vaterlandsblätter“ versuchte er seine Kritik gegen die erstarrte Herrschaftsordnung in den deutschen Ländern durch die Zensur zu bringen. Damit wird auf die innenpolitische Situation -

The Evolution of Strategy
This page intentionally left blank The Evolution of Strategy Is there a ‘Western way of war’ which pursues battles of annihilation and single-minded military victory? Is warfare on a path to ever greater destructive force? This magisterial new account answers these questions by tracing the history of Western thinking about strategy – the employ- ment of military force as a political instrument – from antiquity to the present day. Assessing sources from Vegetius to contemporary America, and with a particular focus on strategy since the Napoleonic Wars, Beatrice Heuser explores the evolution of strategic thought, the social institutions, norms and patterns of behaviour within which it operates, the policies that guide it and the culture that influences it. Ranging across technology and warfare, total warfare and small wars as well as land, sea, air and nuclear warfare, she demonstrates that warfare and strategic thinking have fluctuated wildly in their aims, intensity, limitations and excesses over the past two millennia. beatrice heuser holds the Chair of International History at the School of Politics and International Relations, University of Reading. Her publications include Reading Clausewitz (2002); Nuclear Mentalities? (1998) and Nuclear Strategies and Forces for Europe, 1949-2000 (1997), both on nuclear issues in NATO as a whole, and Britain, France, and Germany in particular. The Evolution of Strategy Thinking War from Antiquity to the Present Beatrice Heuser cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo, Mexico City Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521155243 © Beatrice Heuser 2010 This publication is in copyright. -

Dolls and Puppets As Artistic and Cultural Phenomena Dolls and Puppets As Artistic and Cultural Phenomena (19Th – 21St Centuries) Ed
Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries) ed. by Kamil Kopania Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena as ArtisticDolls and Puppets and Cultural The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw The Department of Puppetry Art in Białystok Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries) ed. by Kamil Kopania Reviewers: Dr. John Bell - Associate Professor, Dramatic Arts Department University of Connecticut; Director of Ballard Institute and Museum of Puppetry Prof. Florian Feisel - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Proofreading: Dr. Timothy Williams Layout, typesetting and cover design: Jacek Malinowski Copyright © 2016 by Kamil Kopania Copyright © 2016 by the Publisher Publisher: The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw The Department of Puppetry Art in Białystok Sienkiewicza 14 Str. 15-092 Białystok, Poland www.atb.edu.pl Publication supported by: The Institute of Art History, University of Warsaw www.ihs.uw.edu.pl Print and binding by: ARGRAF Sp. z o.o. Jagiellońska 80 Str., 03-301 Warsaw www.argraf.pl Print run: 300 ISBN: 978-83-938151-9-7 Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries) ed. by Kamil Kopania The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (The Department of Puppetry Art in Białystok) Table of Contents Kamil Kopania – Institute of Art History of the University of -

The Belgian People's War
Turxe coLLsas. TUFT Q .B4G3 ma The Belgian People's War A VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW TRANSLATIONS FROM THE OFFICIAL GERMAN WHITE BOOK PUBLISHED BY THE IMPERIAL FOREIGN OFFICE The Belgian People's War A VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW TRANSLATIONS FROM THE OFFICIAL GERMAN WHITE BOOK I PUBLISHED BY THE IMPERIAL FOREIGN OFFICE 1 1) ill PRESS OF JOHN C. RANKIN CO. NEW YORK PREFATORY NOTE TO THE ENGLISH EDITION In laying an English translation of the German White- Book on the franctireur war in Belgium before the public it should be pointed out—as may also be seen from the num- bering of the annexes—that the English version is not a com- plete rendering of the German original. Of the annexes, which contain over two hundred and twenty affidavits and reports, only about one-third have been included, so as to save the reader a wearisome repetition of numerous similar in- cidents and to give him, with less labor to himself, an ap- proximate idea of the kind of actions indulged in by the Belgian civilian population. The German original is open for inspection at the Imperial German Embassy and the Imperial German Consulates in this country. New York, July, 1915. INDEX. PAGE 1. Memorial of the Imperial German Foreign Office 5-10 2. Annexes concerning offenses in general 11-33 3. The- revolt of the Belgian population at Aerschot 35- 50 a. Summary report 37- 39 b. Annexes relative thereto 41- 50 4. The revolt of the Belgian population at Andenne 51- 57 a. Summary report 53- 54 b. -

Dolls and Puppets.Pdf
Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition ed. by Kamil Kopania Reviewers: Dr. John Bell - Associate Professor, Dramatic Arts Department University of Connecticut; Director of Ballard Institute and Museum of Puppetry Prof. Florian Feisel - Staatliche Hochschule für Musik Dolls and Puppets: und Darstellende Kunst Stuttgart Proofreading: Dr. Timothy Williams Contemporaneity Layout, typesetting and cover design: Jacek Malinowski Copyright © 2018 by Kamil Kopania Copyright © 2018 by the Publisher and Tradition Publisher: The Aleksander Zelwerowicz ed. by Kamil Kopania National Academy of Dramatic Art in Warsaw The Department of Puppetry Art in Białystok Sienkiewicza 14 Str. 15-092 Białystok, Poland www.atb.edu.pl Print and binding by: EPEdruk Sp. z.o.o. www.epedruk.pl Print run: 300 ISBN: 978-83-88358-02-9 Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition ed. by Kamil Kopania The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (The Department of Puppetry Art in Białystok) Table of Contents Kamil Kopania – Institute of Art History of the University of Warsaw / The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Poland Introduction 6 Pia Banzhaf – Queen’s University at Kingston, Ontario, Canada The Ontology of the Puppet 8 Fahimeh Mirzahosseini – Tehran Art University, Iran The Study of Reception Process of Children Aged Six to Eight Years, in Theatre, Based on Reception Phenomenological Approach 28 Insa Fooken, -

The Battle of Belleau Wood: America’S Indoctrination Into 20 Th Century Warfare
UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA Edmond, Oklahoma College of Graduate Studies and Research The Battle of Belleau Wood: America’s Indoctrination into 20 th Century Warfare A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTERS OF ARTS IN HISTORY, MUSEUM STUDIES By Kevin C. Seldon Edmond, Oklahoma 2010 The Battle of Belleau Wood: America’s indoctrination into 20 th Century Warfare A THESIS APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF HISTORY March 29, 2010 I have a rendezvous with Death At some disputed barricade, When Spring comes back with rustling shade And apple-blossoms fill the air-- I have a rendezvous with Death When Spring brings back blue days and fair. It may be he shall take my hand And lead me into his dark land And close my eyes and quench my breath-- It may be I shall pass him still. I have a rendezvous with Death On some scarred slope of battered hill, When Spring comes round again this year And the first meadow-flowers appear. God knows 'twere better to be deep Pillowed in silk and scented down, Where love throbs out in blissful sleep, Pulse nigh to pulse, and breath to breath, Where hushed awakenings are dear . But I've a rendezvous with Death At midnight in some flaming town, When Spring trips north again this year, And I to my pledged word am true, I shall not fail that rendezvous. -Alan Seeger Killed in action July 4, 1916 at Belloy-en-Santerre, France iii Acknowledgements There are many people who deserved my gratitude in writing this thesis. -

129 Aukcja Antykwaryczna 129 Aukcja
ANTYKWARIAT „RARA AVIS” 6 VI 2020 129 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AVIS” „RARA ANTYKWARYCZNA 129 AUKCJA 129 AUKCJA ANTYKWARYCZNA KSIĄŻKI – PLAKATY KRAKÓW 6 CZERWCA 2020 * 967, 1059, 133 (3 wol.), 108, 146, 1177 (7 wol.), 699, 92, 91, 864, 96 * 1374, 869 (3 wol.), 1143, 692, 690, 578, 534, 807, 696, 800, 1264 (2 wol.), 895, 138 (2 wol.), 913 (3 wol.), 728, 804 * 165, 178, 111, 113, 1131, 1237, 1052, 542, 144, 540 * 183, 136, 1245, 819, 737 (3 wol.), 859, 860, 861, 1278, 75, 112, 830, 727 * 10, 70, 72, 1147, 1157, 1326, 983, 889, 955, 143, 978, 131, 1096, 1257 * 1268, 154, 139, 958, 1381, 172, 988, 538, 533 Na przedniej okładce reprodukowano poz. 425 ISSN 1641-0041 ANTYKWARIAT „RARA AVIS” s.c. Założony w 1992 r. 129 AUKCJA ANTYKWARYCZNA KSIĄŻKI – PLAKATY 129/2020 6 czerwca 2020 June 6, 2020 Aukcja odbędzie bez udziału publiczności w formie licytacji online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid. Początek aukcji 6 czerwca 2020 (sobota), godz. 9.30. Wystawione na sprzedaż obiekty można oglądać do dn. 4 czerwca 2020 (czwartek) w antykwariacie po uprzednim telefonicznym, bądź mailowym uzgodnieniu terminu. Katalog z ilustracjami wszystkich obiektów aukcyjnych jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.raraavis.krakow.pl oraz na portalu OneBid: www.onebid.pl Wszelką korespondencję w sprawach aukcji prosimy kierować na adres: Antykwariat „RARA AVIS” ul. Szpitalna 11 31-024 Kraków z dopiskiem „Aukcja”. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: tel./fax: 12–422–03–90, tel. 12–429–16–48 w godz. 10–18 (sobota, godz. 10–14) lub e–mail: [email protected] Zachęcamy do składania zamówień pocztowych bezpośrednio za pomocą formularza na naszej stronie internetowej: www.raraavis.krakow.pl oraz na portalu OneBid: www.onebid.pl Konto bankowe: Bank PeKaO S.A., III O/Kraków, ul. -

Im Ersten Weltkrieg 1
II. Kasper(l) im Ersten Weltkrieg 1. Die Spielorte … Das Spiel mit Marionetten oder Handpuppen ist in der Zeit des Ersten Weltkriegs im deutschsprachigen Raum für mehrere gesellschaftliche Schauplätze belegt, statt- gefunden hat es sowohl in einem militärischen Umfeld als auch in zivilen Kontex- ten. Gerade in der Kriegszeit erlebte das Puppentheater, dessen traditionellen Büh- nen seit der Jahrhundertwende, mit den Worten des Autors, Theaterkritikers und Dramaturgen Melchior Schedler gesprochen, „[d]as Kinematographentheater und veränderte Schaubedürfnisse der Menge […] allmählich den Garaus“73 machten und für das seine Vertreter über neu definierte Maximen wie „künstlerisch“ bzw. „volks- kulturell wertvoll“ nach gesellschaftlicher Anerkennung strebten,74 vielerorts einen Aufschwung. Gespielt wurde in dreierlei Rahmen: im Hinterland, an den Fronten des Weltkriegs und in Gefangenenlagern. Die Überlieferungslage hinsichtlich der kulturellen Praxis des Theaterspiels im Krieg erweist sich gemeinhin als beschränkt oder – wie Baumeister es auf den Punkt bringt – „die hier besonders relevanten Unterhaltungsaktivitäten haben allenfalls fragmentarische Spuren hinterlassen“75. Gemäß Hermann Pörzgen, der 1927 bei der „Deutschen Theater-Ausstellung“ in Magdeburg die Abteilung „Kriegstheater“ gestaltet hatte,76 liegen die besonders spärlichen Zeugnisse im Falle des Puppenthe- aters der Weltkriegszeit „in der Natur der Sache. Puppenspiele kommen und gehen. Sie hinterlassen keine Programme, sie werden nur selten photographiert.“77 Doch 73 Melchior Schedler: Schlachtet die blauen Elefanten! Bemerkungen über das Kinderstück. Weinheim und Basel: Beltz 1973, S. 109. 74 Vgl. Fülbier, Handpuppen- und Marionettentheater in Schleswig Holstein, S. 27–28. 75 Martin Baumeister: Kriegstheater. Großstadt, Front und Massenkultur. 1914–1918. Essen: Klartext 2005. (= Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte. Neue Folge. 18.) S. 19. 76 Vgl.