Auen in Österreich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
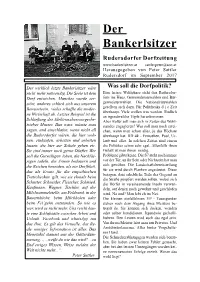
Der Bankerlsitzer September 2017
Seite 1 Der Bankerlsitzer September 2017 Der Bankerlsitzer Rudersdorfer Dorfzeitung www.bankerlsitzer.at [email protected] Herausgegeben von Peter Sattler Rudersdorf im September 2017 Der wirklich letzte Bankerlsitzer wäre Was soll die Dorfpolitik? nicht mehr notwendig. Die Seele ist dem Eine heisse Wahlphase steht den Rudersdor- Dorf entwichen. Manches wurde zer- fern ins Haus. Gemeinderatswahlen und Bür- stört, anderes schlich sich aus unserem germeisterwahlen. Die Nationalratswahlen Bewusstsein, vieles schaffte die moder- gesellten sich dazu. Für Politfreaks d i e Zeit überhaupt. Viele wollen was werden. Endlich ne Wirtschaft ab. Letztes Beispiel ist die an irgendwelche Töpfe herankommen. Schließung des Elektronahversorgerbe- Aber wofür soll man sich in Zeiten des Wohl- triebes Musser. Das wars, müsste man standes engagieren? Was soll man noch errei- sagen, und einschlafen, wenn nicht all chen, wenn man schon alles, ja das Höchste die Rudersdorfer wären, die hier woh- überhaupt hat. HD 4k - Fernsehen, Pool, Ur- nen, einkaufen, arbeiten und arbeiten laub und alles. In solchen Zeiten sind einem lassen, die hier zur Schule gehen etc. die Politiker schon sehr egal. Allenfalls ihren Sie sind immer noch gerne Dörfler. Wer Gehalt ist man ihnen neidig. soll die Gutwilligen loben, die Nachläs- Probleme gibts keine. Die S7 steht noch immer sigen tadeln, die Armen bedauern und vor der Tür, an ihr Sein oder Nichtsein hat man die Reichen beneiden, als ein Dorfblatt, sich gewöhnt. Die Landschaftsbereitstellung das als Ersatz für die empathischen für sie wird durch Planken angedeutet. Diese besagen, dass erhebliche Teile der Gegend an Tratschecken gilt, wie sie ehmals beim die Straße geopfert werden sollen, wobei sich Schuster, Schneider, Fleischer, Schmied, die Dörfer in vereinsamende Inseln verwan- Kaufmann, Wagner, Tischler, auf der deln, auf denen noch gewohnt und geschlafen Milchsammelstelle, am Feldrand, in der wird. -

Wir Sind Bereits Dabei! Niederösterreich Stand: Mai 2014 Burgen- Land
Wir sind bereits dabei! Niederösterreich Stand: Mai 2014 Burgen- land Steiermark Vorarlberg Salzburg Tirol Tirol Kärnten Kilometer 0 25 50 Grafik: Österreichische Energieagentur, Geschäftsstelle von e5-Österreich, Mai 2014 Burgenland: dorf (eee), Pitten (eee), Wiesel- Tirol: Die Träger des e5-Pogrammes stehen mit Rat und Tat zur Verfügung: Deutsch Kaltenbrunn, Eltendorf, burg (eee), Bisamberg (ee), Virgen (eeeee), Kufstein (eeee), Heiligenkreuz im Lafnitztal, Pressbaum (ee), Ternitz (ee), Schwaz (eeee), Wörgl (eeee), e5 Burgenland e5 Salzburg e5 Vorarlberg Jennersdorf, Königsdorf, Laa an der Thaya Kirchbichl (eee), Schwendau DI Johann Binder / Roland Pasterk DI Helmut Strasser Karl-Heinz Kaspar MSc Minihof-Liebau, Mogersdorf, Salzburg: (eee), Volders (eee), Angerberg Burgenländische Energieagentur Salzburger Institut für Energieinstitut Vorarlberg Mühlgraben, Rudersdorf, St. Johann im Pongau (eeeee), bei Wörgl (ee), Dölsach (ee), Tel. +43 (0)5 9010 22-23 / -33 Raumordnung & Wohnen (SIR) Tel. +43 (0)5572 31202 99 St. Martin an der Raab Grödig (eeee), Neumarkt am Kundl (ee), Mutters (ee), Trins [email protected] / Tel. +43 (0)662 623455 26 karl-heinz.kaspar@energie institut.at Kärnten: Wallersee (eeee), Thalgau (eeee), (ee), Eben am Achensee (e), [email protected] [email protected] www.e5-vorarlberg.at Kötschach-Mauthen (eeeee), Weißbach bei Lofer (eeee), Natters (e), Telfs (e), Vomp (e), www.eabgld.at www.e5-salzburg.at; www.sir.at Arnoldstein (eeee), Diex (eeee), Werfenweng (eeee), Bischofs- Zirl (e), Aschau im Zillertal, Eisenkappel (eeee), Schiefling hofen (eee), Elixhausen (eee), Ass ling, Innsbruck, Ramsau im e5 Kärnten e5 Steiermark In Ihrem Bundesland Zillertal, Roppen, Stams, (eeee), Trebesing (eeee), Villach Mühlbach am Hochkönig (eee), Mag. Jan Lüke Mag. -

Veranstaltungstipps Region Jennersdorf
Veranstaltungstipps Region Jennersdorf Veranstaltungstipps 24.06.2016 – 09.07.2016 bis Mo., 31.10.2016 Kunstgartenausstellung „Insekten & Skulpturen“ in der Kunstoase Slatar, Hintergasse 5, Rudersdorf. Nähere Infos & Anmeldung unter 0664/ 1635145 Fr., 24.06.2016, 14-17 Uhr Waldläuferbande für Kinder – Waldausflug mit einer Waldpädagogin. Treffpunkt: Stoagupf, Grieselstein. Infos unter 0680/2150907 Fr., 24.06.2016, 15 Uhr Workshop „Energetisch Testen mit Rute und Tensor“ im Raum für Natur & Bewusstsein, Mogersdorf-Bergen 289. Infos & Anmeldung unter 0664/ 311 13 87 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Schulfest der Volksschule Eltendorf, Kirchenstraße 18 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Familienfest im Kindergarten Heiligenkreuz i.L., Untere Hauptstraße 3 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Spanferkelgrillen im Gasthaus Mertschnigg, Bonisdorf. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Neuhauser Blasmusikkapelle. Infos unter 03329/2445 oder 0664/4300664. Fr., 24.06.2016, 18 Uhr Grillabend im Berggasthaus Pfingstl, Bergstraße 7, Rudersdorf. Infos unter 03382/71170 Fr., 24.06.2016, 20 Uhr Vernissage mit Werner Loder und Lesung mit Andrea Seiler in der Liebhaberei, Obere Marktstraße 33, Deutsch Kaltenbrunn. Ausstellungsdauer: 24.-26.06.2016. Infos unter 0699/ 19213365 Sa., 25.06.2016, ab 7 Uhr Flohmarkt an der B65 am Schotter-Parkplatz in Heiligenkreuz i.L. Infos unter 0664/ 1892315 Sa., 25.06.2016, 7 Uhr Taufrisch Morgenwanderung in Heiligenkreuz i.L. Treffpunkt: Gemeindeamt Heiligenkreuz, Untere Hauptstraße 1. Infos unter 03325/ 4202 Sa., 25.06.2016, 9 Uhr „Treffpunkt Naturerlebnis“ - Ein Naturparadies stellt sich vor, Raab-Altarmanbindung Welten, Hauptstraße 18, Welten Infos unter www.volksbildungswerk.at Seite 1 Veranstaltungstipps Region Jennersdorf Sa., 25.06.2016, 9.30 Uhr Geführte Kanufahrt auf der Raab von Neumarkt bis zur ungarischen Grenze. -

Das Burgenland Testet!
Designed by Freepik DAS BURGENLAND TESTET! INFORMATION ANMELDUNG TESTUNG Im Zeitraum 13. bis 17. Jänner Eine Online-Anmeldung ist ab Zum Test mitzubringen sind: 2021 finden im Burgenland 4. Jänner 2021 unter www. E-Card bzw. ein Ausweis und die landesweiten COVID-19- oesterreich-testet.at möglich. im besten Fall einen Ausdruck Antigen-Schnelltests statt. Sollten Sie über kein Internet des Laufzettels, den Sie bei der verfügen, ist eine Anmeldung Anmeldung zum Herunterladen Die Teilnahme an den Tests ist auch durch Personen, denen angeboten bekommen. freiwillig und kostenlos. Sie Ihre persönlichen Daten anvertrauen, möglich sowie per Teststationen erfahren Sie auch Grundsätzlich kann die gesamte Telefon unter 0800 220 330. bei der Online-Anmeldung unter Bevölkerung ab 6 Jahren Bei elektronischer Anmeldung www.oesterreich-testet.at. getestet werden (Minderjährige bekommen Sie einen Laufzettel müssen von einem Elternteil zum Download, den Sie bitte Getestet wird an allen Testtagen begleitet werden). nach Möglichkeit ausdrucken. von 7.30 bis 18.30 Uhr. MASSENTEST ANMELDUNG TESTSTATIONEN 13. bis 17. Jän. 2021 oesterreich-testet.at Jennersdorf 13. bis 17. JÄNNER 2021 Jennersdorf Bauhof Industriegelände 4, 8380 Jennersdorf 15. bis 17. JÄNNER 2021 Deutsch Kaltenbrunn Vereinshalle Höhenstraße 1, 7572 Dt. Kaltenbrunn Neuhaus am Klausenbach Turnsaal NMS Hauptstraße 2, 8385 Neuhaus am Klausenbach Heiligenkreuz/ Lafnitztal Grenzlandhalle ANMELDUNG Schulgasse 3, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal ab 6 Jahren PER TELEFON Rudersdorf Kultursaal freiwillig 0800 220 330 Hauptstraße 58, 7571 Rudersdorf WICHTIGE FRAGEN UND ANTWORTEN Wie komme ich zu meinem Testergebnis? Etwa ein bis zwei Stunden nach der Testung erhalten Sie per SMS/E-Mail einen Internet-Link, auf dem Sie Ihr Testergebnis abrufen können. -

Restoring Rivers for Effective Catchment Management
THEME: Environment (including climate change) TOPIC: ENV.2011.2.1.2-1 Hydromorphology and ecological objectives of WFD Collaborative project (large-scale integrating project) Grant Agreement 282656 Duration: November 1, 2011 – October 31, 2015 REstoring rivers FOR effective catchment Management Deliverable 2.1 Part 4 Deliverable Catchment Case Studies: Partial Applications of the Hierarchical Multi- Title scale Framework (authors of part 4 in alphabetical order*) B. Blamauer1, B. Camenen2, Author(s) R.C. Grabowski3, I.D.M. Gunn4, A.M. Gurnell3, H. Habersack1, A. Latapie2, M.T. O’Hare4, M. Palma5, N. Surian5, L. Ziliani5 1BOKU, 2IRSTEA, 3QMUL, 4NERC, 5University of Padova Due date to deliverable: 1 November 2014 Actual submission date: 30 October 2014 Project funded by the European Commission within the 7th Framework Programme (2007 – 2013) Dissemination Level PU Public X PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) D2.1 HyMo Multi-scale Framework IV. Partial Case Study Applications * Please cite the whole of Deliverable 2.1 as follows: A.M. Gurnell, B. Belletti, S. Bizzi, B. Blamauer, G. Braca, T.Buijse, M. Bussettini, B. Camenen, F. Comiti, L. Demarchi, D. García De Jalón, M. González Del Tánago, R.C. Grabowski, I.D.M. Gunn, H. Habersack, D. Hendriks, A. Henshaw, M. Klösch, B. Lastoria, A. Latapie, P. Marcinkowski, V. Martínez-Fernández, E . Mosselman, J.O. Mountford, L. Nardi, T. Okruszko, M.T. O’Hare, M. Palma, C. Percopo, M. -

Ecohydrological Sensitivity to Climatic Variables: Dissecting the Water Tower of Europe
Research Collection Doctoral Thesis Ecohydrological sensitivity to climatic variables: dissecting the water tower of Europe Author(s): Mastrotheodoros, Theodoros Publication Date: 2019 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000348653 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Diss.- No. ETH 25949 Ecohydrological sensitivity to climatic variables: dissecting the water tower of Europe A thesis submitted to attain the degree of DOCTOR OF SCIENCES of ETH ZURICH (Dr. sc. ETH Zurich) presented by THEODOROS MASTROTHEODOROS Diploma in Civil Engineering, National Technical University of Athens born on 14.06.1990 citizen of Greece accepted on the recommendation of Prof. Dr. Peter Molnar, examiner Prof. Dr. Paolo Burlando, co-examiner Prof. Dr. Christina (Naomi) Tague, co-examiner Prof. Dr. Valeriy Ivanov, co-examiner Dr. Simone Fatichi, co-examiner 2019 i ii Dedicated to my parents and grandparents and especially to my grandmother Eleni, who left us the very first day of my PhD studies iii iv Abstract The water balance in mountain regions describes the relations between precipitation, snow accumulation and melt, evapotranspiration and soil moisture and determines the availability of water for runoff in downstream areas. Climate change is affecting the water budget of mountains at a fast pace and it has thus become a priority for hydrologists to quantify the vulnerability of each hydrological component to climate change, in order to assess the availability of water in the near future. However, our incomplete understanding of mountain hydrology implies that our knowledge about the future water supply of billions of people worldwide is limited. -

KIG 2020 Max. Möglicher Zweckzuschuss Des Bundes (Gesamt)
max. möglicher Zweckzuschuss darunter bis zu 3% des des Bundes (gesamt) Gesamtbetrages f. Sommer- KIG 2020 betreuung von Kindern (nur 2020) GKZ Gemeinde max. ZZ in Euro in Euro 10101 Eisenstadt 1.696.783,59 50.903,51 10201 Rust 227.472,43 6.824,17 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 200.128,90 6.003,87 10302 Donnerskirchen 190.693,81 5.720,81 10303 Großhöflein 214.700,89 6.441,03 10304 Hornstein 325.091,53 9.752,75 10305 Klingenbach 120.769,25 3.623,08 10306 Leithaprodersdorf 125.172,29 3.755,17 10307 Mörbisch am See 233.885,59 7.016,57 10308 Müllendorf 147.187,52 4.415,63 10309 Neufeld an der Leitha 361.154,57 10.834,64 10310 Oggau am Neusiedler See 184.089,24 5.522,68 10311 Oslip 132.196,20 3.965,89 10312 Purbach am Neusiedler See 306.116,50 9.183,50 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 277.601,54 8.328,05 10314 Schützen am Gebirge 145.090,83 4.352,72 10315 Siegendorf 317.438,62 9.523,16 10316 Steinbrunn 277.601,54 8.328,05 10317 Trausdorf an der Wulka 218.999,10 6.569,97 10318 Wimpassing an der Leitha 166.581,89 4.997,46 10319 Wulkaprodersdorf 205.056,12 6.151,68 10320 Loretto 49.691,51 1.490,75 10321 Stotzing 88.270,58 2.648,12 10322 Zillingtal 98.439,52 2.953,19 10323 Zagersdorf 109.656,80 3.289,70 10401 Bocksdorf 83.972,37 2.519,17 10402 Burgauberg-Neudauberg 142.994,15 4.289,82 10403 Eberau 96.133,16 2.883,99 10404 Gerersdorf-Sulz 106.197,26 3.185,92 10405 Güssing 389.250,19 11.677,51 10406 Güttenbach 92.883,29 2.786,50 10407 Heiligenbrunn 77.158,13 2.314,74 10408 Kukmirn 209.039,83 6.271,19 10409 Neuberg im Burgenland 103.052,23 -

Ortsverzeichnis Des Burgenlandes 2019 IMPRESSUM
Ortsverzeichnis des Burgenlandes 2019 IMPRESSUM © Statistik Burgenland A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 T: +43 2682 600 2825 E: [email protected] www.burgenland.at Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Statistik Burgenland Amt der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion – Stabsstelle Präsidium A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 Redaktion und für den Inhalt verantwortlich Mag. Manfred Dreiszker T: +43 2682 600 2825 E: [email protected] Maria Stöger T: +43 2682 600 2830 E: [email protected] Gestaltungskonzept Atelier Unterkirchner Jankoschek, Wien Eisenstadt 2019 Urheberrecht. Die enthaltenen Daten, Tabellen, Grafi ken, Bilder etc. sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind Statistik Burgenland vorbehalten. Nachdruck kostenlos, aber nur mit Quellenangabe möglich. Haftungsausschluss. Statistik Burgenland sowie alle Mitwir- kenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Statistik Burgenland und die Ge- nannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtig- keit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle, unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Statistik Burgenland und alle Mitwirkenden legen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit, wird gelegentlich nur die feminine oder die maskuline Form gewählt. Dies impliziert -

Burgenland 2011.Indd
M i l i t ä r k o m m a n d o B u r g e n l a n d Ergänzungsabteilung: 7000 EISENSTADT, Martin-Kaserne, Ing. Hans-Sylvesterstraße 5 Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 0900 bis 1400 Uhr Telefon: 050201 / 15-41022 STELLUNGSKUNDMACHUNG 2011 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 3 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unter- ziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1993 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungs- kundmachung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 12.12.2011 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos BURGENLAND werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungs- 4. Wehrpflichtige, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können sich bei der Ergänzungsabteilung des Militärkom- kommission des Militärkommandos WIEN oder des Militärkommandos STEIERMARK der Stellung zugeführt. Das mandos BURGENLAND freiwillig zur vorzeitigen Stellung melden. Stellungsverfahren, bei welchem durch den Einsatz moderner medizinischer Geräte und durch psychologische 5. Stellungspflichtige, die durch Krankheit am Erscheinen vor der Stellungskommission verhindert sind, haben dies um- Tests die körperliche und geistige Eignung zum Wehrdienst genau festgestellt wird, nimmt in der Regel 1 1/2 Tage gehend dem Militärkommando/Ergänzungsabteilung durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung nachzuweisen. -
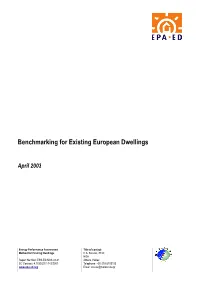
Benchmarking for Existing European Dwellings
Benchmarking for Existing European Dwellings April 2003 Energy P erformance A ssessment T itle of contact: M ethod for Existing Dwellings C .A. B a la ra s , Ph .D. NOA Report Number: EPA-ED NOA 03-01 Ath en s , H ella s EC C on tra c t: 4.1030/Z /01-142/2001 T eleph on e: + 30-210-8109152 www.epa-ed .org Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r Benchmarking for Existing European Dwellings A uthor/s Date: www.epa-ed .org C .A. B a la ra s , Ph .D. April 16, 2003 NOA P roject co-ord inator Ath en s , H ella s R eport N umb er: EB M -c on s ult, Arn h em, T eleph on e: + 30-210-8109152 EPA-ED NOA 03-01 T h e Neth erla n d s Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r EC C ontract M r. B a rt Poel E. Da s c a la k i, Ph .D. 4.1030/Z /01-142/2001 b poel@ eb m-consult.nl NOA Ath en s , H ella s T eleph on e: + 30-210-8109143 Ema il: ed a s k @ meteo.n oa .g r S . G eis s ler Ö Ö I V ien n a , Aus tria T eleph on e: + 43-15-236105 Ema il: g eis s ler@ ec olog y .a t K .B . W ittc h en DB U R H oers h olm, Den ma rk T eleph on e: + 45-45742395 Ema il: k bw @ by -og -by g .d k G . -

Sammelpunkte
Sammelpunkte Neben allen Ärzten werden folgende Punkte vom Jennersdorf-Taxi angefahren: Sie werden immer von zu Hause abgeholt und vom Sammelpunkt auch wieder nach Hause gebracht Gemeinde Sammelpunkt Anmerkung Deutsch Kaltenbrunn Gasthaus Kracher Rohrbrunn Deutsch Kaltenbrunn Gemeindezentrum Deutsch Kaltenbrunn Deutsch Kaltenbrunn Kreuzung Spar / Himmler Deutsch Kaltenbrunn Bergen Eltendorf Gemeindeamt Eltendorf Gemeindehaus Zahling Fürstenfeld Fachmarktzentrum FF Bushaltestelle Fürstenfeld Grazerplatz Bushaltestelle Fürstenfeld Krankenhaus Fürstenfeld Fürstenfeld Schillerplatz Bushaltestelle Heiligenkreuz i.L. Gemeindeamt Heiligenkreuz i.L. Bushaltestelle G1 Heiligenkreuz i.L. Raiffeisenbank Untere Hauptstraße 12 Heiligenkreuz i.L. Poppendorf / Gasthaus Paul Gibiser Hauptstraße 22 Jennersdorf Apotheke Jennersdorf Bahnhof Jennersdorf Jennersdorf Baumarkt Niederer Jennersdorf Burgenlandhof / Joy Haltestelle G1 Jennersdorf Fachmarktzentrum Rax Hofer/Langer Jennersdorf Freibad Jennersdorf Jennersdorf Rathaus Jennersdorf Jennersdorf REAL Jennersdorf Jennersdorf Thermendorf Hofer Grieselstein Königsdorf Badesee Königsdorf Gemeindeamt Königsdorf Badesee Minihof Liebau Dorfplatz Windisch-Minihof Minihof Liebau Feuerwehrhaus Tauka Minihof Liebau Gemeindeamt Minihof-Liebau Minihof-Liebau Buchgrabenhof Windisch-Minihof 17 Minihof-Liebau Gasthaus Hirtenfelder Windisch-Minihof 100 Minihof-Liebau Landhofmühle Fartek Windisch-Minihof 48 Mogersdorf Bahnhof Mogersdorf Mogersdorf Deutsch Minihof Ortsmitte Bushaltestelle G1 Mogersdorf Frisiersalon CINDY -

Corona-Testbus in Der Gemeinde
Neuhaus/Klb., 18.02.2021 CORONA-TESTBUS IN DER GEMEINDE Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ! Aufgrund der im Vergleich zu anderen Bezirken überdurchschnittlich hohen Inzidenzzahlen im Bezirk Jennersdorf hat das Land Burgenland die Testmöglichkeiten im Bezirk nochmals verstärkt. Zusätzlich zu den bestehenden Testzentren im Bezirk, die natürlich weiterhin aufrecht bleiben, wird nunmehr ab dieser Woche ein dezentraler Testbus mit einem mo- bilen Testteam aus Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Bundesheeres eingesetzt, der einzelne Gemeinden für jeweils vier Stunden anfährt und den Bürgern des Bezirkes die Möglichkeit zu Gratis-Testungen vor Ort bietet. Die Termine werden wöchentlich wiederholt und finden vorerst bis auf Widerruf statt. In unserer Gemeinde ist der Testbus jeweils Montags von 8 bis 12 Uhr; das erste Mal am Montag, den 22. Feber. Er steht am Parkplatzgelände beim Freibad. Es kann natürlich auch eine jede andere Station in Anspruch genommen werden. So be- findet sich der Bus z. B. am Montag Nachmittag von 13 bis 17 Uhr in Mühlgraben beim Gemeinde- und Feuerwehrhaus, Feldanergraben 1. Die weiteren Termine im Bezirk, auch jene mit den fixen Standorten, – so z. B. im Gesundheitszentrum Minihof-Liebau (Dr. Ei- cher) von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 13 Uhr – können Sie im Internet aus der entsprechenden Landes-Homepage entnehmen. Eine Anmeldung ist ab sofort wie gewohnt möglich, und zwar unter https://www.burgenland.at/coronavirus/coronatest/ . Selbstverständlich sind Ihnen auch die Mitarbeiter im Gemeindeamt bei der Anmeldung behilflich bzw. nehmen die Anmel- dung für Sie vor. Sie können den Testbus aber auch ohne Anmeldung besuchen. Planen Sie aber in einem solchen Fall eine eventuelle Wartezeit ein.