Theologinnen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
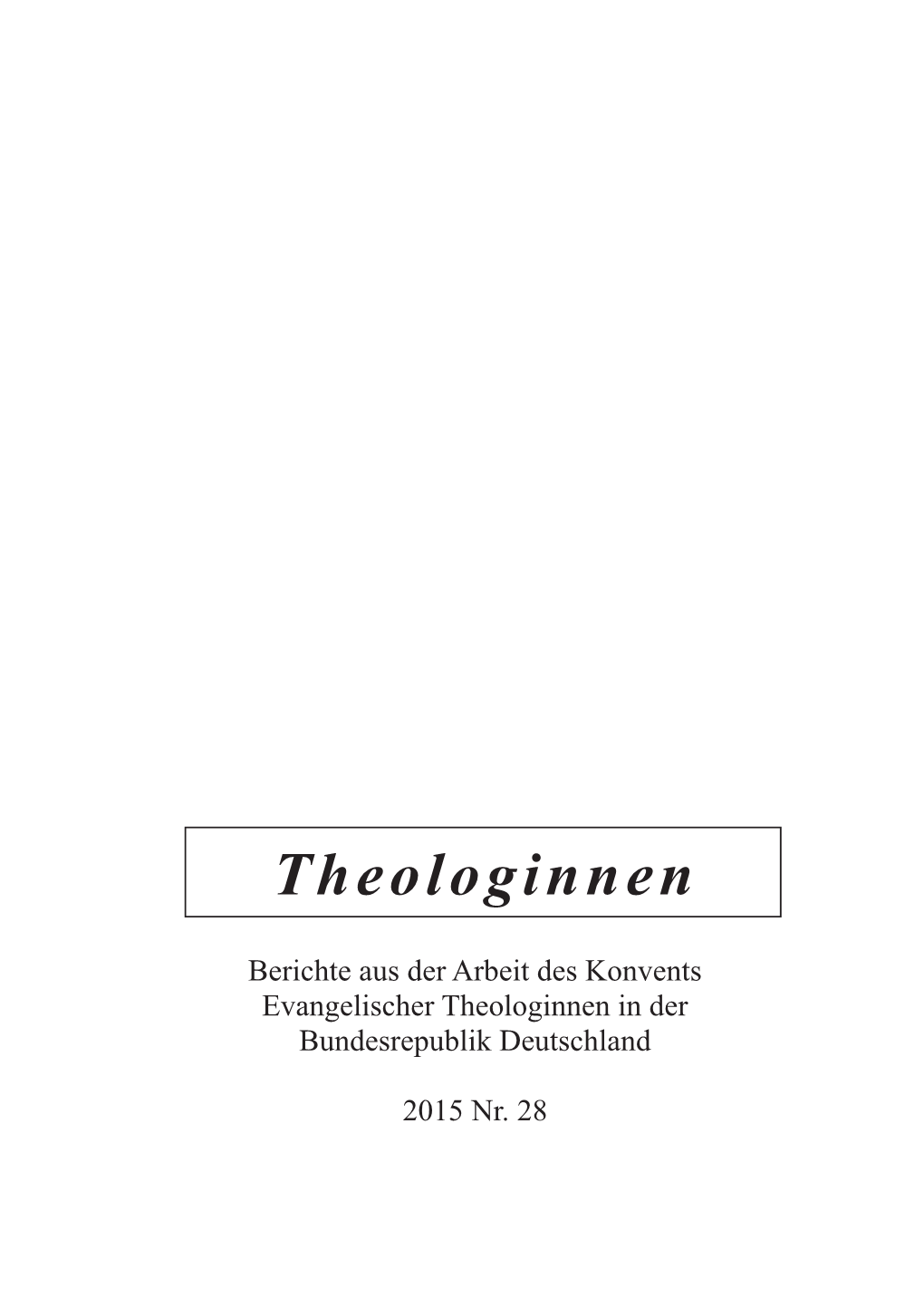
Load more
Recommended publications
-

19. August 2012 Vattenfall-Cyclassics 2012
Vattenfall-CyClassics 2012 19. August 2012 Ergebnisliste Damen/Herren Jedermann - 100km 16:06:56 INOFFIZIELLES ERGEBNIS 19.08.2012 PL: STEPHAN KOSLOWSKI 1/157 Ergebnisse Herren Rang St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Kat-Pl. Kat. Zeit 1 20497 Hinrichsen, Arne 1973 DEU *Hamburg 1. Senioren I 02:28:45.37 2 20667 Noack, Rico 1977 DEU BSG Deutsche Hypo 2. Senioren I 02:28:45.37 3 6806 Baltrusch, Herbert 1968 DEU RG SPRINTER EMDEN 1. Senioren II 02:28:45.38 4 20017 Gehrking, Oliver 1969 DEU Team Wiegetritt 2. Senioren II 02:28:45.73 5 20002 Behrendt, Ingo 1971 DEU Team Drinkuth 3. Senioren II 02:28:45.75 6 20021 Wehner, Joachim 1985 DEU Trenga DE Team 1. Männer 02:28:46.14 7 20005 Kolschefsky, Tom 1966 DEU Team Drinkuth 4. Senioren II 02:28:46.28 8 20020 Von Dem Knesebeck, Jörg 1964 DEU RG SPRINTER EMDEN 1 5. Senioren II 02:28:46.51 9 20050 Thoma, Jörg 1972 DEU RG SPRINTER EMDEN 3. Senioren I 02:28:46.64 10 20018 Böni, Stephan 1966 CHE Biesterfeld Team Europe 6. Senioren II 02:28:46.67 11 20058 Langrock, Simon 1984 DEU Velo Club Avanti Berlin 2. Männer 02:28:46.80 12 20030 Hauschild, Axel 1962 DEU Team Molfsee 7. Senioren II 02:28:47.58 13 20047 Syre, Jan 1977 DEU *Hamburg 4. Senioren I 02:28:47.91 14 20014 Grimme, Andreas 1970 DEU *Adelebsen 8. Senioren II 02:28:47.93 15 20026 Zierz, Florian 1980 DEU Team Maxim Magdeburg 5. -

Hartmut Hegeler Wikipedia Artikel 2013 Ohne Sonderzeichen.–
Wikipedia Artikel über Hartmut Hegeler 10. Juli 2013 Hartmut Hegeler (* 11. Juni 1946 in Bremen) ist ein deutscher evangelischer Pfarrer und Autor. Hegeler setzt sich für die Rehabilitation der Opfer der Hexenprozesse ein und betreibt dazu unter anderem eine Internetseite über Anton Praetorius (siehe Weblinks). Leben Hegeler absolvierte das Ratsgymnasium Bielefeld und studierte anschließend Theologie in der Kirchlichen Hochschule Bethel, Marburg und Heidelberg. Nach dem Studium ging er als Vikar der Evangelischen Kirche von Westfalen in den Auslandsdienst nach Indien. Anschließend war er als Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen in Recklinghausen tätig. Von 1974 bis 1976 wurde Hegeler von Dienste in Übersee, einer Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland, als Projektkoordinator in die Jemenitische Arabische Republik entsandt. Von 1976 bis 1982 war Hegeler Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde Dortmund- Huckarde. Anschließend arbeitete er als kreiskirchlicher Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Unna und unterrichtete Evangelische Religionslehre am Märkischen Berufskolleg. Zwischen 1999 und 2009 war Hegeler Bezirksbeauftragter für den Evangelischen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen im Kirchenkreis Unna. Weiterhin organisierte er Lehrerfortbildungen für Religionslehrer am Pädagogischen Institut Villigst und im Evangelischen Kirchenkreis Unna. Seit 2010 ist er pensioniert. Hegeler wohnt in Unna. Arbeiten zur Hexenverfolgung und zur Rehabilitation von Opfern der Hexenprozesse Seit 2000 beschäftigt -

Evangelische Kirche Von Westfalen - Landeskirchliches Archiv - Postfach 10 10 51 33510 Bielefeld Altstädter Kirchplatz 5 33602 Bielefeld Tel.: 0521/594-164
Archivmitteilungen, hg. v. Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen, Nr. 14, 2004. ISSN 1614-6468 Druck: Hans Kock, Buch- und Offsetdruck, Bielefeld Bezugsadresse: Evangelische Kirche von Westfalen - Landeskirchliches Archiv - Postfach 10 10 51 33510 Bielefeld Altstädter Kirchplatz 5 33602 Bielefeld Tel.: 0521/594-164 Für den Inhalt ihrer Beiträge sind die Autoren und Autorinnen selbst verantwortlich INHALT Inhalt Vorwort 3 Beiträge Claudia Brack 12. Arbeits- und Fortbildungstagung für Westfälische Kir- chenarchivare – Ein Tagungsbericht 4 Wolfgang Günther Rechtsstreit um ein Kirchenbuch 12 Archivpflege in der Praxis Matthias Rickling Alkohol – Sucht oder Sünde? Eine kirchliche Archivausstel- lung als Beitrag zum kulturellen Leben in Geschichte und Ge- genwart einer Region 17 Christine Koch Archivarbeit im Bereich der Ämter, Werke und Einrichtungen der EKvW 24 Harri Petras Mit Video und DVD 29 Geschichte Alfred Smieszchala St. Antonius Abbas in Kirchdornberg 32 Hartmut Hegeler Untersuchung der SS zu Hexenprozessen in Westfalen und Lippe 36 Geschichte in Quellen Johann Melzer Kuriosa aus Kirchenbüchern 38 Aus den Archiven Jens Murken Aus anderen evangelischen Archiven 41 Johannes Burkardt Quellen zur Geschichte evangelischer Kirchengemeinden im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Staatsarchiv Münster 49 Übersicht über die verfilmten Kirchenbücher im Landeskirch- lichen Archiv, Teil 2 75 Neue Findbücher in der Evangelischen Kirche von Westfalen 93 Neue Bücher 112 Nachrichten Recherchen Personalia 115 Autorinnen und Autoren 118 VORWORT Vorwort Liebe Leserinnen, liebe Leser, eine bunte Mischung von Erfahrungsberichten aus dem Bereich der Archivpflege, Anregungen für die archivfachliche Arbeit sowie für die lokal- und regionalhistorische Forschung erwarten Sie in dieser neuen Ausgabe der archivmitteilungen. Aus der Arbeit des Landeskirchlichen Archivs heraus wird über den Rechtsstreit um ein Kirchenbuch und die Archivarbeit im Bereich der Ämter, Werke und Einrichtungen der EKvW berichtet. -

Reinhard Wolf
Reinhard Wolf Pfarrerschicksal im Dreißigjährigen Krieg Leben und Wirken von Reinhard Wolf, Pfarrer und Hofprediger in der Kurpfalz und in Zerbst (Sachsen-Anhalt) und seine Leichenpredigt für Pfarrer Anton Praetorius, Kämpfer gegen Hexenprozesse von Hartmut Hegeler 2 3 Reinhard Wolf Pfarrerschicksal im Dreißigjährigen Krieg Leben und Wirken von Reinhard Wolf, Pfarrer und Hofprediger in der Kurpfalz und in Zerbst (Sachsen-Anhalt) und seine Leichenpredigt für Pfarrer Anton Praetorius, Kämpfer gegen Hexenprozesse von Hartmut Hegeler Sedanstr. 37, D- 59427 Unna Tel. 02303 – 53051 Email: [email protected] www.anton-praetorius.de Abb. 1 Grafik der Titelseite: Der tanzende Tod aus Schedels Weltchronik, Nürnberg, 1493 Abb. 2 Graphik aus: Anton Praetorius, De Sacrosanctis, 1602 (Titelseite) Patris soboles relligio Des Vaters Spross (Sohn) ist die vera religio summi wahre Verehrung des Höchsten Joh. 14,13b; 17,1c - Der Vater wird durch das Wirken des Sohnes verherrlicht (Übersetzung Burghard Schmanck) 4 Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, photomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art und auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, Verwendung des Bildmaterials sind untersagt und nur mit schriftlicher Einverständniserklärung -

9. Forschungsbericht
9. FORSCHUNGSBERICHT 2003 bis 2004 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG 9. Forschungsbericht 2003 bis 2004 Herausgegeben von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Senatsausschuss für Forschungsangelegenheiten Prof. Dr. Manuela Welzel (Fakultät III, Prorektorin) Prof. Dr. Christoph Selter-Sundermann, ab WS 04/05: Prof. Dr. Andreas Filler (Fakultät III) Prof. Dr. Hans-Joachim Motsch, ab WS 04/05: Prof. Dr. Theo Klauß (Fakultät I) Prof. Dr. Andreas Müller-Hartmann (Fakultät II) Prof. Dr. Angelika Strotmann (Fakultät II) AOR Regina Wieland (Vertreterin des Akademischen Mittelbaus) Markus Steinbrenner, ab WS 04/05: Klaus Dieter Block (Vertreter der Studierenden) Bisher erschienene Forschungsberichte: 1. Forschungsbericht 1971-1981 2. Forschungsbericht 1982-1987 3. Forschungsbericht 1988-1990 4. Forschungsbericht 1991-1993 5. Forschungsbericht 1994-1996 6. Forschungsbericht 1997-1998 7. Forschungsbericht 1999-2000 8. Forschungsbericht 2001-2002 9. FORSCHUNGSBERICHT 2003 bis 2004 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG Redaktion: Prof. Dr. Manuela Welzel Janine Jahnke Ruth Schneider © 2005 Pädagogische Hochschule Heidelberg Keplerstr. 87, D-69120 Heidelberg Druck: Druckerei & Verlag Steinmeier, Nördlingen Inhaltsverzeichnis 7 Inhaltsverzeichnis Vorwort des Rektors .............................................................................................................. 10 Einleitung................................................................................................................................ 13 Schriftenreihe der Pädagogischen -
Deutsche Nationalbibliografie 2018 a 15
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 A 15 Stand: 11. April 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-20171117655 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

EKD an Den Vorsitzenden Des Rates Der EKD, Herrn Landesbischof Prof
Arbeitskreis Hexenprozesse Hartmut Hegeler Sedanstr. 37 59427 Unna Tel. 02303 53051 www.anton-praetorius.de Email: [email protected] An den Rat der EKD An den Vorsitzenden des Rates der EKD, Herrn Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford- Strohm An die Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, Frau Professorin Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann Evangelische Kirche in Deutschland Herrenhäuser Str. 12 30419 Hannover Tel.: 0511 / 27 96- 0 E-Mail: [email protected] Antrag/Resolution zum 500. Jahrestag der Reformation: Rehabilitation der Opfer der Hexenprozesse Wir bitten die EKD zum 500. Jahrestag der Reformation einen zentralen Gedenkgottesdienst während des Evangelischen Kirchentags 2017 in Berlin oder auf einem der "Kirchentage auf dem Weg" durchzuführen, in dem die theologische Begründung der Hexenprozesse öffentlich widerrufen und die Opfer - Frauen, Männer und Kinder - durch Aufklärung, Wahrnehmung ihrer Schicksale und der liturgischen Bitte um Vergebung rehabilitiert werden. In vielen Landeskirchen bemühen sich einzelne Arbeitskreise seit Jahrzehnten um die Rehabilitierung der als Hexen verfolgten Menschen. Das Gedenkjahr 2017 ist ein wichtiger Zeitpunkt, diese Anstrengungen zu bündeln und die Rehabilitierung der Opfer auf EKD- Ebene öffentlich zu machen. Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der EKD, liebe Schwestern und Brüder! Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Bischof Prof. Dr. Bedford-Strohm! Sehr geehrte Frau Botschafterin Prof. Dr. Käßmann! Als Landesbischof haben Sie, Herr Bedford-Strohm, sich 2012 zu den Hexenprozessen geäußert: "Die evangelische Kirche blickt heute mit tiefer Betroffenheit auf die Zeiten zurück, in denen Frauen und Männer bei Hexenprozessen auf qualvolle Weise hingerichtet wurden". "So wichtig Luthers theologische Entdeckungen bis heute für unsere Kirche sind, so wenig dürfen seine Irrtümer verschwiegen werden. -

Deutsche Nationalbibliografie 2010 B 45
Deutsche Nationalbibliografie Reihe B Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2010 B 45 Stand: 10. November 2010 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin) 2010 ISSN 1869-3954 urn:nbn:de:101-ReiheB45_2010-5 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe B werden Medienwerke, die außerhalb des Ver- den, sofern sie eine eigene Sachgruppe haben, innerhalb lagsbuchhandels erscheinen, angezeigt. Außerhalb des der eigenen Sachgruppe aufgeführt, ansonsten unter der Verlagsbuchhandels erschienene Medienwerke die von Sachgruppe des Gesamtwerkes. Innerhalb der Sachgrup- gewerbsmäßigen Verlagen vertrieben -

Bibliographie Zur Geschichte Der Hexenverfolgungen in Westfalen Und Lippe
Burkhard Beyer Christian Möller Bibliographie zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Westfalen und Lippe Erste Ausgabe Juni 2019 Materialien der Historischen Kommission für Westfalen Band 17 Burkhard Beyer Christian Möller Bibliographie zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Westfalen und Lippe Erste Ausgabe Juni 2019 Materialien der Historischen Kommission für Westfalen Band 17 © 2019 Historische Kommission für Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Historische Kommission für Westfalen Geschäftsstelle: Postanschrift: Salzstraße 38 (Erbdrostenhof) Landschaftsverband Westfalen-Lippe 48143 Münster Historische Kommission für Westfalen Telefon (0251) 591-4720 48133 Münster Fax (0251) 591-5871 Email: [email protected] www.historische-kommission.lwl.org Inhalt Vorwort . 4 Ausgewertete Quellen . 5 1. Bibliographien . .. 6 2. Handbücher und Lexika . .. 6 3. Quellenkunde und Quellenprobleme . 6 4. Gesamtdarstellungen (in Auswahl) . 7 5. Sammelbände . 12 6. Übergreifende Darstellungen zu Westfalen . .. 14 7. Übergreifende Darstellungen benachbarten Regionen (in Auswahl) . 15 8. Darstellungen zu heutigen Regionen in Westfalen und Lippe . .. 17 9. Darstellungen zu historischen Territorien in Westfalen und Lippe . .. 18 10. Darstellungen zu einzelnen Orten und Bezirken A–Z . 25 11. Darstellungen zu einzelnen Personen A–Z . 48 12. Untersuchungen zu Einzelaspekten a) Juristische Fragen . 51 b) Stellung der Kirchen zur Hexenverfolgung . 52 c) Stellung der Aufklärung zur Hexenverfolgung . 53 d) Sprachwissenschaftliche Untersuchungen . 54 e) Medizinische -

Michael Quante Und Tim Rojek Entscheidungen Als Vollzug Und Im Bericht
Ulrich Pfister (Hg.) Kulturen des Entscheidens Narrative – Praktiken – Ressourcen Kulturen des Entscheidens Herausgegeben von Jan Keupp, Ulrich Pfister, Michael Quante, Barbara Stollberg-Rilinger und Martina Wagner-Egelhaaf Band 1 Kulturen des Entscheidens Narrative – Praktiken – Ressourcen Herausgegeben von Ulrich Pfister Mit 11 Abbildungen Vandenhoeck & Ruprecht Dieser Band ist im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1150 »Kulturen des Entscheidens« entstanden und wurde auf seine Veranlassung unter Verwendung der ihm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel gedruckt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen Umschlagabbildung: Bartholomeus van Bassen: The Ridderzaal of the Binnenhof during the Great Assembly of 1651, ca. 1651. Rijksmuseum Amsterdam | wikimedia Commons Satz: textformart, Göttingen | www.text-form-art.de Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2626-4498 ISBN (Print) 978-3-525-35689-0 ISBN (PDF) 978-3-666-35689-6 https://doi.org/10.13109/9783666356896 Dieses Material steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Inhalt Vorwort . 9 Ulrich Pfister Einleitung . 11 Entscheiden beobachten Michael Quante und Tim Rojek Entscheidungen als Vollzug und im Bericht. Innen- und Außenansichten praktischer Vernunft . 37 Robert Schmidt Entscheiden als retroaktives Regelfolgen . 52 Narrative und Reflexionen Martina Wagner-Egelhaaf Trauerspiel und Autobiographie. Handeln und Entscheiden bei Goethe . 71 Isabel Heinemann, Sarah Nienhaus, Mrinal Pande und Katherin Wagenknecht Heirat, Hausbau, Kinder. -

Bibliographie Zur Geschichte Der Hexenverfolgungen in Westfalen Und Lippe
Burkhard Beyer Jan-Hendrik Evers Christian Möller Bibliographie zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Westfalen und Lippe Zweite Ausgabe Oktober 2020 Materialien der Historischen Kommission für Westfalen Band 17 Burkhard Beyer Jan-Hendrik Evers Christian Möller Bibliographie zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Westfalen und Lippe Zweite Ausgabe Oktober 2020 Materialien der Historischen Kommission für Westfalen Band 17 © 2020 Historische Kommission für Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Historische Kommission für Westfalen Geschäftsstelle: Postanschrift: Salzstraße 38 (Erbdrostenhof) Landschaftsverband Westfalen-Lippe 48143 Münster Historische Kommission für Westfalen Telefon (0251) 591-4720 48133 Münster Fax (0251) 591-5871 Email: [email protected] www.historische-kommission.lwl.org Inhalt Vorwort zur ersten Ausgabe . 4 Vorwort zur zweiten Ausgabe . 5 1. Bibliographien und Datenbanken . .. 6 2. Handbücher und Lexika . .. 8 3. Quellenkunde und Quellenprobleme . 9 4. Gesamtdarstellungen (in Auswahl) . 10 5. Sammelbände . 17 6. Übergreifende Darstellungen zu Westfalen . .. 19 7. Übergreifende Darstellungen zu benachbarten Regionen (in Auswahl) . 22 8. Darstellungen zu heutigen Regionen in Westfalen und Lippe . .. 26 9. Darstellungen zu einzelnen historischen Territorien in Westfalen und Lippe . 28 10. Darstellungen zu einzelnen Orten und Bezirken . 42 11. Darstellungen zu einzelnen Personen . 100 12. Untersuchungen zu Einzelaspekten a) Juristische Fragen . 110 b) Universitäten als Gutachter in Hexenprozessen. 113 c) Stellung -

Als PDF-Dokument
1 D 1268 F Februar 2010 t t a l b r r a f Zweimonatsschrift für Pfarrerinnen und Pfarrer aus Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck und Thüringen P s Anton Praetorius (1560 – 1613) – Erinnerung an e einen Kämpfer gegen Hexenprozesse und Folter 3 125 Jahre Rudolph Zentgraf – h Sein Leben und Wirken 9 c Die EKHN ohne ihr Leitendes Geistliches Amt? 15 s i Einladung zum Pfarrtag für Kurhessen-Waldeck Mittelteil s s e H Rüdiger Haug, der derzeit „In Memoriam“ für EDITORIAL Südhessen bearbeitet, die wichtige Sonder - nummer des Hessischen Pfarrblattes. Seine An - Liebe Leserin, lieber Lese r, regungen, wie die oft mühevolle Recherchear - beit erleichtert werden kann, sind bedenkens - vor Ihnen liegt die erste Ausgabe des Hessi - wert – hoffentlich kann das Erscheinen dieser schen Pfarrblattes im Jahr 2010. Allmählich ge - besonderen Publikation auch für die EKHN wöhnen wir uns an diese erste Jahreszahl ei - weiter sichergestellt werden! nes neuen Jahrzehnts, zu der die einen „zwan - zigzehn“, die anderen „zweitausendzehn“ sa - Wir sind übrigens sicher, dass Sie trotz der gen. Die sogenannten „Nullerjahre“ sind vor - vielen Facetten des Stichwortes „Krise“ in die - bei – was von ihnen bleibt, darüber mögen ser ersten Ausgabe des Pfarrblattes in 2010 die spätere Historiker befinden. Ziemlich sicher Lust an der Lektüre nicht verlieren werden – aber wird das Stichwort „Krise“ genannt wer - wir selbst haben bei der Erstellung dieses Hef - den, das gute Chancen hat, als ein Wort des tes jedenfalls nicht „die Krise gekriegt“, son - Jahrzehnts in die Geschichtsbücher einzuge - dern uns hat die Zusammenstellung der Beiträ - hen. Und irgendwie durchzieht dieses Stich - ge Freude gemacht und weiterführende Er - wort auch die Beiträge in dieser Ausgabe des kenntnisse geschenkt.