Erinnerungen an Alfred Kerr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
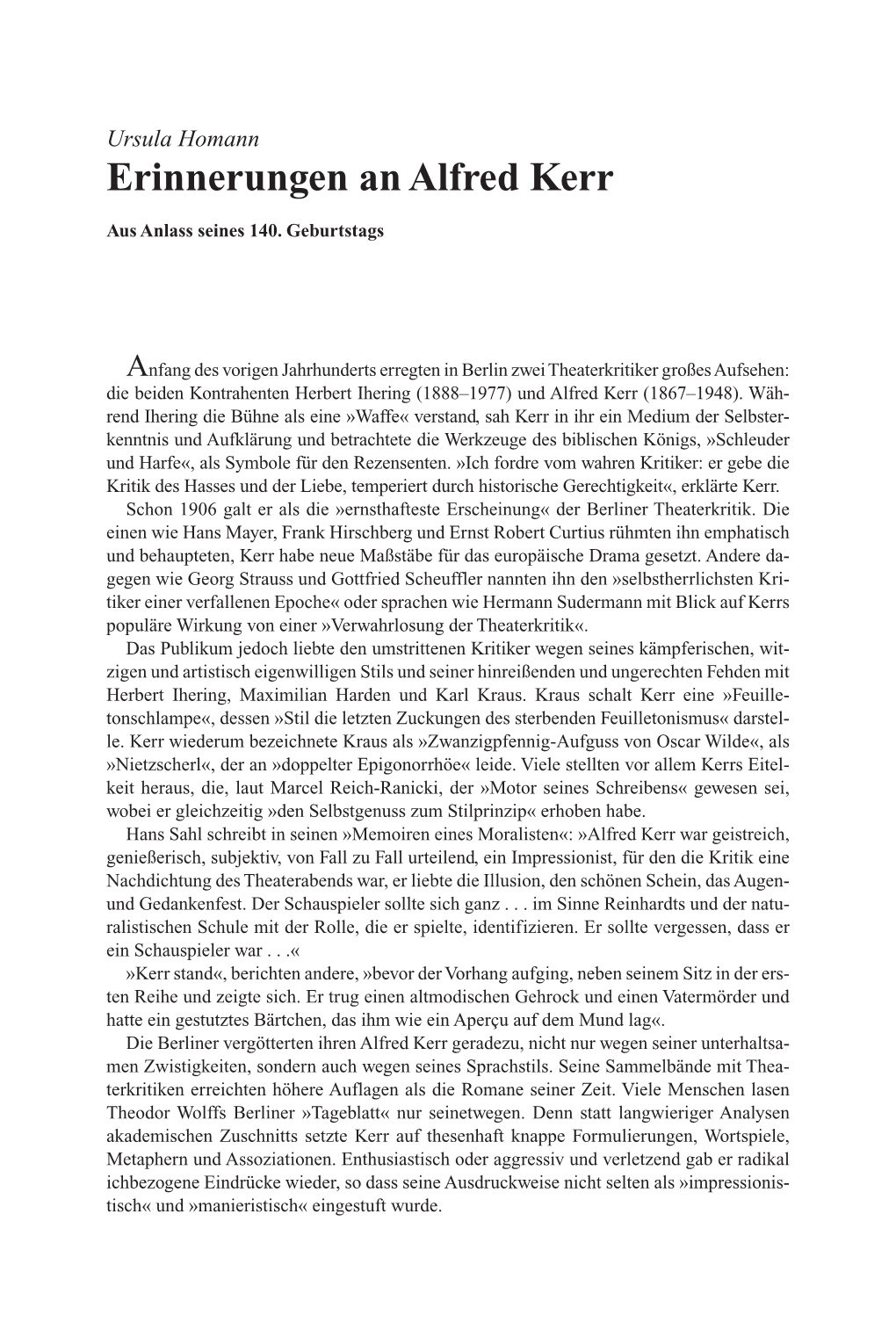
Load more
Recommended publications
-

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Hinweis 9 Das Theater der Republik 11 Weimar und der Expressionismus 11 Die Väter und die Söhne 12 Die Zerstörung des Dramas 14 Die neuen Schauspieler 16 Die Provinz regt sich 18 Los von Berlin - Los von Reinhardt 20 Berlin und Wien 22 Zersetzter Expressionismus 24 Die große Veränderung 25 Brecht und Piscator 27 Wirklichkeit! Wirklichkeit! 30 Hitler an der Rampe 33 Der große Rest *35 Wieviel wert ist die Kritik? 37 Alte und neue Grundsätze 38 Selbstverständnis und Auseinandersetzungen 41 Die Macht und die Güte 44 *9*7 47 Rene Schickele, Hans im Schnakenloch 48 rb., Frankfurter Zeitung 48 Alfred Kerr, Der Tag, Berlin 50 Siegfried Jacobsohn, Die Schaubühne, Berlin 52 Georg Kaiser, Die Bürger von Calais 53 Kasimir Edschmid, Neue Zürcher Zeitung 54 Heinrich Simon, Frankfurter Zeitung 55 Alfred Polgar, Vossische Zeitung, Berlin 56 Georg Kaiser, Von Morgens bis Mitternachts 57 Richard Elchinger, Münchner Neueste Nachrichten 58 Richard Braungart, Münchener Zeitung 60 P. S., Frankfurter Zeitung 61 Richard Specht, Berliner Börsen-Courier 62 Oskar Kokoschka, Mörder, Hoffnung der Frauen - Hiob - Der bren nende Dornbusch 63 Robert Breuer, Die Schaubühne, Berlin 64 Bernhard Diebold, Frankfurter Zeitung 66 Alfred Kerr, Der Tag, Berlin 69 Gerhart Hauptmann, Winterballade .. 72 Siegfried Jacobsohn, Die Schaubühne, Berlin 73 Julius Hart, Der Tag, Berlin 75 Emil Faktor, Berliner Börsen-Courier 77 1248 http://d-nb.info/207309981 Georg Kaiser, Die Koralle 79 Bernhard Diebold, Frankfurter Zeitung 79 Kasimir Edschmid, Vossische Zeitung, Berlin, und Neue Zürcher Zei tung 82 Emil Faktor, Berliner Börsen-Courier 83 Alfred Kerr, Der Tag, Berlin 84 Hanns Johst, Der Einsame, ein Menschenuntergang 86 Artur Kutscher, Berliner Tageblatt . -

The Tiger Who Came to Tea / Mog the Forgetful Cat Free
FREE THE TIGER WHO CAME TO TEA / MOG THE FORGETFUL CAT PDF Judith Kerr | 70 pages | 05 Nov 2015 | HarperCollins Publishers | 9780008144012 | English | London, United Kingdom The Tiger Who Came to Tea and The Adventure's of Mog the Forgetful Cat Born in the Weimar Republic and a Jewshe came to Britain with her family in during the rise of the Nazis. Kerr was born in Berlin, [8] the daughter of Alfred Kerr —a theatre criticand Julia Kerr born Julia Anna Franziska Weismann; —[9] [10] [11] a composer who was the daughter of a Prussian politician. The Tiger Who Came to Tea / Mog the Forgetful Cat Kerr had a brother, Michael. Early in March[8] the family heard a rumour that, should the Nazis come to power in the forthcoming electionthey planned to confiscate their passports and arrest Alfred Kerr for having openly criticised the party. The family later travelled to France, before finally settling in Britain inwhere Judith Kerr lived for the remainder of her life. During the Second World War, Judith Kerr worked for the Red Crosshelping wounded soldiers, before being awarded a scholarship to study at the Central School of Arts and Crafts and becoming an artist. He wrote the cult TV science-fiction serial The Quatermass Experiment for which Kerr helped make and operate the special effects. Kneale later prompted her to apply for a job as a BBC television scriptwriter. Kerr and Kneale were married in ; they remained married until his death in They had two children, a daughter Tacy born and a son Matthew born Kerr lived in the same house in BarnesLondon, from until her death on the 22nd May Kerr is best known for her children's books. -

Judith Kerr Fact Cards
Judith Kerr was born in Berlin in Germany on 14 June 1923. Judith’s father Alfred Kerr was a famous drama critic who wrote books and witty verses. Judith’s mother was a pianist and composer who wrote two operas. www.teachingideas.co.uk © Images: © ThinkStock Judith’s father used to travel through the dangerous streets of Berlin under escort so he could make weekly anti-Nazi broadcasts. His books were burned and a reward was offered for his capture. In 1933, when Judith was only 9 years old, she escaped Germany with her parents and brother. They fnally arrived in England in 1936. www.teachingideas.co.uk © Images: © ThinkStock During the Second World War, Judith worked for the Red Cross helping wounded soldiers. In 1945, Judith won a scholarship to the Central School of Arts and Crafts in London. www.teachingideas.co.uk © Images: © ThinkStock Judith has had many different jobs. She has worked as an artist, a BBC television scriptwriter and as an author and illustrator of children’s books. Many of Judith’s books are based on the quirks of her own pet cats. www.teachingideas.co.uk © Images: © ThinkStock Judith’s frst children’s book was The Tiger Who Came to Tea. This was frst published in 1968 and has now sold over 5 million copies. The Tiger Who Came to Tea started out as a bedtime story Kerr created to tell her own daughter. www.teachingideas.co.uk © Images: © ThinkStock Kerr has also written some semi-autobiographical novels such as When Hitler Stole Pink Rabbit. -

Deborah Vietor-Engländer, Alfred Kerr. Die Biographie, Rowohlt Verlag, Reinbek 2016, 717 S., Geb., 29,95 €, Auch Als E-Book Erhältlich
Deborah Vietor-Engländer, Alfred Kerr. Die Biographie, Rowohlt Verlag, Reinbek 2016, 717 S., geb., 29,95 €, auch als E-Book erhältlich. Deborah Vietor-Engländer hat eine Biografie über Alfred Kerr (1867–1948) geschrieben. Sie hat mehr getan als das: Sie ist in sein Leben eingetaucht. Vollführt kräftige Schwimmzüge, verweilt hier und dort. Und lässt uns den Strom spüren. Man kann sich nicht lösen. Man lebt dieses Leben mit. Selbst die Sprache steckt an: ihre und Kerrs. Eleganter ist wohl kaum eine Biografie der letzten Jahre kompo- niert worden. Wir folgen dem jungen Kerr aus der Heimatstadt Breslau in die erwachende Metropole Berlin, die er erobern wollte. Das Erlebnis „Gerhart Hauptmann“ war's – 1889 –, das ihn zum Kritiker, später: zu dem Kritiker der Reichshauptstadt machte. Bis er herausgefordert wurde von dem jüngeren Herbert Jhering. Hieraus entspann sich ein Kampf der (Feuilleton-)Giganten, in dem Jhering – der Eindruck drängt sich auf – das Kriegsrecht aber mehr achtete als der überschäumende Kerr. Mit Karl Kraus war das anders: Da standen sich zwei gegenüber, die auch den Griff in die unterste Schublade nicht scheu- ten, der eine aus purem Übermut, der andere aus galligem Neid. Maximilian Harden und Kerr moch- ten sich ohnehin nicht. Max Reinhardt, dessen Erscheinen er begrüßt hatte, wurde ihm mit der Zeit zum verachteten Theater-Unternehmer. Siegfried Jacobsohn, den Begründer der „Weltbühne“, nahm er als Konkurrenz nicht ernst und verfolgte ihn doch mit laut tönender Geringschätzung. Mit dem Berliner Polizeipräsidenten Traugott von Jagow und später auch mit seinem eigenen Schwiegervater, einem Staatssekretär, focht Kerr öffentliche Sträuße aus. Diese Fehden, die er zu genießen schien und in denen sachliche und persönliche Motive sich mischten, erlebt der Leser in Vietor-Engländers Erzäh- lung nach. -

Theaterkritik Praxis Und Theorie Ihrer Produktiven Möglichkeiten Am Beispiel Herbert Iherings
Theaterkritik Praxis und Theorie ihrer produktiven Möglichkeiten am Beispiel Herbert Iherings Der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig eingereichte D I S S E R T A T I O N zur Erlangung des akademischen Grades DOCTOR PHILOSOPHIAE (Dr. phil.) vorgelegt von Fee Isabelle Lingnau geboren am 22.02.1980 in Hamburg Gutachter: Prof. Dr. Günther Heeg Prof. Dr. Patrick Primavesi Disputation: 11.07.2013 1 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG WAS UND ZU WELCHEM ZWECK IST THEATERKRITIK. EINE FRAGESTELLUNG. ∣4 Inhalt und Form – eine Aussicht ∣9 1. ALLTÄGLICH UND NICHT GREIFBAR? KRITIK! ODER KREISEN UM EIN PHÄNOMEN AUF DER SUCHE NACH WERKZEUG ∣12 I. PRÄGENDE UND PRÄGENDES–VORBILDER UND FEINDBILDER. EINFLÜSSE IN DEN LEHRJAHREN HERBERT IHERINGS ∣19 Kritik in Antithese: Theater als Anlass für Poesie oder Kampf–Die KunstKritik Alfred Kerrs∣24 Bildungskanone und Zwirbelbart. Germanistik in Persona Erich Schmidt∣28 Die Schaubühne als gesellschaftliche Anstalt betrachtet–Siegfried Jacobsohn, Regisseur der Schaubühne∣39 Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Exkursion zum Geist∣49 Die Bewegung vom Leben zur Kunst zum Leben zur Kunst zum–Julius Bab der Einflussreiche∣52 Theaterpraxis als Kritikerschule∣59 Krieg und Frieden in Wien∣62 Prägende und Prägendes als Position und Negation∣67 2. DIE EINZELNE EXISTENZ AM WESEN, DIE BESONDERE WIRKLICHKEIT AN DER IDEE MESSEN ÜBER DIE NOTWENDIGKEITEN VON MASSSTAB UND URTEIL ∣70 II. HINTERGRÜNDE UND UNTERGRÜNDE DIE HALTUNG HERBERT IHERINGS ZU KRITIK IN SEINEN THEORETISCHEN SCHRIFTEN FORMULIERT UND DARAUS EXTRAHIERT ∣80 Der Kampf ums Theater (1922) – Suche nach der Krise∣84 2 Zahnrad Theater – im Verhältnis zu Inhalt, Form und Technik∣88 Der Volksbühnenverrat (1928)∣92 Die vereinsamte Theaterkritik (1928)∣96 Reinhardt, Jessner, Piscator oder Klassikertod?∣100 Zusammen-gefasst: der Kritiktheoretiker und der Theaterkritiker∣103 3. -

CFP: Literature, Language and Culture During the Weimar Republic, Bucharest (15.08.2018)
H-Germanistik CFP: Literature, Language and Culture during the Weimar Republic, Bucharest (15.08.2018) Discussion published by Raluca Radulescu on Monday, June 11, 2018 Call for Papers Second international multidisciplinary Conference Department of Germanic Languages and Literatures at the University of Bucharest this year’s topic: “Literature, Language and Culture during the Weimar Republic” October 25th-26th 2018 Place: University of Bucharest, Faculty of Foreign Languages, Department of Germanic Languages and Literatures Languages: German and English The Department of Germanic Languages and Literatures at the University of Bucharest hosts in October 25th and 26th 2018 its second annual international multidisciplinary conference. This year’s subject is the Weimar Republic, which stretches from the end of the First World War through the Golden Twenties and the Great Depression to the beginning of the Nazi dictatorship with Hitler's seizure of power, being one of the most prolific artistic phases of German literary and cultural history. Literature, theatre, painting, architecture experienced in their various stylistic characteristics (expressionism, avant-garde, the so called New Objectivity) fresh artistic impulses. Press, radio, film, vaudeville and cabaret laid the foundations for a new mass culture, which experienced an unexpected upswing, especially in the German capital Berlin, which Alfred Döblin set a lasting memorial to with his big-city novel "Berlin Alexanderplatz" (1929). This year's conference of the Department of Germanic -

Laudatio for Judith Kerr
Laudatio for Judith Kerr Dear Judith Kerr, Such a familiar address from a complete stranger may not be quite what you would expect on so formal an occasion, but then to me you do not feel like a complete stranger. Nor, I suspect, do many in our audience think of you as such. For we feel that we know you. Many of us will long ago have made your acquaintance: some by reading When Hitler Stole Pink Rabbit and the other volumes of your entrancing semi-autobiographical trilogy, and others, the younger ones, by reading your delightful children’s stories, or, those more advanced in years, by reading your stories to their children or grandchildren. So it is that you enjoy such an unusual degree of affection among this audience – and far beyond. This evening we are celebrating the award to you of honorary membership of the Gesellschaft für Exilforschung (Society for Exile Studies). It is as a writer who was herself a refugee and who turned her experience as a refugee into much loved works of literature that we are honouring you. It is appropriate that this celebration is taking place at the Wiener Library, founded by Jewish refugees from Nazi Germany as far back as 1933 and the oldest repository in the world for materials relating to the refugee experience, to National Socialism and the Holocaust. It is a pleasure to thank the Wiener Library and its long-serving Director, Ben Barkow, for hosting this ceremony. It is also a pleasure to thank the Association of Jewish Refugees for its generous support for this occasion. -
Pre-Nazi Era Jewish Life in Germany
Educational resources: Pre-Nazi Era Jewish Life in Germany Information for teachers: this worksheet draws upon original primary sources from The Wiener Holocaust Library’s archive to explore how the lives of some German Jews before the Nazi era. All sources are courtesy of The Wiener Holocaust Library and can be reproduced for educational purposes only. The Wiener Holocaust Library should be acknowledged in all reproductions. The Wiener Holocaust Library is the world’s oldest archive of material on the Nazi era and The Holocaust. The Holocaust Explained is Library’s educational website, designed for schools. https://www.wienerlibrary.co.uk/ https://www.theholocaustexplained.org/ The Wiener Holocaust Library works closely with the University College London Centre for Holocaust Education. For more resources, support and guidance on teaching the Holocaust visit their website: https://www.holocausteducation.org.uk/teacher-resources/ Possible age groups: 13-18 year olds: (England and Wales) KS3, 4, 5 Relevant curricula (England and Wales): KS3 History; GCSE History Edexcel: Weimar and Nazi Germany 1918-1939; GCSE History OCR: Germany 1925-1955: The People and The State. Edexcel A-Level History - Germany and West Germany, 1918–89; OCR History Democracy and Dictatorships in Germany 1919–1963; AQA History: Democracy and Nazism: Germany 1918-1945. Prior knowledge assumed: basic knowledge of the nature of Nazi beliefs, antisemitism and basic awareness of the main features of Nazi rule. Session aims: to use contemporary source material to: Examine the position of Jews in pre-Nazi era Germany Understand the contribution of Jews to life in pre-Nazi era Germany Analyse the strengths and limitations of this set of sources in telling us about Jews in pre-Nazi era Germany Suggested activities: students should analyse the sources on their own or in pair or groups and explain what the sources can tell us about life for Jews in Germany before the Nazi era. -

Mit Geschaffnem Grüßt Man Sachte, Was Nur Das Erleben Brachte“: Verfolgung, Flucht Und Exil Im Spiegel Der Autobiographischen Schriften Der Familie Alfred Kerrs
„Mit Geschaffnem grüßt man sachte, was nur das Erleben brachte“: Verfolgung, Flucht und Exil im Spiegel der autobiographischen Schriften der Familie Alfred Kerrs Dissertation zur Erlangung der Würde der Doktorin der Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien & Europäische Sprachen und Literaturen der Universität Hamburg vorgelegt von Nicola Otten aus Hamburg Hamburg, 2009 Hauptgutachter: Prof. Dr. Hans-Harald Müller Zweitgutachter: Prof. Dr. Jörg Schönert Datum der Disputation: 24. Oktober 2007 Angenommen von der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg am: 25. Juni 2007 Veröffentlicht mit Genehmigung der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg am: 14. August 2009 „MIT GESCHAFFNEM GRÜSST MAN SACHTE, WAS NUR DAS ERLEBEN BRACHTE“ Mein Dank für die Unterstützung bei der Erstellung meiner Doktorarbeit geht an meine unermüdlichen Korrektoren Horst Bruhn, Lothar Grüning und Shelina Islam sowie an meine Familie und Freunde, die mich in den Jahren immer wieder durch Gespräche bestärkt haben. Weiter danke ich der Akademie der Künste, Berlin, und dem Imperial War Museum, London, für den freien Zugang zu den Archivalien. Ein besonderer Dank geht an Judith und Michael Kerr für die Interviews, die ich mit ihnen führen durfte. „MIT GESCHAFFNEM GRÜSST MAN SACHTE, WAS NUR DAS ERLEBEN BRACHTE“ Für meine Eltern Welcher Wahn dem Erdengast Auch entdämmert und erblasst – Eines fühlt man in dem Treiben: Eltern … bleiben. Stiller Pol im Lebensbraus. Leuchten. Übers Grab hinaus. Minne fällt und Freundschaft fällt, Wenn die Seelen unsrer Welt Sich in Trug und Kampf zerreiben: Eltern … bleiben. Welcher Wahn dem Erdengast Auch entdämmert und erblasst: Eines starken Engels Hand Soll es überm Totenland In die ewigen Sterne schreiben: Eltern … bleiben. -

JOURNAL the Association of Jewish Refugees
VOLUME 19 NO.7 JULY 2019 JOURNAL The Association of Jewish Refugees Two sides of exile BIRTHDAY HONOURS When Judith Kerr died the tributes poured out. “Her stories and We were delighted to see seven AJR members named in The Queen’s Birthday illustrations are ageless and timeless, and endlessly uplifting,” wrote Honours list. You’ll find details of these members on the back page. The Daily Telegraph. As our Chief Executive Michael Newman said, “these richly deserved awards reflect their personal dedication and huge commitment to this critical subject”. Also in this issue is a very interesting article about the refugee children who were housed in the Lake District during the war, and the first in our new series Remembering & Reflecting on the Kindertransport. We hope you enjoy reading these and other articles as well as looking at the lovely photos from AJR’s recent trip to Nottinghamshire. News ............................................................ 3 Judith Kerr with OBE for services to children’s literature and Holocaust education in 2012 New faces .................................................... 4 Letter from Israel .......................................... 5 Letters to the Editor ...................................... 6 She was a national treasure. Not just scenes. This may seem a strange thing A song that resonates................................... 7 because her books were hugely popular. to say but in some ways Judith Kerr is an Art Notes...................................................... 8 Remembering: Wilfrid Israel ......................... 9 She wrote almost forty books and, recently, underrated writer. From Auschwitz to Ambleside ...............10-11 The Tiger Who Came to Tea sold its Reviews .................................................12-13 millionth copy. Not many children’s writers Kerr was born in Berlin in 1923. -

JOURNAL the Association of Jewish Refugees
VOLUME 19 NO.11 NOVEMBER 2019 JOURNAL The Association of Jewish Refugees German Passports LEAVE THE LIGHT ON This month marks the 81st and Jewish Refugees anniversary of Kristallnacht. Many shuls are leaving a light on overnight after Shabbat on 9 November to After the war, many refugees faced a difficult question: Did they want commemorate the tragedy and you may like to do the same at home. to return to their homeland? Of course, there were terrible memories November is also Jewish Legacy of loss and persecution. Who would want to go back to countries Awareness Month and AJR is proud where their families had been killed, their homes confiscated, their to be among the partners supporting #JLGMonth #whatisthepoint. values trampled upon? Meanwhile we invite all our Second Generation readers to complete our special survey - see page 3. Marseille to Martinique ................................ 4 AJR annual party .......................................... 5 Letters to the Editor ...................................6-7 Art Notes...................................................... 8 Letter from Israel .......................................... 9 The Arolsen Archives .............................10-11 Eli’s Story ...............................................12-13 Around the AJR .....................................14-15 Reviews .................................................16-17 Looking For ................................................ 18 Obituaries .................................................. 19 For most people, the issue as to whether to apply for a German passport goes a lot Events & exhibitions ................................... 20 deeper than simply the ease of cross-border travel. A surprising number of refugees did In my own family, my maternal Please note that the views expressed go back. The playwright Bertolt Brecht grandfather and great-uncle both throughout this publication are not moved to East Germany, where he returned to Germany after the war and necessarily the views of the AJR. -

The Major Literary Polemicso Karl Kraus
Durham E-Theses The major literary polemicso Karl Kraus Carr, Gilbert J. How to cite: Carr, Gilbert J. (1972) The major literary polemicso Karl Kraus, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/7938/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk ABSTRACT This study of the most important of Kraus1s polemics against literary contemporaries centres on the relation of language and character. Any attempt simply to extract his opinions or to measure his verdicts against accepted critical opinion has been eschewed, as a misinterpretation of Kraus's whole purpose. Since his polemics were two- pronged attacks - on style and character - his conceptions of language and personality are outlined, and also related to his demand that the polemicist should embody artistic values. As a background to his demand for unity of man and work, the construction of his persona and the dualism in his thought and its implications for his critical procedure are discussed.