3847007599 Lp.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Krebs, Tschacher, Speer Und Er
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Open Repository and Bibliography - Luxembourg THIS IS A POST-PRINT VERSION OF THE ARTICLE WHICH HAS NOW BEEN PUBLISHED CITATION: Krebs, S. & Tschacher, W. (2007). Speer und Er. Und Wir? Deutsche Geschichte in gebrochener Erinnerung. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 58, 3, 163–173. Stefan Krebs/Werner Tschacher Speer und Er. Und Wir? Deutsche Geschichte in gebrochener Erinnerung Am 6. Oktober 1943 fand im Goldenen Saal des Posener Schlosses eine vom Sekretär des Führers und Leiter der Parteikanzlei Martin Bormann einberufene Tagung der Reichs- und Gauleiter statt. Bei der Zusammenkunft wurden diese von Führungspersönlichkeiten aus Militär und Wirtschaft, darunter der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Karl Dönitz, der Generalinspekteur der Luftwaffe Erhard Milch und der Reichsminister für Bewaffnung und Munition Albert Speer sowie sein enger Mitarbeiter, der Stahlindustrielle Walter Rohland, über die ernste militärische und wirtschaftliche Lage des „Dritten Reiches“ im fünften Kriegsjahr unterrichtet. 1 Am späten Nachmittag hielt dann auch Reichsführer-SS Heinrich Himmler eine eineinhalbstündige Rede. In dieser setzte Himmler die Tagungsteilnehmer in brutaler Offenheit vom Völkermord an den europäischen Juden in Kenntnis. So führte er u.a. aus: „Der Satz »Die Juden müssen ausgerottet werden« mit seinen wenigen Worten, meine Herren, ist leicht ausgesprochen. Für den, der durchführen muß, was er fordert, ist es das Allerhärteste und Schwerste, was es gibt.“ Weiter teilte er mit: „Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es mit den Frauen und Kindern? – Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. -

German Films Quarterly 2 · 2004
German Films Quarterly 2 · 2004 AT CANNES In Competition DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI by Hans Weingartner FULFILLING EXPECTATIONS Interview with new FFA CEO Peter Dinges GERMAN FILM AWARD … and the nominees are … SPECIAL REPORT 50 Years Export-Union of German Cinema German Films and IN THE OFFICIAL PROGRAM OF THE In Competition In Competition (shorts) In Competition Out of Competition Die Fetten Der Tropical Salvador Jahre sind Schwimmer Malady Allende vorbei The Swimmer by Apichatpong by Patricio Guzman by Klaus Huettmann Weerasethakul The Edukators German co-producer: by Hans Weingartner Producer: German co-producer: CV Films/Berlin B & T Film/Berlin Thoke + Moebius Film/Berlin German producer: World Sales: y3/Berlin Celluloid Dreams/Paris World Sales: Celluloid Dreams/Paris Credits not contractual Co-Productions Cannes Film Festival Un Certain Regard Un Certain Regard Un Certain Regard Directors’ Fortnight Marseille Hotel Whisky Charlotte by Angela Schanelec by Jessica Hausner by Juan Pablo Rebella by Ulrike von Ribbeck & Pablo Stoll Producer: German co-producer: Producer: Schramm Film/Berlin Essential Film/Berlin German co-producer: Deutsche Film- & Fernseh- World Sales: Pandora Film/Cologne akademie (dffb)/Berlin The Coproduction Office/Paris World Sales: Bavaria Film International/ Geiselgasteig german films quarterly 2/2004 6 focus on 50 YEARS EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 22 interview with Peter Dinges FULFILLING EXPECTATIONS directors’ portraits 24 THE VISIONARY A portrait of Achim von Borries 25 RISKING GREAT EMOTIONS A portrait of Vanessa Jopp 28 producers’ portrait FILMMAKING SHOULD BE FUN A portrait of Avista Film 30 actor’s portrait BORN TO ACT A portrait of Moritz Bleibtreu 32 news in production 38 BERGKRISTALL ROCK CRYSTAL Joseph Vilsmaier 38 DAS BLUT DER TEMPLER THE BLOOD OF THE TEMPLARS Florian Baxmeyer 39 BRUDERMORD FRATRICIDE Yilmaz Arslan 40 DIE DALTONS VS. -

Magnus Brechtken, Albert Speer. Eine Deutsche Karriere
Demystifying Hitler’s Favorite Architect. Review of: Magnus Brechtken, Albert Speer. Eine deutsche Karriere Downloaded from: https://research.chalmers.se, 2021-09-27 13:34 UTC Citation for the original published paper (version of record): Seelow, A., Andersen, A., Van Gerrewey, C. et al (2018) Demystifying Hitler’s Favorite Architect. Review of: Magnus Brechtken, Albert Speer. Eine deutsche Karriere Architectural Histories, 6(1): 1-11 http://dx.doi.org/10.5334/ah.334 N.B. When citing this work, cite the original published paper. research.chalmers.se offers the possibility of retrieving research publications produced at Chalmers University of Technology. It covers all kind of research output: articles, dissertations, conference papers, reports etc. since 2004. research.chalmers.se is administrated and maintained by Chalmers Library (article starts on next page) Seelow, AM, et al. 2018. Book Reviews September 2018. Architectural Histories, 6(1): 12, pp. 1–12, DOI: https://doi. org/10.5334/ah.334 REVIEWS Book Reviews September 2018 Atli Magnus Seelow, Angela Andersen, Christophe Van Gerrewey and Carmen Popescu Seelow, AM. Review of: Magnus Brechtken, Albert Speer. Eine deutsche Karriere, Munich: Siedler Verlag, 2017. Andersen, A. Review of: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝA/September 55, Keller Gallery, Cambridge, MA, 2016; !f Istanbul Independent Film Festival, Istanbul, 2017. Van Gerrewey, C. Review of: Stedelijk Base, Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 2017. Popescu, C. Review of: Shrinking Cities in Romania, National Museum of Contemporary Art, Bucharest, 2016. Keywords: Albert Speer; National Socialism; Täterforschung; biography genre; virtual reality exhibition; immersive environment; Pogrom; Istanbul; Stedelijk Museum Amsterdam; Rem Koolhaas; exhibition design; OMA; shrinking cities; deindustrialization; Bucharest; Ceausescu Demystifying Hitler’s Favorite Architect The new, comprehensive, modestly illustrated bio- graphy Albert Speer. -

Der Charmante Verbrecher Albert Speer War Der Mächtigste Minister Und Zeitweise Engste Vertraute Adolf Hitlers
Titel Der charmante Verbrecher Albert Speer war der mächtigste Minister und zeitweise engste Vertraute Adolf Hitlers. Nach seiner Haftentlassung 1966 präsentierte er sich als der gute Nazi – und wurde zur Symbolfigur für Millionen Mitläufer. Nun haben Historiker die wahre Geschichte recherchiert. Von Klaus Wiegrefe JAD WASHEM JAD WALTER FRENTZ COLLECTION, BERLIN FRENTZ COLLECTION, WALTER Selektion von Juden in Auschwitz (1944): Einblicke in den Arkanbereich des Regimes ls britische Posten um Mitternacht er Gefängnis voll geschrieben und nach mächtigster Minister den Diktator als „Ver- des 1. Oktober 1966 die Tore des draußen schmuggeln lassen. Nach seiner brecher“ bezeichnete und sich ohne das Aalliierten Gefängnisses in Berlin- Freilassung schrieb er mit Hilfe der Notizen verbreitete Selbstmitleid zur „Verantwor- Spandau öffneten, wurde Albert Speer von Bücher, die zu Millionenbestsellern wur- tung“ am Holocaust bekannte. gleißendem Scheinwerferlicht geblendet. den. Die „Erinnerungen“ von 1969 und die Aber Speer bediente auch – und vor al- Über hundert Journalisten und Tausende „Spandauer Tagebücher“ von 1975 zählen lem – die Apologeten des Nationalsozialis- Schaulustige begrüßten Hitlers einstigen bis heute zu den meistverkauften Werken mus. Denn allen Schuldbekenntnissen zum Stararchitekten und späteren Rüstungs- der deutschen Sprache. Fast ununterbro- Trotz wollte der ehemalige Intimus des minister wie einen Popstar. Nur mühsam chen klingelte bei Speers in Heidelberg das Führers („Wenn Hitler überhaupt Freunde bahnte sich die schwarze Mercedes- Telefon: Reporter, Historiker oder Inter- gehabt hätte, wäre ich bestimmt einer sei- Limousine mit Speer, seiner Frau und essierte, die über die Vergangenheit spre- ner engen Freunde gewesen“) an seiner seinem Anwalt den Weg durch die Menge, chen wollten, riefen an oder schickten persönlichen Integrität keine Zweifel zu- in der Volksfeststimmung herrschte. -

A Critical Comment on Richard Steigmann-Gall's the Holy Reich
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DepositOnce Journal of Contemporary History Copyright © 2007 SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol 42(1), 35–46. ISSN 0022–0094. DOI: 10.1177/0022009407071630 Manfred Gailus A Strange Obsession with Nazi Christianity: A Critical Comment on Richard Steigmann-Gall’s The Holy Reich Richard Steigmann-Gall’s study of ‘Nazi conceptions of Christianity’ is, with- out question, both an interesting and provocative contribution to recent debates on religious conditions and nazi ideology in the Third Reich and, by extension, to the current controversies concerning secularization processes and the history of twentieth-century religion in general.1 These debates have been ongoing for the last 15 years, usually under the rubric ‘political religion’ and in the context of more recent attempts at revising the older sociological secular- ization paradigms. Regrettably, however, Steigmann-Gall makes far too little reference in his revised dissertation, published in 1999, to this broad and sometimes international debate. In this respect, let it be said at the outset, his contribution is not as novel, original or revolutionary as he, and some of his book-jacket reviewers — not least the three prime eulogists Richard Evans, Michael Burleigh and Helmut Walser Smith — would have us believe.2 1 Richard Steigmann-Gall, The Holy Reich. Nazi Conceptions of Christianity, 1919–1945 (Cambridge 2003). The book is based on the author’s revised dissertation, ‘“The Holy Reich”. Religious Dimensions of Nazi Ideology, 1919–1945’, University of Toronto 1999. 2 See Jay Baird, To Die for Germany. -

Nazityskland I Populärkulturen
Nazityskland i populärkulturen Minne, myt, medier 1 2 Nazityskland i populärkulturen Minne, myt, medier Eva Kingsepp Stockholms universitet 3 Till mina föräldrar © Eva Kingsepp 2008 Omslagsbild: Björn A. Ekblom ISSN: 1102-3015 ISBN: 978-91-7155-701-8 Tryck: Printcenter, Stockholm 2008 Distributör: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet 4 Innehåll Förord ....................................................................................................................................... 9 1. Inledning ............................................................................................................................. 11 1.1. Mediemarknaden kring Tredje riket: en överblick ............................................................ 12 1.2 En första blick på materialet .............................................................................................. 14 1.3 Begreppsförtydliganden ..................................................................................................... 14 1.4 Syfte, hypoteser och frågeställningar ................................................................................. 15 1.5 Kritik och avgränsningar .................................................................................................... 17 1.6 Disposition ......................................................................................................................... 19 2. Forskningsöversikt ............................................................................................................ -

German Historical Institute London Bulletin Vol 29 (2007), No. 1
German Historical Institute London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007 CONTENTS Seminars 3 Articles Hitler’s Games: Race Relations in the 1936 Olympics (David Clay Large) 5 The Long Shadows of the Second World War: The Impact of Experiences and Memories of War on West German Society (Axel Schildt) 28 Review Articles Prussian Junkers (William W. Hagen) 50 Flirting with Hitler: Biographies of the German and British Nobility in the Interwar Years (Karina Urbach) 64 Book Reviews Dieter Berg, Die Anjou-Plantagenets: Die englischen Könige im Europa des Mittelalters (1100–1400) (Karsten Plöger) 75 Lyndal Roper, Witch Craze: Terror and Fantasy in Baroque Germany (Johannes Dillinger) 79 Helke Rausch, Kultfigur und Nation: Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London 1848–1914 (Matthew Jefferies) 85 Sonja Levsen, Elite, Männlichkeit und Krieg: Tübinger und Cambridger Studenten 1900–1929 (Thomas Weber) 89 Zara Steiner, The Lights that Failed: European International History 1919–1933 (Eckart Conze) 97 (cont.) Contents Michael Kater, Hitler Youth (Sybille Steinbacher) 101 James J. Barnes and Patience P. Barnes, Nazis in Pre-War London, 1930–1939: The Fate and Role of German Party Members and British Sympathizers (Lothar Kettenacker) 107 Dieter Kuntz and Susan Bachrach (eds.), Deadly Medicine: Creating the Master Race (Winfried Süß) 112 Kazimierz Sakowicz, Ponary Diary, 1941–1943: A Bystander’s Account of a Mass Murder; Rachel Margolis and Jim G. Tobias (eds.), Die geheimen Notizen des K. Sakowicz: Doku- mente zur Judenvernichtung in Ponary (Helmut Walser Smith) 115 Bastian Hein, Die Westdeutschen und die Dritte Welt: Entwick- lungspolitik und Entwicklungsdienste zwischen Reform und Revolte 1959–1974 (Armin Grünbacher) 119 Conference Reports Chivalric Heroism or Brutal Cruelty—How Violent were the Middle Ages? (Hanna Vollrath) 122 The Holy Roman Empire, 1495–1806 (Michael Schaich) 125 Fifth Workshop on Early Modern German History (Michael Schaich) 135 Royal Kinship: Anglo-German Family Networks 1760–1914 (Matthew S. -
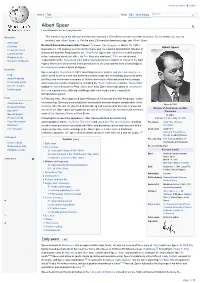
Albert Speer from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Search Albert Speer From Wikipedia, the free encyclopedia Navigation This article is about the German architect who became a Third Reich minister and later an author. For his eldest son, also an architect, see Albert Speer, Jr. For the early 20thcentury American judge, see Albert Spear. Main page Berthold Konrad Hermann Albert Speer[1] (German: [ˈʃpeːɐ̯] ( listen); March 19, 1905 – Contents Albert Speer Featured content September 1, 1981) was a German architect who was, for a part of World War II, Minister of Current events Armaments and War Production for the Third Reich. Speer was Adolf Hitler's chief architect [a] Random article before assuming ministerial office. As "the Nazi who said sorry", he accepted moral Donate to Wikipedia responsibility at the Nuremberg trials and in his memoirs for complicity in crimes of the Nazi regime. His level of involvement in the persecution of the Jews and his level of knowledge of the Holocaust remain matters of dispute. Interaction Speer joined the Nazi Party in 1931, launching him on a political and governmental career Help which lasted fourteen years. His architectural skills made him increasingly prominent within About Wikipedia the Party and he became a member of Hitler's inner circle. Hitler instructed him to design Community portal and construct a number of structures, including the Reich Chancellery and the Zeppelinfeld Recent changes stadium in Nuremberg where Party rallies were held. Speer also made plans to reconstruct Contact page Berlin on a grand scale, with huge buildings, wide boulevards, and a reorganized transportation system. -

UNIVERSITY of CALGARY Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour In
UNIVERSITY OF CALGARY Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour in Contemporary German Culture by Annika Orich A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE INTERDISCIPLINARY DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES and DEPARTMENT OF ENGLISH CALGARY, ALBERTA DECEMBER, 2008 © Annika Orich 2008 ISBN: 978-0-494-51133-6 UNIVERSITY OF CALGARY FACULTY OF GRADUATE STUDIES The undersigned certify that they have read, and recommend to the Faculty of Graduate Studies for acceptance, a thesis entitled “Mocking Hitler: Nazi Speech & Humour in Contemporary German Culture” submitted by Annika Orich in partial fulfilment of the requirements of the interdisciplinary degree of Master of Arts. 6XSHUYLVRUDr. Florentine Strzelczyk, GSEA &R6XSHUYLVRU, Dr. Adrienne Kertzer, English Dr. Michael Taylor, GSEA Dr. Lorraine Markotic, Faculty of Humanities 'DWH ii $EVWUDFW Mocking Hitler is by now an integral part of Germany’s contemporary culture of remembrance. Germans ridicule their former leader and his fellow myrmidons in jokes, films, comics, plays, cabaret, and anti-neo-Nazi satire. Yet, instead of making fun of the historic individual, Germans generally deride Hitler’s (self-)portrayal as the )KUHU and his mythological afterlife as the incarnation of absolute evil – a perception that is embodied by representations of Hitler the orator and Nazi speeches in general. On the basis of different examples of humour about Nazi speechmaking, this thesis identifies the reasons and functions that ridicule plays in Germans’ coming to terms with the Nazi past as well as its problematic and beneficial implications. While humour, on the one hand, demythologizes and exposes Hitler, it serves Germans, on the other hand, as a medium to normalize the memory of Hitler and to distance themselves from their perpetrator past. -

Docudramatizing History on TV Ebbrecht, Tobias
www.ssoar.info Docudramatizing history on TV Ebbrecht, Tobias Postprint / Postprint Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: www.peerproject.eu Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Ebbrecht, T. (2007). Docudramatizing history on TV. European Journal of Cultural Studies, 10(1), 35-53. https:// doi.org/10.1177/1367549407072969 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter dem "PEER Licence Agreement zur This document is made available under the "PEER Licence Verfügung" gestellt. Nähere Auskünfte zum PEER-Projekt finden Agreement ". For more Information regarding the PEER-project Sie hier: http://www.peerproject.eu Gewährt wird ein nicht see: http://www.peerproject.eu This document is solely intended exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes for your personal, non-commercial use.All of the copies of Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument this documents must retain all copyright information and other ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen information regarding legal protection. You are not allowed to alter Gebrauch bestimmt. Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments this document in any way, to copy it for public or commercial müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses or otherwise use the document in public. Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen By using this particular document, you accept the above-stated Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke conditions of use. vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-227092 EUROPEAN JOURNAL OF £ Copyright© 2007 SAGE Publications Lond on, Los Angeles. -

Autobiographie Als Apologie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783847107590 – ISBN E-Lib: 9783737007597 1 Formen der Erinnerung 2 3 4 5 6 Band 65 7 8 9 10 11 Herausgegeben von 12 Jürgen Reulecke und Birgit Neumann 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783847107590 – ISBN E-Lib: 9783737007597 1 Roman B. Kremer 2 3 4 5 6 7 8 Autobiographie als Apologie 9 10 Rhetorik der Rechtfertigung bei Baldur von 11 12 Schirach, Albert Speer, Karl Dönitz und Erich 13 Raeder 14 15 16 17 18 Mit 3 Abbildungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 V&R unipress 41 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783847107590 – ISBN E-Lib: 9783737007597 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 26 Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 27 https://dnb.de abrufbar. -

Helsinška Povelja
helsinška povelja helsinška povelja, septembar – oktobar 2008 1 sadržaj broj 123–124, septembar-oktobar 2008, godina XIII uvodnik o srpsko-hrvatskim odnosima Sonja Biserko Drago Kovačević “Srpstvo” i poslednja odbrana . 3 Soljenje presoljenog. 30 u senci svetske fi nansijske krize govor mržnje Nikola Samardžić Slobodanka Ast Na izmaku slobode. 4 Veštice i patrioti . 34 Vladimir Gligorov Kapitalizam i odgovornost . 6 jezik i nacionalizam Miša Brkić Mr Srđan Jovanović “Kapitalizam bez bankrotstva je kao religija bez pakla”. 9 Ima li nauke u srbistici . 36 srbija i regionalna (ne)stabilnost povodom 60-godišnjice rezolucije kominforma Teofi l Pančić Sead Hadžović Evrotaljiganje i evrokašljucanje . 12 Staljinizam i antistaljinizam poslije Staljina (2) . 38 Ivan Torov Gnev i računice Miloševićeve Srbije . 13 pouke “nirnberškog procesa” Bojan al Pinto-Brkić Mile Lasić Tragom pogrešnih procena. 15 Od sudskih procesa ka kritičkoj kulturi sećanja . 40 Miroslav Filipović Još jedna prazna priča. 16 povelja na licu mesta Vojislava Vignjević Gordana Perunović Fijat Neprihvatanje realnosti. 18 Kikinda: Prepakivanje i pakovanje . 46 Bashkim Hisari Šta propuštaju Srbi na Kosovu. 19 umesto eseja Nenad Daković novi statut ap vojvodine Ontološka opklada. 48 Dimitrije Boarov Mnogo buke oko čega . 20 sport i propaganda Ivan Mrđen vojska srbije Andora, negde u Srbiji . 50 Stipe Sikavica (Ne)očekivani marš-manevar u “svetlu prošlost” . 22 godišnjice Petra Gonda Olga Zirojević “Istina” za sva vremena . 22 Vestfalski mir (1648). 51 rascep srpske radikalne stranke bugarska manjina u srbiji (2) Branko Pavlica Nastasja Radović Položaj u drugoj Jugoslaviji . 52 Podeli, pa umnoži. 24 pouke “nirnberškog procesa” geostrateška orijentacija srbije Mile Lasić Nenad Ilić Od sudskih procesa ka kritičkoj kulturi sećanja .