Intellektuelle Im Banne Des Ns.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Berger ENG Einseitig Künstlerisch
„One-sidedly Artistic“ Georg Kolbe in the Nazi Era By Ursel Berger 0 One of the most discussed topics concerning Georg Kolbe involves his work and his stance during the Nazi era. These questions have also been at the core of all my research on Kolbe and I have frequently dealt with them in a variety of publications 1 and lectures. Kolbe’s early work and his artistic output from the nineteen twenties are admired and respected. Today, however, a widely held position asserts that his later works lack their innovative power. This view, which I also ascribe to, was not held by most of Kolbe’s contemporaries. In order to comprehend the position of this sculptor as well as his overall historical legacy, it is necessary, indeed crucial, to examine his œuvre from the Nazi era. It is an issue that also extends over and beyond the scope of a single artistic existence and poses the overriding question concerning the role of the artist in a dictatorship. Georg Kolbe was born in 1877 and died in 1947. He lived through 70 years of German history, a time characterized by the gravest of political developments, catastrophes and turning points. He grew up in the German Empire, celebrating his first artistic successes around 1910. While still quite young, he was active (with an artistic mission) in World War I. He enjoyed his greatest successes in the Weimar Republic, especially in the latter half of the nineteen twenties—between hyperinflation and the Great Depression. He was 56 years old when the Nazis came to power in 1933 and 68 years old when World War II ended in 1945. -

2014 Latent Tradition in Modern Dancing
IV LISBON SUMMER SCHOOL FOR THE STUDY OF CULTURE Latencies: Europe 1914 - 2014 Latent tradition in modern dancing: The body politics of “The Green Table” (Cristina Graça) Abstract In the turmoil of the Weimar Republic German choreographer Kurt Jooss created The Green Table (1932), a farsighted ballet that critically looked back at the atrocities and suffering inflicted by of World War I and anticipated the events of World War II. Although Jooss´s piece drew directly from the ongoing political climate, the narrative was placed in an untraceable location and time, thus rendering it a timeless, universal protest against war that made The Green Table artistically and aesthetically resilient. In this paper we will analyze how Jooss expressed political opinions and conveyed social commentary, claiming his share of the sensible in Rincière´s words, through both experimental and traditional movement (modern dance and ballet), and how dance as a non-verbal art form used its instrument, the human body, to convey images of tradition, repression and cultural symbolisms of race and gender. Key words: gendered body; tradition; political commentary; representational power. 1 Quite often dance tends to be thought of as apolitical. Yet it goes with no contention that dancing bodies and the movement they perform are in their own way political, enabling the artist to intervene in the public sphere. Even when it apparently becomes abstract and self-referential, as in some Balanchine ballets, or in Merce Cunningham´s choreographies, dance still conveys political -

Heteropolitics of Contemporary Dance
Gabriele Brandstetter Heteropolitics of Contemporary Dance Xavier Le Roy’s Le Sacre du printemps Kunstwerke jedoch haben ihre Größe einzig darin, dass sie sprechen lassen, was die Ideologie verbirgt.1 Theodor W. Adorno How are we to think about the relationship between dance and poli- tics? Might it mean not only understanding dance politically, but also considering the politics of dance? The history and the discourse of dance is a history of the intricate negotiations between body, move- ment and politics: what André Lepecki calls the “choreo-political.”2 And the discourses and interpretations of Dance Studies reflect and address these questions with shifting degrees of emphasis. Yes, the political has for some time now been a search formula for an under- standing of dance, and one that has managed to direct public attention to many of its different forms. What can be said to be political is the relationship between aesthetics and power, the coincidence of political and aesthetic representation, for example in the dances at the court of Louis XIV – as Mark Franko’s reading of The King’s Two Bodies referring to Kantorowicz, has shown.3 Also political are the dances and movements portrayed by those choreographers whose pieces deal with questions of power, hierar- chies, law and justice, inclusions and exclusions. A random sampling might include: Kurt Jooss’s The Green Table, Jean Weidt’s work- ers’ choirs, Valeska Gert’s socially critical dance sketches, Martha 1 Theodor W. Adorno, “Rede über Lyrik und Gesellschaft”, Noten zur Literatur, Gesammelte Schriften Vol. 11 (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974), pp. -

Dance and Political Conflict: Three Comparative Case Studies
Middlesex University Research Repository An open access repository of Middlesex University research http://eprints.mdx.ac.uk Kolb, Alexandra (2006) Dance and political conflict: three comparative case studies. The International Journal of the Arts in Society, 1 (2) . pp. 17-21. ISSN 1833-1866 [Article] UNSPECIFIED This version is available at: https://eprints.mdx.ac.uk/8645/ Copyright: Middlesex University Research Repository makes the University’s research available electronically. Copyright and moral rights to this work are retained by the author and/or other copyright owners unless otherwise stated. The work is supplied on the understanding that any use for commercial gain is strictly forbidden. A copy may be downloaded for personal, non-commercial, research or study without prior permission and without charge. Works, including theses and research projects, may not be reproduced in any format or medium, or extensive quotations taken from them, or their content changed in any way, without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). They may not be sold or exploited commercially in any format or medium without the prior written permission of the copyright holder(s). Full bibliographic details must be given when referring to, or quoting from full items including the author’s name, the title of the work, publication details where relevant (place, publisher, date), pag- ination, and for theses or dissertations the awarding institution, the degree type awarded, and the date of the award. If you believe that any material held in the repository infringes copyright law, please contact the Repository Team at Middlesex University via the following email address: [email protected] The item will be removed from the repository while any claim is being investigated. -

Körper in Kunst Und Massenmedien 1918 Bis 1933
Leibhaftige Moderne Michael Cowan, Kai Marcel Sicks (Hg.) Leibhaftige Moderne Körper in Kunst und Massenmedien 1918 bis 1933 Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Wien Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. © 2005 transcript Verlag, Bielefeld This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Lektorat & Satz: Michael Cowan, Kai Marcel Sicks Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 3-89942-288-0 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zell- stoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected] Inhalt Vorwort: Protokoll einer Rettung 9 HANS ULRICH GUMBRECHT Technik, Krieg und Medien. Zur Imagination von Idealkörpern in den zwanziger Jahren 13 MICHAEL COWAN/KAI MARCEL SICKS Leistungskörper. Der professionelle Wettkampfsport „Der Querschnitt“ oder: Die Kunst des Sporttreibens 33 KAI MARCEL SICKS The Athlete as Machine: A Figur of Modernity in Weimar Germany 48 MICHAEL MACKENZIE Imagining the Nation through the Energetic Body. The “Royal Jump” 63 MICHAEL COWAN „Siegesplätze über die Natur“. Musils Kritik am Geist des modernen Wettkampfsports 81 ANNE FLEIG -

Tese Maria Joao Castro.Pdf
A Dança e o Poder ou o Poder da Dança: Diálogos e Confrontos no século XX Maria João Castro Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea Dezembro, 2013 1 Ao meu Pai, mecenas incondicional da minha vontade de conhecimento. Ao Pedro, pela cumplicidade do caminho deixando-me respirar... 2 AGRADECIMENTOS Inúmeras pessoas contribuíram de forma decisiva para que esta investigação chegasse a bom termo. O grupo inclui professores, colegas, amigos e desconhecidos que se cruzaram ao longo do projecto e que se dispuseram a ajudar na clareza e compreensão das informações. A primeira expressão de agradecimento cabe à Professora Doutora Margarida Acciaiuoli, por ter aceitado orientar esta tese com todo o rigor, determinação e empenho que a caracterizam, bem como pelo contributo que as suas críticas, sempre pertinentes e cordiais, provocaram na elaboração deste trabalho. A José Sasportes, pela forma como se disponibilizou para co-orientar esta investigação, pela vastíssima informação que me confiou, pelo estímulo e confiança, pela ampliação do campo de referências e pela cumplicidade na partilha da paixão pela dança, o que constituiu um inestimável e insubstituível auxílio. A todos os meus professores de dança com os quais aprendi de variadas maneiras como a dança nos modifica, nomeadamente a Liliane Viegas, João Hydalgo e Myriam Szabo, bem como aos meus colegas a amigos que, de variadíssimas formas, contribuíram para o desenvolvimento deste projecto, nomeadamente a Luísa Cardoso, António Laginha e Miguel Leal. À Vera de Vilhena, pela cuidada revisão do texto e por, com as suas sugestões, me ter ajudado a crescer na escrita. À Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela bolsa que me atribuiu, permitindo-me a dedicação exclusiva e a liberdade de poder estar continuamente dedicada a este trabalho. -

Quarterly 2 · 2008
German Films Quarterly 2 · 2008 AT CANNES Un Certain Regard WOLKE 9 by Andreas Dresen Cinéfondation GESTERN IN EDEN by Jan Speckenbach Critics’ Week DAS FREMDE IN MIR by Emily Atef PORTRAITS 90 Years of ARRI, Directors Pepe Danquart & Sylke Enders, Producer 23|5 Film, and Actor Andreas Schmidt GERMAN FILMS AND IN THE OFFICIAL PROGRAM OF In Competition In Competition In Competition PALERMO SHOOTING DELTA WALTZ WITH BASHIR by Wim Wenders by Kornél Mundruczó by Ari Folman Producer: Neue Road Movies/Berlin German Co-Producer: German Co-Producer: Razor Film/Berlin World Sales: HanWay Films/London Essential Filmproduktion/Berlin World Sales: The Match Factory/Cologne World Sales: Coproduction Office/Paris Un Certain Regard Cinéfondation Atelier TULPAN GESTERN IN EDEN WOMB by Sergey Dvortsevoy THE OTHER DAY IN EDEN by Benedek Fliegauf by Jan Speckenbach German Co-Producer: Pandora Film/Cologne German Producer: Razor Film/Berlin World Sales: The Match Factory/Cologne Producer/World Sales: Deutsche Film- & Fernsehakademie (dffb)/Berlin Directors’ Fortnight Critics’ Week Critics’ Week SALAMANDRA DAS FREMDE IN MIR DER KLOANE by Pablo Aguero THE STRANGER IN ME by Emily Atef THE RUNT by Andreas Hykade German Co-Producer: Rohfilm/Leipzig & Berlin Producer: NiKo Film/Berlin Producer/World Sales: World Sales: Bavaria Film Studio Film Bilder/Stuttgart International/Geiselgasteig CO-PRODUCTIONS THE CANNES FILM FESTIVAL 2008 In Competition Un Certain Regard Un Certain Regard LE SILENCE DE LORNA WOLKE 9 O’ HORTEN by Jean-Pierre & Luc Dardenne CLOUD 9 by Andreas Dresen by Bent Hamer German Co-Producers: Mogador Film/ Producer: Rommel Film/Berlin German Co-Producer: Pandora Film/Cologne Frankfurt-Berlin & Gemini Film/Cologne World Sales: The Match Factory/Cologne World Sales: The Match Factory/Cologne World Sales: Celluloid Dreams/Paris All photos courtesy of not contractual. -

Fonds Françoise Et Dominique Dupuy Bnf Archives Et Manuscrits 24/08
BnF Archives et manuscrits Fonds Françoise et Dominique Dupuy Cote : COL-191 Fonds Françoise et Dominique Dupuy 1950-1979 10 mètres linéaires Bibliothèque nationale de France. Département des arts du spectacle Fonds produit par : Dupuy, Françoise (1925-....) Dupuy, Dominique (1930-....) Le fonds contient des documents majoritairement en français Biographie ou histoire Françoise et Dominique Dupuy sont tous deux danseurs, chorégraphes et pédagogues. Pionniers et témoins de la naissance de la danse moderne en France dans les années 1950 et les décennies suivantes, ils ont signé, chacun ou ensemble, en tout une cinquantaine de ballets. Dominique Dupuy est né à Paris en 1930. Il grandit dans un milieu très ouvert aux arts. Dans les années d’avant-guerre, son père Roger-Louis Dupuy, recueille juifs et communistes allemands qui fuient le nazisme. Il vient en aide notamment au danseur Jean Weidt, réfugié d’Allemagne, créateur des Ballets 38, une des rares troupes professionnelles de danse moderne en France avant-guerre. Jean Weidt devient le professeur de danse de Dominique Dupuy et de ses frères. Dominique Dupuy commence ainsi la danse à huit ans. Puis fait du théâtre chez Charles Dullin où il rencontre Marcel Marceau, et de la danse classique avec, entre autres, Olga Préobrajenska, Madame Illic, et Nicolas Zvereff... Françoise Dupuy est née à Lyon en 1925. Elle grandit également dans un milieu artistique. Son père, Marcel Michaud, est directeur d’une galerie de peinture, critique d’art et spécialiste d’art contemporain. Françoise commence la danse à cinq ans à l’Opéra de Lyon, puis suit des cours de rythmique Dalcroze chez Madame Birmelet et travaille ensuite de nombreuses années chez Hélène Carlut. -

The Cambridge Companion to Ballet Edited by Marion Kant Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-0-521-83221-2 - The Cambridge Companion to Ballet Edited by Marion Kant Frontmatter More information The Cambridge Companion to Ballet Ballet is a paradox: much loved but little studied. It is a beautiful fairy tale; detached from its origins and unrelated to the men and women who created it. Yet ballet has a history, little known and rarely presented. These great works have dark sides and moral ambiguities, not always nor immediately visible. The daring and challenging quality of ballet as well as its perceived ‘safe’ nature is not only one of its fascinations but one of the intriguing questions to be explored in this Companion. The essays reveal the conception, intent and underlying meaning of ballets and re-create the historical reality in which they emerged. The reader will find new and unexpected aspects of ballet, its history and its aesthetics, the evolution of plot and narrative, new insights into the reality of training, the choice of costume and the transformation of an old art in a modern world. © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-83221-2 - The Cambridge Companion to Ballet Edited by Marion Kant Frontmatter More information © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-83221-2 - The Cambridge Companion to Ballet Edited by Marion Kant Frontmatter More information The Cambridge Companion to BALLET ............ edited by Marion Kant © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-83221-2 - The Cambridge Companion to Ballet Edited by Marion Kant Frontmatter More information University Printing House, Cambridge cb2 8bs, United Kingdom Cambridge University Press is part of the University of Cambridge. -

Tatjana Gsovsky Und Das ‚Dramatische Ballett' Der 'Berliner
Tatjana Gsovsky und das ‚Dramatische Ballett’ Der ’Berliner Stil’ zwischen Der Idiot und Tristan Dissertation vorgelegt beim Promotionsausschuß Dr. phil der Universität Bremen von Michael Heuermann Münster 2001 Inhaltsverzeichnis Einleitung............................................................................................................. I Quellenlage und Quellenkritik.......................................................................... XII A. GRUNDLAGEN DER STILENTWICKLUNG ............................................... 1 A.I. Tatjana Gsovsky und ihr Tanzverständnis .................................... 1 A.I.1. Tatjana Gsovsky und das klassische Ballett ................................. 1 A.I.2. Klassisches Ballett als ekstatisches Erlebnis................................ 2 A.I.3. Tanz und Form............................................................................... 4 A.I.4. Person und Persönlichkeit ............................................................. 5 A.I.5. Das ‘moderne Ballett’..................................................................... 8 A.I.6. Das ‘moderne Ballett’ als Ausdruck der Zeit ............................... 12 A.I.7. Klassischer Tanz und Tradition ................................................... 13 A.I.8. Das Neue im Klassischen Ballett Tatjana Gsovskys .................. 15 A.II. Tatjana Gsovsky in Rußland........................................................ 20 A.II.1. Tatjana Gsovskys Kindheit .......................................................... 20 A.II.2. Der ‚freie -

Expressions of Form and Gesture in Ausdruckstanz
EXPRESSIONS OF FORM AND GESTURE IN AUSDRUCKSTANZ, TANZTHEATER, AND CONTEMPORARY DANCE by TONJA VAN HELDEN B.A., University of New Hampshire, 1998 M.A., University of Colorado, 2003 A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Program of Comparative Literature 2012 This thesis entitled: Expressions Of Form And Gesture In Ausdruckstanz, Tanztheater, And Contemporary Dance written by Tonja van Helden has been approved for the Comparative Literature Graduate Program __________________________________________ Professor David Ferris, Committee Chair ____________________________________________ Assistant Professor Ruth Mas, Committee member ____________________________________________ Professor Jennifer Peterson, Committee member ____________________________________________ Professor Henry Pickford, Committee member ____________________________________________ Professor Davide Stimilli, Committee member Date ________________ The final copy of this thesis has been examined by the signatories, and we Find that both the content and the form meet acceptable presentation standards Of scholarly work in the above mentioned discipline. van Helden, Tonja (Ph. D., Comparative Literature, Comparative Literature Graduate Program) Expressions Of Form And Gesture In Ausdruckstanz, Tanztheater, And Contemporary Dance Thesis directed by Professor David Ferris My dissertation examines the historical trajectory of Ausdruckstanz (1908-1936) from its break with Renaissance court ballet up through its transmission into Tanztheater and contemporary styles of postmodern dance. The purpose of this study is to examine the different modes of expression as indicated by the character, form, style, and concept of Ausdruckstanz, Tanztheater and contemporary dance. Through a close analysis of select case studies, each chapter provides a critical analysis of the stylistic innovations and conceptual problems evidenced by the choreographies from each movement. -
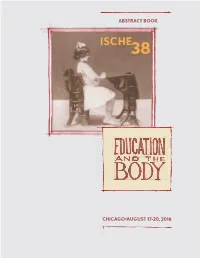
Chicago•August 17-20, 2016 Abstract Book
ABSTRACT BOOK ISCHE38 Front Cover: Figure 100. Furniture of the correct height. Back Cover: Figure 99. A grammar school boy in a primary seat. Source: Jesse H Bancroft, The Posture of School Children: with its home hygiene and new efficiency methods for school training (New York: The Macmillan Company, 1919) CHICAGO•AUGUST 17-20, 2016 ISCHE International Standing Conference for the History of Education ISCHE 38 Chicago, Illinois 1 August 2016 We are pleased to share with you the ISCHE 38 abstract as an online-only publication (ISSN 2313-1845 ONLINE). Included here are abstracts of all the papers presented at ISCHE 38, sorted alphabetically by the last name of the first author. For consistency of presentation and economy of space the abstracts printed here do not include bibliographies, footnotes and keywords. When we chose “Education and the Body” as the theme of ISCHE 38 we wanted participants to pose questions about the material and discursive positioning of human bodies in education, educational practices of embodiment, metaphorical uses of the concepts of “body” and “bodies” in relation to education. As conference organizers, we wanted to encourage our colleagues to consider how a focus on the body offers us new perspectives into the development of educational patterns and institutions. We wanted to challenge our fellow historians to explore how difference has historically been created between different bodies, as well as how different bodies have moved and have been shaped to move in the history of education. And, we could not be happier or more excited about the innovative and rigorous ways that ISCHE members responded to this charge! This conference could not have taken place without the extraordinary work of dozens of volunteers.