Die Reptilien Der Wiener Donauinsel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Danube Bike & River Cruise
VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Danube Bike & River Cruise: Prague to Budapest Bike Vacation + Air Package A Danube cycling and river cruise doesn’t get any better than this! In just a week, you’ll explore four different countries— Germany, Austria, Slovakia, and Hungary—as well as a world-class cultural capital, Vienna. Cycle the renowned Danube Bike Path, admiring vistas of storybook villages and castles, lush vineyards, and carpeted hills unfurling along the river banks. Pause to explore medieval cities and the spectacular Melk Abbey, and enjoy a private wine tasting. And at the end of the day, return to a deluxe Emerald Waterways river ship, where attentive service, fine dining, and a welcoming ambiance invite you to relax after an invigorating day. There’s no better or more convenient way to experience the heart of Europe! Cultural Highlights Unpack once, then bike and boat along the Danube in four countries and three cultural 1 / 11 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com capitals—all on one trip Follow the car-free and scenic Danube and EuroVelo 6 bike paths in this bicycle-friendly region Enjoy an exclusive Viennese concert with the music of Strauss and Mozart Choose to be as active or relaxed as you wish from our menu of cycling routes and walking tours What to Expect On Shore: This tour offers easy riverside terrain, with a few climbs to reach riverside towns. Riding is primarily on bike paths of both pavement and packed gravel, with some road riding through both urban and rural areas. -

Perspektive Donau: Bildung, Kultur Und Zivilgesellschaft"
Projektliste "Perspektive Donau: Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft" Nr. Projekttitel / Vorhaben Antragsteller Kurzbeschreibung Länder Zeitraum Durchführung Das Diakonische Werk Baden hat 2012 das „Netzwerk Sozialarbeit Rumänien“ gestartet (Vorgängerprojekt). Ziel des Netzwerks ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, durch 1 Netzwerk Sozialarbeit Rumänien Diakonisches Werk Baden Qualifizierung von Menschen in allen Arbeitsfeldern und Rumänien April 2013 - April 2015 Weiterqualifizierung von Sozialarbeitern. Es wird nun die Finanzierung von zwei weiteren Projektjahren (Projektetappe 2 und 3) beantragt. Beim Projektvorhaben handelt es sich um eine Fortführung des bereits in 2012 durchgeführten Maßnahmen zum Aufbau des Europäische Donau- Studiengangs. In 2013 soll eine Qualitätssicherung des 2 Master of Danube Studies Jan- Mai 2014, bis 2015 verlängert Akademie gGmbH Studiengangs über ein europäisches Akkreditierungsverfahren erfolgen. Es sind Arbeitstreffen in Wien, Brüssel, Budapest, Novi Sad und Ruse vorgesehen. Ziel des Projekts ist es die Reduzierung von Ausbildungs- und Schulabbrüchen in den Ländern Rumänien, Österreich, Ungarn und ggf. Bulgarien. Durch den Transfer und die Implementierung ASI- Akademie für von innovativen Qualifizierungskonzepten für Weiterbildung von Rumänien, Österreich, Innovationstransfer im Rahmen 01.10.2013-30.10.2014 3 sozialwissenschaftl. Fachkräften und zur Verbesserung des Ausbildungssystems vor Ungarn und ggf. der Donauraumstrategie Innovationen e.V. Ort sollen junge Menschen ohne Schul- und Bulgarien -

Metropolisation of River Basins: Between Threats and Opportunities
I N T A – Real Corp 2012 International Roundtable - Conclusions Have we reached a limit in making the city? Metropolisation of River basins: between threats and opportunities. Schwechat, Austria, 15 May 2012 Activity of the Community of Competence Metropolisation in collaboration with: INTA is a global membership association where public and private policy-makers and urban practitioners come together to share knowledge, experiences and performing tools for integrated urban development. SIRET : 353 881 451 00036 - 18, rue Daval, 75011 Paris, France. T: +31 (0)1 58 30 34 52 M: [email protected] W: www.inta-aivn.org INTA INDEX The CCMetro identified three groups of critical questions........................................................................................3 Is there a possible limit to urban development?.......................................................................................................4 How flooding defense can be combined with urban development and urban areas?...............................................5 More questions raised in the course of the CCMetro working session.....................................................................9 The identified gaps in the debate are a chance for new questioning......................................................................10 Report by Viviana Rubbo, INTA Daniela Patti, MSc Researcher at CEIT ALANOVA All abstracts and presentations available here The latest working session of the Community of Competence on Metropolisation (CCMetro) took place in Schwechat (Austria) at the occasion of the 17th International Real Corp Conference. The mandate of the CC Metropolisation is to explore and propose new and innovative solutions to pressing metropolitan development issues. The debate in Schwechat focused on development strategies for territories in fragile environmental situation such as those threaten by climate change and rise of water level : large river basins like the Rhine and the Danube or delta areas like in The Netherlands or Romania. -

Planning and Implementation of Green Infrastructure in Austrian Cities
Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research (OeAD) Centre for International Cooperation & Mobility (ICM) ILAP Aktion Österreich-Slowakei AÖSK-Stipendien für Postdoktoranden Technical Scientific Report Institute of Landscape Planning ICM-2018-12149 Institut für Landschaftsplanung funded by Planning and Implementation of Green Infrastructure in Austrian Cities Attila Tóth Doris Damyanovic Florian Reinwald Vienna 01.03. - 31.08.2019 1 Imprint Title: Planning and Implementation of Green Infrastructure in Austrian Cities Authors: Dr. Attila Tóth1,2 [email protected], [email protected] Assoc. Prof. Dr. Doris Damyanovic2 [email protected] Dr. Florian Reinwald2 [email protected] 1Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia Department of Landscape Architecture 2University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria Institute of Landscape Planning Peer-reviewers: Prof. Dr. Gerda Schneider, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Landscape Planning Prof. Dr. Ľubica Feriancová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Landscape Architecture Scholarship: Aktion Österreich-Slowakei, AÖSK-Stipendien für Postdoktoranden Funding institution: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research Awarding org.: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), Centre for International Cooperation & Mobility (ICM) Reference number: -

Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good Practice
Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good practice Flood Risk Management in Austria Objectives – Measures – Good practice Vienna 2018 Publishing information Media owner, general editor and publisher: Federal Ministry for Sustainability and Tourism Stubenring 1, A-1010 Vienna +43 1 71100-0 www.bmnt.gv.at Text, editing and design: Marian Unterlercher, Revital - Integrative Naturraumplanung GmbH; supported by the Federal Water Engineering Administrations in the Provinces (Selection and description of the example projects) Proofing: Clemens Neuhold, Drago Pleschko, Franz Schmid, Heinz Stiefelmeyer, Martin Wenk Image sources: Air Media/ Karl Strauch (p. 42 right), Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 12 (p. 13, p. 16 right, p. 17 top left, bottom left, bottom right, p. 45), Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Wasserbau (p. 50), Amt der Salzburger Landesregierung Abt. 7 (p. 24-25, p. 30-31), Amt der Tiroler Landesregierung BBA Reutte (p. 45), Amt der Vorarlberger Landesregierung (p. 48 (2), Amt der Vorarlberger Landesregierung/Walter Häusler (p. 6), BMNT/Paul Gruber (p. 5), BMVIT/Martin Stippel (p. 13 bottom), BMNT (p.27, p.41), Autonome Provinz Bozen-Südtirol Abt. 30 Wasserschutzbauten (p. 15 left), Bundesheer/Kermer (p. 7), Bundesheer (p. 10 left, right , p. 18 right), Bundesheer/Mario Berger (p. 11), Bundesheer/Günther Filzwieser (p. 12, p. 15 right), Bundeswasserbauverwaltung Burgenland (p. 46 top right, left), Bundeswasserbauver- waltung Steiermark/zepp-cam/Graz (p. 38), BWV Steiermark (p. 44), Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung Sektion Kärnten (cover image; p. 13 left, p. 17 top right, p. 33 bottom right), Hydroingenieure (p. 14 li.), Gunz ZT GmbH (p. 43), ICPDR (p. -

Triturus Dobrogicus) and Common Spadefoot Toads (Pelobates Fuscus)
HERPETOLOGICAL JOURNAL, Val. 8, pp. 181-186 (1998) PITS VERSUS PATTERNS: EFFECTS OF TRANSPONDERS ON RECAPTURE RATE AND BODY CONDITION OF DANUBE CRESTED NEWTS (TRITURUS DOBROGICUS) AND COMMON SPADEFOOT TOADS (PELOBATES FUSCUS) ROBERTJEHLE AND WALTERHÖDL Institute of Zoology, University o~"Vienna. Althanstr. 14, A-1090 Vienna, Austria During a long-terrn study (1987-1996) near Vienna (Austria), individual Danube crested newts (Trititrus dobrogicus) and cornmon spadefoot toads (Pelobatesfuscus) were registered by photographs of highly variable Skin patterns, and the implantation of Passive lntegrated Transponders (PIT tags). To test for potential detrirnental efficts of the electronic tags, we cornpared within-year (for P. fiiscus) and between-year (for T. dobrogiczts) recapture rates and body condition index (CI) of individuals rnarked with the two altcrnative techniques. No significant negative effects of PIT tags on CI and recapture rate could be dernonstrated for either spccies. There was a decrease in body condition and recapture rates in the study years 1995 and 1996, but can be attributed to population trends rather than to the different rnarking rnethods. For recaptured T ~iobrogicusa 10.5% loss of PIT tags was observed. INTRODUCTION conducted to test for detrimental effects of implanted transponders by calibrating the results with alternative One of the major difficulties in conducting studies techniques [Brown (1997), on Bufo bufo and Rana on free-ranging amphibian populations is the selection temporaria]. For most species on which this rnethod of a suitable marking technique. Compared to other has already been applied, long-term field data are lack- vertebrates, amphibians are especially difficult to mark ing. permanently on an individual level (for reviews see During a long-term study near Vienna (Austria), two Ferner, 1979; Donnelly, Guyer, Juterbock 9r. -
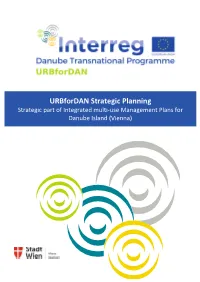
3.4. Strategic Part of Immps for UPF Vienna.Pdf
URBforDAN Strategic Planning Strategic part of Integrated multi-use Management Plans for Danube Island (Vienna) 2 Table of content Table of content .......................................................................................................................................... 2 I. INTRODUCTION .................................................................................................................................... 3 About the URBforDAN Project .................................................................................................................. 3 1. Strategic part of the Integrated Multi-use Management Plan (IMMP) .................................................. 4 1.1 The objective of strategic plan ...................................................................................................... 4 1.2 The planning process and partcipation ......................................................................................... 6 1.3 Legal basis .................................................................................................................................... 9 1.4 Terminology ................................................................................................................................10 2. ANALYSIS OF THE STATE OF THE ART ...................................................................................................11 2.1 Basic data on the strategic area ...................................................................................................11 2.2 -

Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Voigt, Andreas Book Part "Backbone" of the Orient/East-Med Corridor: Vienna- Bratislava-Budapest-Belgrade axis Provided in Cooperation with: ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft Suggested Citation: Voigt, Andreas (2019) : "Backbone" of the Orient/East-Med Corridor: Vienna-Bratislava-Budapest-Belgrade axis, In: Scholl, Bernd Perić, Ana Niedermaier, Mathias (Ed.): Spatial and transport infrastructure development in Europe: Example of the Orient/East- Med Corridor, ISBN 978-3-88838-095-2, Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, pp. 231-242, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-0952127 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/213383 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

PA 5880: Exploring Global Cities Urban and Environmental Sustainability Innovation in Austria May 19-31, 2014 Draft Itinerary and Study Abroad Overview 11.1.13
PA 5880: Exploring Global Cities Urban and Environmental Sustainability Innovation in Austria May 19-31, 2014 Draft Itinerary and Study Abroad Overview 11.1.13 Overview The program is scheduled for May 19-31, 2014, and is being offered as a 2-credit spring semester course in the Humphrey School of Public Affairs called PA 5880: Exploring Global Cities. The program will address a wide range of applications in sustainability related to topics such as housing, transportation, urban development, energy, water, waste, and agriculture. Students will visit projects sites and meet with experts in a number of Austrian cities, including Vienna, Linz, Salzburg, Graz, and Güssing. The program includes opportunities to meet with government officials and explore international, national, and local policies intended to advance sustainability and mitigate climate change. Contact The instructor for the course is Dr. Carissa Schively Slotterback, Associate Professor in Urban and Regional Planning in the Humphrey School of Public Affairs at the University of Minnesota. She can be reached at [email protected] or (612) 625-0640. Itinerary The itinerary below outlines key dates, meetings, and site visits. While most details have been confirmed, some items will be finalized over the next couple of months. We will travel via public transit and private coach. Day 0 Monday, May 19, 2014 Depart Minneapolis for Vienna (students will make their own travel arrangements, but should plan to arrive by no later than the afternoon of May 20) Day 1 Tuesday, May 20, 2014 Vienna Arrive at Vienna International Airport Austrian welcome dinner Overnight in Vienna Day 2 Wednesday, May 21, 2014 Vienna Visit to Aspern – Vienna’s Urban Lakeside (Die Seestadt Wiens) - http://www.aspern-seestadt.at/en This 240 ha redevelopment of a former airfield is the most important urban development venture ever initiative in Vienna and one of the largest of its kind in Europe. -

Danube Bike & River Cruise: Prague to Budapest
VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Danube Bike & River Cruise: Prague to Budapest Bike Vacation + Air Package A Danube cycling and river cruise doesn’t get any better than this! In just a week, you’ll explore four different countries— Germany, Austria, Slovakia, and Hungary—as well as a world-class cultural capital, Vienna. Cycle the renowned Danube Bike Path, admiring vistas of storybook villages and castles, lush vineyards, and carpeted hills unfurling along the river banks. Pause to explore medieval cities and the spectacular Melk Abbey, and enjoy a private wine tasting. And at the end of the day, return to a deluxe Emerald Waterways river ship, where attentive service, fine dining, and a welcoming ambiance invite you to relax after an invigorating day. There’s no better or more convenient way to experience the heart of Europe! Cultural Highlights Unpack once, then bike and boat along the Danube in four countries and three cultural 1 / 11 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com capitals—all on one trip Follow the car-free and scenic Danube and EuroVelo 6 bike paths in this bicycle-friendly region Enjoy an exclusive Viennese concert with the music of Strauss and Mozart Choose to be as active or relaxed as you wish from our menu of cycling routes and walking tours What to Expect On Shore: This tour offers easy riverside terrain, with a few climbs to reach riverside towns. Riding is primarily on bike paths of both pavement and packed gravel, with some road riding through both urban and rural areas. -
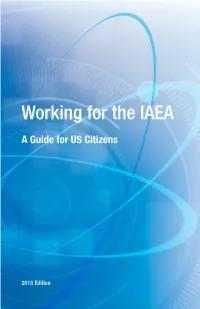
Working for the IAEA
Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition From the Editors This Guidebook is intended to provide practical information for United States citizens embarking on or considering an assignment at the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria. Since its first appearance in 1989, the Guidebook has been revised frequently to reflect changes occurring at the IAEA, within the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP), and in Vienna. The 2018 Edition reflects these changes at the time of publication. Nevertheless, IAEA salaries, allowances, and other benefits change, as do telephone numbers, addresses, and websites. Currency exchange rates, prices, and store hours in Vienna inevitably fluctuate. We regret any inconvenience this may cause our readers. The 2018 Edition of the Guidebook was prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the USSP and was published by Brookhaven National Laboratory (BNL). Jeanne Anderer, Ben Dabbs Editors November 2018 Working for the IAEA: A Guide for US Citizens 2018 Edition Prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP) International Safeguards Project Office (ISPO) Brookhaven National Laboratory 30 Bell Avenue, Building 490C Upton, New York 11973‑5000, USA Telephone: (631) 344‑5902 Fax: (631) 344‑5266 Web: bnl.gov/ispo facebook.com/ISPObnl youtube.com/IAEAvideo Printed by Brookhaven -

Die Grundzüge Des Donauinsel-Projektes
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at DIE GRUNDZÜGE DES DONAUINSEL-PROJEKTES FRANZ MICHLMAYR Zusammenfassung Die Donauinsel ist eines der größten innerstädtischen Freizeit- und Erholungsgebiete der Welt. Neben den wasserwirtschaftlichen und bautechnischen Aspekten dieser in erster Linie als Hochwasserschutzprojekt kon- zipierten Anlage traten daher schon bald nach Baubeginn die Bedürfnisse der Erholung suchenden Bevöl- kerung in den Vordergrund. Nur wenig später wurde der nicht unbeträchtliche Wert der Donauinsel als natür- licher Raum erkannt, der die Auen oberhalb und stromab von Wien verbindet. Der Bau von Biotopen und öko- logisches Management sind nun fester Bestandteil wasserbaulicher Bau- und Erhaltungsmaßnahmen. Die Donauinsel ist ein Beispiel für diese Entwicklung. Summary Outline of the Danube I s I and-Proj ec t The Danube Island is one of the largest municipal leasure and recreational areas of the world. The Danube Island, which was primarily designed as a flood control system also offered a great challenge in the respect of water management and water construction. But soon after the construction was started the people's inte- rest in the recreational aspects became dominant. A little while later scientists and the municipalities realized the eminent value of the Danube Island as a natural link between the wetlands up and downstream of Vien- na. The planning and the construction of biotopes and the ecological management are therefore now a firm part in the city's measures of water construction and management. The Danube Island is an example for this development. Denisia 03, 11-23 11 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at 1. Einleitung Der Wiener Raum ist durch den Übergang von einer montan feuchtkühlen Zone (Ausläufer des Wienerwaldes) zu einer pontisch-pannonischen, xerothermen Zone (Wiener Becken, March- feld) gekennzeichnet.