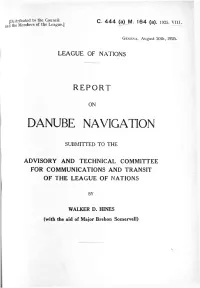UMWELTGUTACHTEN PETZ OG
TECHNISCHES BÜRO FÜR ÖKOLOGIE UND UMWELTSCHUTZ
DR. WOLFGANG PETZ MAG. DR. REGINA PETZ-GLECHNER
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Fischerei und Fließgewässerökologie
WASSERKRAFTANLAGE SCHNEIZLREUTH
AN DER SAALACH
GEWÄSSERÖKOLOGISCHE BEGLEITPLANUNG
SPERRVERMERK – BEFRISTET
Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.
Erstveröffentlichung nach Einleitung des
Anhörungsverfahrens.
Im Auftrag von
Wasserkraft Schneizlreuth GmbH & Co. KG Untereggerhausen 2 D-83355 Grabenstätt
Auftragnehmer & Projektleitung
TB Umweltgutachten Petz OG
Bearbeiter
Generelles Projekt
Dr. Wolfgang Petz Dr. Regina Petz-Glechner Mag. Stefan Achleitner Markus Walkner, MSc Mag. Philipp Feldmüller Mag. Markus Kuhn
Teil Makrozoobenthos & Algen
ARGE Ökologie, Wien Dr. Karl Panek Mag. Wolfgang Siegl
Einreichprojekt – Teil C 1
Neumarkt a. W., Juni 2019
Neufahrn 74, A-5202 Neumarkt am Wallersee Tel. 06216-20158-0, Fax DW -22 mobil 0676-84 24 09 100
Auf der Haiden 120, A-5280 Braunau/Inn e-mail: [email protected] www.umweltgutachten.at
Wasserkraftanlage Schneizlreuth an der Saalach - Gewässerökologische Begleitplanung
- 2
- TB Umweltgutachten Petz OG
Wasserkraftanlage Schneizlreuth an der Saalach - Gewässerökologische Begleitplanung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ......................................................................................................................... 7 2. Beschreibung des Projektes............................................................................................. 7 3. Untersuchungsgebiet........................................................................................................ 8
3.1. Bewirtschaftungsplan 2016-2021 (Deutschland) .......................................................11 3.2. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2015 (Österreich)...................................15
4. Beschreibung der Gewässerstrecke................................................................................20
4.1. Ökomorphologie........................................................................................................20 4.2. Hydromorphologischer Ist-Zustand ...........................................................................28 4.3. Strukturgütekartierung...............................................................................................48
4.3.2. FWK 1_F650 ......................................................................................................48 4.3.1. FWK 1_F651 ......................................................................................................50
4.4. Mesohabitatkartierung...............................................................................................52
4.4.1. Einleitung ............................................................................................................52 4.4.2. Methodik.............................................................................................................52 4.4.3. Ergebnisse .........................................................................................................53
4.4.3.1. Abschnitt 1...................................................................................................53 4.4.3.2. Abschnitt 2...................................................................................................60 4.4.3.3. Abschnitt 3...................................................................................................68 4.4.3.4. Abschnitt 4...................................................................................................75
4.4.4. Diskussion..........................................................................................................82
4.5. Habitatverfügbarkeit..................................................................................................84
4.5.1. Strecke 1............................................................................................................87 4.5.2. Strecke 2............................................................................................................92 4.5.3. Strecke 3............................................................................................................97 4.5.4. Strecke 4..........................................................................................................101 4.5.5. Fazit .................................................................................................................106
5. Benthische Lebensgemeinschaften...............................................................................107
5.1. Methodik.................................................................................................................107 5.2. Ergebnisse..............................................................................................................108
5.2.1. Stelle 1 – Referenz oberhalb der geplanten Fassung .......................................108 5.2.2. Stelle 2 – unterhalb geplanter Fassung, oberhalb ARA ....................................115 5.2.3. Stelle 3 – mittlerer Bereich der geplanten Ausleitung, unterhalb ARA...............122
- TB Umweltgutachten Petz OG
- 3
Wasserkraftanlage Schneizlreuth an der Saalach - Gewässerökologische Begleitplanung
5.2.3. Stelle 4 – unterer Bereich der geplanten Ausleitung .........................................129
5.3. Diskussion ..............................................................................................................136
5.3.1. Stelle 1 – Referenz oberhalb der geplanten Fassung .......................................136 5.3.2. Stelle 2 – unterhalb geplanter Fassung, oberhalb ARA ....................................137 5.3.3. Stelle 3 – mittlerer Bereich der geplanten Ausleitung, unterhalb ARA...............138 5.3.4. Stelle 4 – unterer Bereich der geplanten Ausleitung .........................................140 5.3.5. Längsvergleich der Untersuchungsstellen......................................................141
6. Fischfauna.....................................................................................................................143
6.1. Methodik.................................................................................................................143
6.1.1. Fischbestandsaufnahme...................................................................................143 6.1.2. Fischökologische Bewertung............................................................................144
6.1.2.1. Bewertung nach fiBS..................................................................................144 6.1.2.2. Bewertung nach FIA...................................................................................144
6.2. Beschreibung der Befischungsstrecke ....................................................................146 6.3. Ergebnisse..............................................................................................................149
6.3.1. Fischarten.........................................................................................................149 6.3.2. Fischbestand 2016 ...........................................................................................150 6.3.3. Fischbestand 2018 ...........................................................................................153
6.4. Fischökologischer Zustand nach fiBS .....................................................................157
6.4.1. Grundlagen der Bewertung...............................................................................157
6.4.1.1. Referenzzönose.........................................................................................157 6.4.1.2. Fangzahlen................................................................................................158 6.4.1.3. Abgrenzung der Altersklasse 0+ ................................................................159 6.4.1.4. Dummies....................................................................................................161
6.4.2. Zustandsbewertung..........................................................................................162
6.5. Fischökologischer Zustand nach FIA ......................................................................163
6.5.1. Fischartenleitbild...............................................................................................163 6.5.2. Zustandsbewertungen......................................................................................165
6.6. Diskussion ..............................................................................................................167
7. Zusammenfassende Bewertung ....................................................................................170
7.1. Grundlagen.............................................................................................................170 7.2. Biologische Qualitätskomponenten .........................................................................171
7.2.1. OWK 301330016..............................................................................................171 7.2.2. OWK 301330015 / FWK 1_F650 ......................................................................172
- 4
- TB Umweltgutachten Petz OG
Wasserkraftanlage Schneizlreuth an der Saalach - Gewässerökologische Begleitplanung
7.2.3. FWK 1_F651 ....................................................................................................173
7.3. Hydromorphologische Qualitätskomponenten.........................................................175 7.4. Zusammenfassung .................................................................................................175
8. Mindestdotation der Ausleitungsstrecke ........................................................................176
8.1. Methodik.................................................................................................................176 8.2. Ergebnisse..............................................................................................................180
8.2.1. Durchfluss ........................................................................................................180 8.2.2. Querprofile........................................................................................................180
8.2.2.1. Maximaltiefe...............................................................................................180 8.2.2.2. Mittlere Fließgeschwindigkeit .....................................................................188 8.2.2.3. Fließgeschwindigkeit im Wanderkorridor....................................................191 8.2.2.4. Froude-Zahl ...............................................................................................193 8.2.2.5. Benetzte Breite ..........................................................................................196 8.2.2.6. Wasserfläche .............................................................................................198 8.2.2.7. Mittlere Wassertiefe im Talweg TLR (Längsprofile)......................................199
8.2.3. Zusätzliche Profile ............................................................................................202
8.3. Diskussion ..............................................................................................................202
8.3.1. Gewässer und Durchfluss.................................................................................202 8.3.2. Bestimmungen zur Ermittlung der Mindestdotation...........................................203
8.3.2.1. QZV Ökologie OG......................................................................................203 8.3.2.2. LAWA ........................................................................................................204 8.3.2.3. Weitere Anforderungen..............................................................................205
8.3.3. Erforderliche Restwassermenge.......................................................................205 8.3.4. Bettbildende Wassermenge..............................................................................212 8.3.5. Gewässergüte und Wassertemperatur .............................................................212
8.4. Fazit........................................................................................................................213
9. Auswirkungen des Projektes .........................................................................................215
9.1. Wasserentnahme....................................................................................................215 9.2. Stau ........................................................................................................................216 9.3. Kontinuum...............................................................................................................217
9.3.1. Errichtung einer Fischwanderhilfe.....................................................................218
9.3.1.1. Ökologische Zielvorgaben..........................................................................218 9.3.1.2. Grundlagen der Planung ............................................................................218 9.3.1.3. Beschreibung der Fischwanderhilfe ...........................................................219
- TB Umweltgutachten Petz OG
- 5
Wasserkraftanlage Schneizlreuth an der Saalach - Gewässerökologische Begleitplanung
9.3.2. Fischschutz und Fischabwanderung.................................................................221
9.3.2.1. Abstieg über Fischabstiegsanlage..............................................................221 9.3.2.2. Abstieg über FWH......................................................................................221 9.3.2.3. Abstieg über Sohlanhebung.......................................................................221 9.3.2.4. Abstieg über Wehranlage...........................................................................222 9.3.2.5. Fischschutz................................................................................................222
10. Maßnahmen zur Verminderung ...................................................................................223
10.1. Stauraum ..............................................................................................................223 10.2. Entnahmestrecke..................................................................................................226
10.2.3. OWK 301330015 / FWK 1_F650 ....................................................................227 10.2.4. FWK 1_F651 ..................................................................................................228
11. Zusammenfassende Beurteilung und Prognose ..........................................................232
11.1. Rechtliche Grundlage und Oberflächenwasserkörper ...........................................232 11.2. Prognose ..............................................................................................................232
11.2.1. Grundlagen der Prognose ..............................................................................232 11.3.2. OWK 301330016............................................................................................234 11.3.3. OWK 301330015 / FWK 1_F650 und FWK 1_F651........................................235
12. Literatur.......................................................................................................................238 13. Anhang........................................................................................................................243
13.1. Anhangstabellen Benthos .....................................................................................243 13.2. Messprotokolle......................................................................................................247