Filozofick Fakulta Univezity Karlovy V Praze
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GERMAN MASQUERADE Part 4
Beyond Alexanderplatz ALFRED DÖBLIN GERMAN MASQUERADE WRITINGS ON POLITICS, LIFE, AND LITERATURE IN CHAOTIC TIMES Part 4: Literature Edited and translated by C.D. Godwin https://beyond-alexanderplatz.com Alfred Döblin (10 August 1878 – 26 June 1957) has only slowly become recognised as one of the greatest 20th century writers in German. His works encompass epic fictions, novels, short stories, political essays and journalism, natural philosophy, the theory and practice of literary creation, and autobiographical excursions. His many-sided, controversial and even contradictory ideas made him a lightning-conductor for the philosophical and political confusions that permeated 20th century Europe. Smart new editions of Döblin’s works appear every decade or two in German, and a stream of dissertations and major overviews reveal his achievements in more nuanced ways than earlier critiques polarised between hagiography and ignorant dismissal. In the Anglosphere Döblin remains known, if at all, for only one work: Berlin Alexanderplatz. Those few of his other works that have been translated into English are not easily found. Hence publishers, editors and critics have no easy basis to evaluate his merits, and “because Döblin is unknown, he shall remain unknown.” Döblin’s non-fiction writings provide indispensable glimpses into his mind and character as he grapples with catastrophes, confusions and controversies in his own life and in the wider world of the chaotic 20th century. C. D. Godwin translated Döblin’s first great epic novel, The Three Leaps of Wang Lun, some 30 years ago (2nd ed. NY Review Books 2015). Since retiring in 2012 he has translated four more Döblin epics (Wallenstein, Mountains Oceans Giants, Manas, and The Amazonas Trilogy) as well as numerous essays. -

Why Adolf Hitler's Psychiatric Treatment at the End Of
Review article Deconstructing the myth of Pasewalk: Why Adolf Hitler’s psychiatric treatment at the end of World War I bears no relevance JAN ARMBRUSTER1, PETER THEISS-ABENDROTH2 1 Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Helios Hanseklinikum Stralsund, Stralsund, Germany. 2 Touro College Berlin, Berlin, Germany. Received: 9/15/2015 – Accepted: 6/11/2016 DOI: 10.1590/0101-60830000000085 Abstract Background: Even more than 70 years after the end of WW II, questions regarding the personality of dictator Adolf Hitler (1889-1945) remain unresolved. Among them, there is a focus on the problem of his state of mental health, in particular on the possible relevance of the medical treatment he received for a war injury at the military hospital of the small German town of Pasewalk in the last days of WW I. Some authors have come to postulate a profound change of his personality due either to a psychic trauma suffered or a hypnotic therapy he supposedly underwent for curing a hysterical blindness. Objectives: The assump- tions about Hitler’s war injury which rely on only two significant sources shall be assessed for their validity. Methods: Existing historical sources and inferred hypotheses will be discussed in the light of alternative interpretations. Results: The mentioned suppositions reveal their highly arbitrary character: neither a hysterical blindness of Hitler’s nor a hypnotic treatment at Pasewalk military hospital can be substantiated. Discussion: Given the fact that Hitler’s medical sheet is most likely irrevocably lost, the authors plea for the acceptance of the limitations of historical research, even more so since the occurrences in Pasewalk lack any deeper importance for a historic assessment of Hitler’s personality. -

History of the Arts in the Olympic Games
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the q u alityo f the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission ofof the the copyrightcopyright owner.owner. FurtherFurther reproduction reproduction prohibited prohibited without without permission. -

In Transit: Placelessness and the Absurd in the Writings
In Transit: Placelessness and the Absurd in the Writings of Anna Seghers Gerry Kearns Maynooth University The structure of feeling that has been called the absurd suggests a placeless and irrational world. Yet such a structure of feeling is sometimes produced in response to quite a specific context. This essay considers the way absurdity arises and is treated within Anna Seghers’s Transit, a novel about the plight of refugees from Nazi Germany trying to leave unoccupied France after the signing of the Armistice between France and Germany in June 1940. The essay explores the treatment of space and time in the novel and suggests that there is a significant distinction between absurdity as resignation and absurdity as dissent. The essay also claims that absurdity is explicitly countered in the novel in the pursuit of a politics of responsibility and a resistance in solidarity. Key Words: Absurd, Walter Benjamin, Georg Lukács, Placelessness, Refugees, Anna Seghers PLACELESSNESS, OBJECTIVITY, AND THE ABSURD In an essay on two of Doris Lessing’s novels, Seamon (1981, 85) suggests that works of imaginative literature may provide “a testing ground” for examining phenomenological insights about “at-homeness” as “an essential aspect of human existence”. Seamon looks at some characters who are seemingly attached to place and others who feel dissevered from the pathways of local social reproduction and existential security. In Seamon’s essay two varieties of placelessness (Relph 1976) are described. The first is that of the spatial dislocation of the foreigner yet to learn local ways sufficient to invest locality with the love that may come with familiarity. -

Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis Die Auswahlbibliographie besteht aus besonders wichtigen Titeln des nachfolgenden Literaturverzeichnisses. Dieses Hauptverzeichnis enthält alle in dem Buch in Kurz form angeführten Texte und Forschungsbeiträge und darüber hinaus eine Auswahl von Sekundärliteratur sowie Hinweise auf einschlägige Werkausgaben und Monogra phien zu einzelnen Autoren. In der Autorenbibliographie sind auch Texte von Wis senschaftlern vor und aus der Zeit des expressionistischen Jahrzehnts verzeichnet. 1. Kleine Auswahlbibliographie zum Expressionismus 2. Allgemeine Forschung, Anthologien und Dokumentensammlungen 3. Autoren: Werkausgaben, Einzeltexte, Forschungsbeiträge 1. Kleine Auswahlbibliographie zum Expressionismus Einfohrungen, umfassende Darstellungen und Sammelbände Anz, Thomas u. Michael Stark (Hg.): Die Modernität des Expressionismus. Stuttgart 1994. Arnold, Arnim: Die Literatur des Expressionismus. Sprachliche und thematische Quellen. Stuttgart 1966. -: Die Prosa des Expressionismus. Herkunft, Analyse, Inventar. Stuttgart 1972. Fähnders, Walter: Avantgarde und Moderne 1890-1933. Stuttgart, Weimar 1998. Krull, Wilhe1m: Prosa des Expressionismus. Stuttgart 1984. Mix, York-Gothart (Hg.): Naturalismus, Fin de siecle, Expressionismus 1890-1918. München 2000 (= Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 7). Paulsen, Wolfgang: Deutsche Literatur des Expressionismus. Bern, Frankfurt a.M. 1983. Rothe, Wolfgang (Hg.): Expressionismus als Literatur. Gesammelte Studien. Bern, München 1969[a). -: Der Expressionismus. Theologische, -
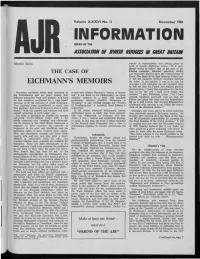
INFORMATION ISSUED by the Assooaim of Mwm I^UOES « Aieat Britatl
^r^<^-:^W^^S£<^i^iWfWr^r.. m Volume XXXVI No. 11 November 1981 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOOAim OF MWm I^UOES « aiEAT BRITAtl Martin Stern murder or extermination were always given by word of mouth. Eichmann writes: "It is com pletely wrong to believe that at the start of the Russian campaign, Himmler, Heydrich, Muller THE CASE OF and Eichmann decided upon the extermination of Jewry. The Head of the Sipo (Security Police) and of the SD (Security Service) Heydrich received the order. In my opinion it was in no way his EICHMANN'S MEMOIRS own idea. I still remember the very moment when he told me that the Fuhrer had ordered physical extermination. I heard the expression for the first Novemljer inevitably brings back memories of it suits him. Gideon Hausner's "Justice in Jerusa time in my life and I shall never forget that the Kristallnacht and the great tragedy that lem" is not listed in the bibliography, an extra moment." Later, Eichmann writes: "As I have followed inexorably from that prelude. And here ordinary omission in a book with scholarly stressed, Heydrich personally told me that the we find ourselves confronted by a long book* pretensions. Hannah Arendt's "Eichmann in Fuhrer had given the order and the Reichsfuhrer claiming to be the memoirs of Adolf Eichmann. Jerusalem" is also omitted (though her "Origins SS, as is well known, had charged Brigadefuhrer Two questions come immediately to mind. Are of Totalitarianism" is included). Raul Hilberg is Globocnik with carrying it out within the frame they genuine? And even if they are, does it really called Paul. -

Holocaust Education Week Presented By
HOLOCAUST EDUCATION WEEK PRESENTED BY An intergenerational experience at the Neuberger’s Yom Hashoah Yom at the Neuberger’s experience An intergenerational for the Neuberger. Dahlia Katz Photography Photo: 2019. commemoration, UJA Federation of Greater Toronto is the Neuberger’s sustaining sponsor. UJA is proud to support the Neuberger’s world- class programming during Holocaust Education Week and its year-round educational and remembrance programs. facebook.com/HoloCentre @Holocaust_Ed @Holocaust_Ed Annual Student Symposium. Photo: Seed9 for Photo: Annual Student Symposium. the Neuberger. Cover photos: Pola Garfinkle (Paula Dash), Allison Nazarian’s grandmother, sewing in the Lodz Ghetto, circa 1941-2. Courtesy of Allison Nazarian via the United States Holocaust Memorial Museum. / Rally participant, 2018. Photo: Lorie Shaull. / Caring Corrupted archival images courtesy of the United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Museum, Houston, and US Library of Congress via the University of Texas Health Science Center at Houston. We are delighted to welcome you to the 39th year of Holocaust Education Week. As you flip through this year’s guide, you will see that our programs curated around the theme, The Holocaust and Now, appear to have been “torn from the headlines.” With so much social, cultural and political turmoil occurring globally, we find ourselves discussing the relationship between the Holocaust and what is happening around us today. It is both timely and necessary for HEW to address our current zeitgeist–the rise of global antisemitism, denial, hate crimes, both online and in our own neighbourhoods, a reckoning with difficult aspects of our Canadian past; and conversely, an examination of how the legacy of the Holocaust has inspired positivity, action and change. -
KAREL WASSERMANN (Prague, SSR) Some Observations on The
KAREL WASSERMANN (Prague, �SSR) Some Observations on the Prague Circle Margarita Pazi. Fünf Autoren des Prager Kreises. "Würzburger Hochschul- schriften zur neuren Deutschen Literaturgeschichte, Bd. 3." Frankfurt am Main: Peter Lang, 1978. 315 pp. sFr. 55,-(paper). The five authors considered in this work are Oskar Baum (1883-1941 ), Paul Kornfeld (1889-1942), Ernst Sommer (1889-1955), Ernst Weiss (1884- 1940), and Ludwig Winder (1889-1946)-all well known to those familiar with the literature of interwar German-Jewish Prague, and all connected, as their life and death dates show, by strong chronological affinities. In review- ing this book I will sidestep most of the literary text in order to concentrate on the key sixty pages headed by the phrase, "The Prague of the 'Prague Cir- " cle' (hereafter abbreviated as P.C.). This chapter is so intriguing that I am grateful for the opportunity to say something about this controversial theme. Mrs. Margarita Pazi has set for herself the task of revising (or completing) the memoirs of Max Brod, which were published in 1968 when he was eighty- four years old. What is evident, alas !, is her complete devotion to Brod, to his idiosyncrasies and feuds, and her indiscriminate reliance upon "widow's tales" (see her Acknowledgments) and her nostalgia for the German-Jewish cultural milieu of Prague. To discuss Austria-Hungary, "the kettle of nations," and particularly the "Prague" phenomenon in this context reminds one of Venice, the city of lagoons. The national, religious, social, and cultural factors are labyrinthine. The author seems adroit at posing questions, staging the scene, and demon- strating the controversiality of the protagonists. -
Hitler's Jewish Physicians
Open Access Rambam Maimonides Medical Journal HISTORY OF MEDICINE Hitler’s Jewish Physicians George M. Weisz, M.D., M.A., F.R.A.C.S.* School of Humanities, University of New England, Armidale, Australia and University of New South Wales, Sydney, Australia ABSTRACT The mystery behind the behavior of infamous personalities leaves many open questions, particularly when related to the practice of medicine. This paper takes a brief look at two Jewish physicians who played memorable roles in the life of Adolf Hitler. KEY WORDS: Hitler, hysterical blindness, Jewish physicians INTRODUCTION DR EDUARD BLOCH History reveals that over the centuries Jewish 1908: August–December, Linz, Austria. people have been excluded from some professions, The Hitler family send you the best wishes while being forced into specific ones. This led to for a Happy New Year, in everlasting them often finding a place in medicine and thankfulness. AH.1 finance. Restricted to specific localities and work conditions, Jewish physicians nonetheless found Dr Eduard Bloch was a general physician, their work appreciated even by perpetrators of practicing on the main street of the poor neigh- anti-Semitism. Royalty and national leaders often borhood of Austria’s third largest city, Linz. A engaged the services of private Jewish physicians, promise was given to this Jewish doctor by a while officially supporting anti-Semitism. The list grateful patient: “I shall be grateful to you forever, of famous personalities using the services of A.H.,” followed by a postcard sent from Vienna. Jewish physicians is long. Of particular surprise is the connection two Jewish physicians had (albeit Eduard Bloch was born in 1869 to a Jewish an inadvertent one) with the greatest persecutor of family in Frauenburg, a small southern Bohemian the Jewish nation, the Fuehrer of the Third Reich. -

SUSI EISENBERG-BACH Dutch Publishers of German Exile Literature Without Any Exile Publishers There Could Exist No Exile Literatu
SUSI EISENBERG-BACH Dutch publishers of German exile literature Without any exile publishers there could exist no exile literature, that is the literature in German language outside of Germany between 1933 and 1950. Those books that could no longer be printed in Germany were at first pub- lished in Austria and then also in Switzerland, in France, in England, in Sweden and above all in the Netherlands. At that time, books in German were also printed in Russia, Czechoslovakia as well as in North and Latin America. The most intense publishing activity, however, took place in Holland. Already in April 1933-even before the burning of the books in Berlin and other German cities which happened on 10 May 1933-Querido and Allert de Lange began their activity. It was Emanuel Querido himself who took the initiative. In April 1933 the translator Nico Rost visited, in the name of Emanuel Querido, Fritz Helmut Landshoff who was then still living in Berlin. He was one of the directors of the publishing firm Kiepenheuer. Rost asked Landshoff whether he was willing to direct a publishing department for German books in Amsterdam. He explained that Querido had the intention to print literary works by German-speaking authors, literary as well as other works which were forbidden in Germany, as a new department of his Dutch publishing firm. For Landshoff this proposition came like a gift from heaven because he could no longer stay in his apartment which had been searched by the Nazis a few days before. Therefore, after Rost's visit, he took the night train to Amsterdam and already on the day of his arrival in Amster- dam everything was settled and Landshoff became the director of the Ger- man department of Emanuel Querido Uitgeversmaatschappij at the Keizersgracht. -
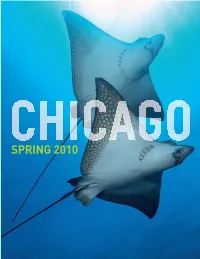
Spring 2010 Contents General Interest 1
Recently Published Spring 2010 Contents General Interest 1 Special Interest 31 Paperbacks 73 Distributed Books 94 Gems and Gemstones Great Plains Ordering Timeless Natural Beauty of the America’s Lingering Wild Information 206 Mineral World Michael Forsberg Lance Grande and Allison Augustyn With a Foreword by Ted Kooser Chapter Introductions by David Wishart ISBN-13: 978-0-226-30511-0 and Essays by Dan O’Brien Subject Index 207 Cloth $45.00/£31.00 ISBN-13: 978-0-226-25725-9 Cloth $45.00/£31.00 Author Index 208 Title Index Inside back cover Piracy Gerhard Richter The Intellectual Property Wars A Life in Painting from Gutenberg to Gates Dietmar Elger Adrian Johns Translated by Elizabeth M. Solaro ISBN-13: 978-0-226-40118-8 ISBN-13: 978-0-226-20323-2 Cloth $35.00/£24.00 Cloth $45.00/£31.00 Cover image: Photograph by Phillip Colla/www.oceanlight.com Uncommon Sense Secrets of the Universe Cover design by Alice Reimann Economic Insights, from How We Discovered the Cosmos Catalog design by Alice Reimann and Mary Shanahan Marriage to Terrorism Paul Murdin Gary S. Becker and Richard A. Posner ISBN-13: 978-0-226-55143-2 ISBN-13: 978-0-226-04101-8 Cloth $49.00 Cloth $29.00/£20.00 CUSA ROBert K. ELDer Last Words of the Executed With a Foreword by Studs Terkel Some beg for forgiveness. Others claim innocence. At least three cheer for their favorite football teams. eath waits for us all, but only those sentenced to death know the day and the hour—and only they can be sure that their Dlast words will be recorded for posterity. -

The Life of Hermann Ungar 1893 – 1929
The life of Hermann Ungar 1893 – 1929 Vicky Unwin Contents The Ungar family of Boskovice Schoolboy, student, soldier Lawyer, Diplomat, Writer Marriage, Birth and Death References 1 The Ungar family of Boskovice My grandfather, Hermann Ungar, was born in 1893 in Boskovice, Moravia. Located in the eastern part of what is now the Czechoslovak Republic, but what was in Hermann Ungar’s time the Austro-Hungarian Empire, it lies 35 kms north of Brno, nestled between several other prominent Jewish communities, in between fertile farmland and forested hills. In the 18th century it was one of the largest Jewish communities in Austria and centre of Talmudic Studies with several renowned Rabbis, the most notable of which was Samuel Ha-Levi Kolin, also known as Machazit ha-Schekel, a direct ancestor of Hermann Ungar. The gateway to the ghetto The town itself was – and still is – divided into the Christian quarter and the Jewish ghetto, which by the mid-19 century comprised one third of the town. It was dominated by the Empire Chateau, elegant and French-inspired, home to the Mensdorff-Pouilly family. The Jews were confined to the ghetto where they carried out traditional trades – tailor, butcher, 2 sword-maker, tanner, cabinet maker, barber, carpenter, furrier and farmer: Jews owned up to 23 hectares of the fertile farmland that surrounded the town and also managed estates of wealthy Hapsburg landowners, as in the case of Hermann Ungar’s uncle, Ludwig Kohn, who lived in nearby Jemnice. The Josef Reforms of 1782, which effectively made Jews equal to all other citizens and allowed freedom of movement, including the right to attend German schools, had a huge impact on the strictly orthodox community who had only spoken Yiddish and Hebrew and had confined themselves to Jewish names.