HOO Westermarsch II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schlüssel Fläche Km² Bürgermeister/In Hauptverwaltungs
Gemeindeverzeichnis Herausgeber: Landkreis Aurich, Kommunalaufsicht der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich Telefon 04941 16-1011, Fax 04941 16-1096 Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2016 e-mail:[email protected] aktualisiert: 10/2017 http://www.landkreis-aurich.de/fileadmin/civserv/3452/forms/gemeindeverzeichnis_07_08.pdf Stadt/Gemeinde/ Mitgliedsgemeinden/ Gemeinde- Fläche Ein- Einwohner Hauptverwaltungs- Postanschrift, Telefon/Fax Bürgermeister/in Samtgemeinde Ortsteile schlüssel km² wohner pro km² beamtin/er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Städte Ortsteile Aurich Aurich 03452001 197,22 41.810 210,4 26587 Aurich Bürgermeister Heinz- Brockzetel Postfach 1769 Werner Windhorst Dietrichsfeld Tel.: 04941/12-0 Egels Fax: 04941/12-1150 Extum [email protected] Georgsfeld www.aurich.de Haxtum Kirchdorf Langefeld Middels Pfalzdorf Plaggenburg Popens Rahe Sandhorst Schirum Spekendorf Tannenhausen Walle Wallinghausen Wiesens Norden Norden 03452019 106,32 25.259 236,2 26495 Norden Bürgermeister Heiko Bargebur Postfach 528 Schmelzle Leybuchtpolder Tel.: 04931/923-0 Neuwesteel Fax: 04931/923-456 Norddeich [email protected] Ostermarsch www.norden.de Süderneuland I Süderneuland II Tidofeld Westermarsch I Westermarsch II Norderney 03452020 26,29 6.057 225,8 26537 Norderney Bürgermeister Frank Postfach 1565 Ulrichs Tel.: 04932/920-0 Fax: 04932/920-222 [email protected] Wiesmoor Marcardsmoor 03452025 82,96 13.112 156,8 26633 Wiesmoor Bürgermeister Voßbarg Hauptstraße 193 Friedrich Völler Wiesederfehn 26639 Wiesmoor Wiesmoor Tel.: 04944/305-0 Zwischenbergen Fax: 04944/305-250 04944/305-147 [email protected] 2. Gemeinden Baltrum 03452002 6,5 623 93,9 26574 Baltrum Bürgermeister Postfach 1355 Berthold Tuitjer Tel.: 04939/80-0 Fax: 04939/80-27 [email protected] www.baltrum.de Dornum Dornum 03452027 76,78 4.636 60,4 26553 Dornum Bürgermeister Michael Roggenstede Schatthauser Str. -

Über Menschen
Über Menschen, Kultur, Geschichte und Tradition Medienzentrum Norden Das Medienzentrum Norden besitzt ein umfangreiches Bildarchiv mit Fotogra en aus dem Altkreis Norden und Ostfriesland (ab ca. 1920). Auf www.medienzentrum-norden.de unter dem Menüpunkt „Bildarchiv“ können Sie unsere Bilder abrufen und mit Hilfe der Schlagwortsuche schnell die gewünschten Motive nden. Die Bilder können auch käu ich erworben werden, sofern diese der privaten Nutzung unterliegen. Mit Bildern aus dem Archiv wird jährlich der Kalender „Norder Stadtansichten“ herausgebracht. Medienzentrum Norden Ö nungszeiten Gartenstraße 1 Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00 26506 Norden Freitag: 7:30 - 12:30 Tel.: (0 49 41) 16 41 50 Fax (0 49 41) 16 41 59 [email protected] www.medienzentrum-norden.de www.facebook.com/mznorden Ö nungszeiten Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00 Freitag: 7:30 - 12:30 Ab1949 Der Bau des Störtebekerdeiches „Die Arbeiten zur Scha ung eines • Produktionsjahr: 1949 4000 Morgen großen Polders in der • Laufzeit: 18 Minuten (s/w) Leybucht sind im Gange, In einigen • Preis: 10 Euro Jahren wird der Deich fertig sein und damit fruchtbares Marschland für die Besiedelung zur Verfügung stehen...“ So steht es in einem Flug- blatt des damaligen Domänen-, Bau- und Rentamtes Norden (heute NLWKN) aus dem Jahre 1947. Der Störtebekerdeich zwischen Neuwesteel und Greetsiel war der Schlüssel zur Gewinnung des neuen Polders an der ostfriesischen Nordeseeküste. Ein Mitarbeiter der Firma Holzmann aus Frankfurt hat diesen Bau mit einer 16mm-Kamera dokumentiert. Das Medienzentrum Norden hat diesen Film bearbei- tet und digitalisiert, ein Dokument ostfriesischer Deichbauarbeit in den Nachkriegsjahren... 700 Jahr-Feier der Stadt Norden Die geschichtliche und politische • Produktionsjahr: 1955 (2007) Entwicklung Nordens wird auf das • Laufzeit: 30 Minuten (s/w) Jahr 1255 zurückgeführt, in dem Stumm lm die Gründung der Stadt Norden • Preis: 10 Euro stattgefunden haben soll. -

Gemeindeverzeichnis Stand 30.09.2020
Gemeindeverzeichnis Herausgeber: Landkreis Aurich, Kommunalaufsicht der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich Telefon 04941 16-1011, Fax 04941 16-1096 Einwohnerzahlen Stand: 30.09.2020 e-mail:[email protected] aktualisiert 12/2020 http://www.landkreis-aurich.de/fileadmin/civserv/3452/forms/gemeindeverzeichnis_07_08.pdf Stadt/Gemeinde/ Mitgliedsgemeinden/ Gemeinde- Fläche Ein- Einwohner Hauptverwaltungs- Postanschrift, Telefon/Fax Bürgermeister/in Samtgemeinde Ortsteile schlüssel km² wohner pro km² beamtin/er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Städte Ortsteile Aurich Aurich 03452001 197,29 42.296 211,8 26587 Aurich Bürgermeister Brockzetel Postfach 1769 Horst Feddermann Dietrichsfeld Tel.: 04941/12-0 Egels Fax: 04941/12-1150 Extum [email protected] Georgsfeld www.aurich.de Haxtum Kirchdorf Langefeld Middels Pfalzdorf Plaggenburg Popens Rahe Sandhorst Schirum Spekendorf Tannenhausen Walle Wallinghausen Wiesens Norden Norden 03452019 106,32 24.773 237,0 26495 Norden Bürgermeister Bargebur Postfach 528 Heiko Schmelzle Leybuchtpolder Tel.: 04931/923-0 Neuwesteel Fax: 04931/923-456 Norddeich [email protected] Ostermarsch www.norden.de Süderneuland I Süderneuland II Tidofeld Westermarsch I Westermarsch II Norderney 03452020 26,29 6.148 227,3 26537 Norderney Bürgermeister Postfach 1565 Frank Ulrichs Tel.: 04932/920-0 Fax: 04932/920-222 [email protected] Wiesmoor Marcardsmoor 03452025 82,96 13.307 158,1 26633 Wiesmoor Bürgermeister Voßbarg Hauptstraße 193 Friedrich Völler Wiesederfehn 26639 Wiesmoor Wiesmoor Tel.: 04944/305-0 Zwischenbergen Fax: 04944/305-250 04944/305-147 [email protected] 2. Gemeinden Baltrum 03452002 6,5 639 90,9 26574 Baltrum Bürgermeister Postfach 1355 Harm Olchers Tel.: 04939/80-0 Fax: 04939/80-27 [email protected] www.baltrum.de Dornum Dornum 03452027 76,78 4.438 59,9 26553 Dornum Bürgermeister Roggenstede Schatthauser Str. -

4.4-2 Lower Saxony WS Region.Pdf
chapter4.4_Neu.qxd 08.10.2001 16:11 Uhr Seite 195 Chapter 4.4 The Lower Saxony Wadden Sea Region 195 near Sengwarden have remained fully intact. The With the exception of the northern section’s water tower on „Landeswarfen“ west of tourist visitors, the Voslapper Groden mainly Hohenkirchen is a landmark visible from a great serves as a sea rampart for Wilhelmshaven’s distance, constructed by Fritz Höger in 1936 to commercial buildings, a function also served by serve as Wangerooge’s water supply. the Rüstersieler Groden (1960-63) and the Hep- Of the above-mentioned scattered settlements penser Groden, first laid out as a dyke line from characteristic to this region, two set themselves 1936-38, although construction only started in physically apart and therefore represent limited 1955. It remains to be seen whether the histori- forms within this landscape. cally preserved parishes of Sengwarden and Fed- Some sections of the old dyke ring whose land derwarden, now already part of Wilhelmshaven, was considered dispensable from a farming or will come to terms with the consequences of this land ownership perspective served as building and the inexorable urban growth through appro- space for erecting small homes of farm labourers priate planning. and artisans who otherwise made their homes in The cultural landscape of the Wangerland and small numbers on larger mounds. Among these the Jeverland has been able to preserve its were the „small houses“ referred to in oral tradi- unmistakable character to a considerable degree. tion north of Middoge, the Oesterdeich (an early The genesis of landscape forms is mirrored in the groden dyke), the Medernser Altendeich, the patterns of settlement, the lay of arable land and Norderaltendeich and foremost the area west of in landmark monuments. -
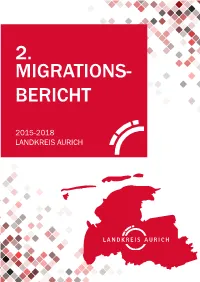
Migrations- Bericht 2
2. MIGRATIONS- BERICHT 2015-2018 LANDKREIS AURICH 2. MIGRATIONSBERICHT | 2015-2018 | LANDKREIS AURICH INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Landrat ...................................................................................................................... 4 BEVÖLKERUNG ..................................................................................................... 5-26 Einwohnerzahl und anteilige Ausländer/innenzahl in den Gemeinden ......................................................................................... 5 Entwicklung der Gesamtzahl der im Landkreis Aurich aufhältigen Ausländer/innen 2015 bis 2017....................................... 9 Aufhältige Ausländer/innen nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht im Landkreis Aurich .................................................... 10 Ausländer/innen nach Aufenthaltsstatus, Entwicklung von 2015 bis 2017 .................................................................... 12 Leistungsberechtige Ausländer/innen nach Asylbewerberleistungsgesetz von 2015 bis 2017 ......................................... 16 Ausländische und deutsche Staatsangehörige in den Ortsteilen der Stadt Aurich ............................................................... 18 Ausländische und deutsche Staatsangehörige in den Ortsteilen der Stadt Norden ............................................................. 22 Unbegleitete Minderjährige Ausländer/innen im Landkreis Aurich ..................................................................................... 26 BILDUNG UND QUALIFIZIERUNG................................................... -

Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000
Numbers and Trends 1 Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000 Overview of Numbers and Trends of Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980-2000 Recent Population Dynamics and Habitat Use of Barnacle Geese and Dark-Bellied Brent Geese in the Wadden Sea Curlews in the Wadden Sea - Effects of Shooting Protection in Denmark Shellfi sh-Eating Birds in the Wadden Sea - What can We Learn from Current Monitoring Programs? Wadden Sea Ecosystem No. 20 - 2005 2 Numbers and Trends Colophon Publisher Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, Germany; Trilateral Monitoring and Assessment Group (TMAG); Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB). Editors Jan Blew, Theenrade 2, D - 24326 Dersau; Peter Südbeck, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direktion Naturschutz, Göttingerstr. 76, D - 30453 Hannover Language Support Ivan Hill Cover photos Martin Stock, Lieuwe Dijksen Drawings Niels Knudsen Lay-out Common Wadden Sea Secreatariat Print Druckerei Plakativ, Kirchhatten, +49(0)4482-97440 Paper Cyclus – 100% Recycling Paper Number of copies 1800 Published 2005 ISSN 0946-896X This publication should be cited as: Blew, J. and Südbeck, P. (Eds.) 2005. Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1980 – 2000. Wadden Sea Ecosystem No. 20. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany. Wadden Sea Ecosystem No. 20 - 2005 Numbers and Trends 3 Editorial Foreword We are very pleased to present the results of The present report entails four contributions. the twenty-year period 1980 - 2000 of the Joint In the fi rst and main one, the JMMB gives an Monitoring on Migratory Birds in the Wadden Sea overview of numbers and trends 1980 - 2000 for (JMMB), which is carried out in the framework of all 34 species of the JMMB-program. -

Veränderungen in Der Niedersächsischen Vogelwelt Im 20
Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 35: 1-18 (2003) 1 Veränderungen in der niedersächsischen Vogelwelt im 20. Jahrhundert Herwig Zang ZANG , H. (2003): Veränderungen in der niedersächsischen Vogelwelt im 20. Jahrhundert. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 35: 1-18. In Niedersachsen sind von 1901–2000 17 Brutvogelarten verschwunden, 28 haben sich neu oder wieder angesiedelt, insgesamt gab es 2000 197 regelmäßig brütende Arten. Als Beispiele für die Dynamik und die unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Lebensräumen werden 74 Vogelarten mehr oder weniger kurz vorgestellt. Dabei überwiegen negative Bilanzen bei Niedermooren und Feuchtgrünland, Hochmooren, Bächen und Flüssen, Heiden und Ackergebieten, positive bei Stillgewässern, Küste, Wäldern und Siedlungen. Von den negativen Entwicklungen sind vor allem Limikolen, Hühnervögel und Langstreckenzieher betroffen, von den positiven Enten, Möwen und Standvögel (einschließlich der Kurzstreckenzieher). H. Z., Oberer Triftweg 31A, 38640 Goslar, [email protected] Einleitung Lebensraumes dieser Art, ursprünglich aus - schließlich Binnen landbrüter, hat sie seit den Die Festveranstaltung zum 30-jährigen Beste - 1930er Jahren zunächst nur vereinzelt, seit den hen der Niedersächsischen Ornithologischen 1950er Jahren zunehmend die Küste und die Vereinigung e.V. (NOV) in Hannover am 31. Inseln besiedelt ( ZANG 1991, Z ANG et al . 1991). August 2002 zu Beginn eines neuen Jahrhun - Nur für wenige Arten wie z. B. den Weiß storch derts war der Anlass, nach dem Festvortrag zur liegen langfristige Datenreihen etwa von 1900– „Situation der mitteleuropäischen Vogelwelt“ 2000 vor, vielfach beginnen Zählungen erst in (GLUTZ V. B LOTZHEIM 2002) auch auf die Verän - den 1950er Jahren, für viele Arten fehlen sie derungen der Brutvogelwelt in Niedersachsen ganz. Auf ihre Entwicklung kann nur indirekt während des vergangenen 20. -

Our National Park Disturbing It
Dear Visitor, welcome to the Unique throughout the world Wadden Sea National Park in Lower Irreplaceable throughout the World Saxony! The Wadden Sea habitat, on the German North Sea coast, is You‘ll get to know a landscape which is unique in the entire unmatched anywhere else in the world. The following factors world and is therefore defi nitely worth protecting. This is also combine here to form a unique and very special place. the reason why the Dutch and German parts of the Wadden Sea were inscribed on UNESCO‘s World Heritage List in 2009. The seabed slopes gradually and is only up to 10 metres deep. Here are some useful hints to enable you to experience and enjoy its special environment. At the same time we will explain Sediments are carried here from rivers which fl ow into the how you can contribute to the conservation of the park. Wadden Sea and form deposits in quiet waters. This leafl et will tell you about: At a tidal range beyond 1.7 metres the tidal current is strong enough to deposit material from the sea. The diff erent conservation zones The dunes and sandbanks which were formed from deposited sand act as natural breakwater. The importance of the Wadden Sea The temperate climate causes the open character of the tidal The visitor Information Centres Harbour Seal landscape (under the same conditions that mangrove woods can be found in the tropics). We wish you an unforgettable stay! What is a National Park? Further information is available at the visitor information cen- tres, the National Park Authority, the many tourist information In a National Park the aim is to leave nature to itself to the agencies as well as online at: greatest possible extent and be preferably unaff ected by humans. -

Anschriften Der Vereine Aus Dem Kreisklootschießerverband Norden E.V
Anschriften der Vereine aus dem Kreisklootschießerverband Norden e.V. Stand: 23. September 2012 Freesenkraft Berumbur e.V. Kontaktdaten: E-Mail: [email protected] 1. Vorsitzender: Alfred Aakmann Am Berumerfehnkanal 24 26532 Westermoordorf 04936-2408 Boßelwart: Manfred Brüning Holzdorfer Str. 32a 26524 Berumbur 04936-8481 Frauenwart: Elisabeth Krey Hauptstr. 36 26524 Berumbur 04936-6526 Jugendwart: Alfred Aakmann Am Berumerfehnkanal 24 26532 Westermoordorf 04936-2408 Paßangelegenheiten: Bonno Feldmann Evers Land 14 26524 Berumbur 04936-6407 Wurfstrecke: Alle Mannschaften: Abwurf Kreuzung Holzdorfer Str./Hauptstr. Vereinslokal: Vereinshaus Holzdorfer Str. 12: Telefon und Fax: 04936-1525 Boßelergebnisse: Sonnabends: 04936-6526 (Elisabeth Krey) Sonntags: 04936-8481 (Manfred Brüning) Stand: Juni 2011 Frisia Berumerfehn e.V. Kontaktdaten: E-Mail: [email protected] Fax: 04936-9169902 1. Vorsitzender: Bernd Meyer Poststr. 26a 26532 W-moordorf 04936-8149 Boßelangelegenheiten: Johann Bünting Mühlenweg 11a 26532 W-moordorf 04936-7763 Frauenwart: Silvia Asche Kurzer Weg 8a 26532 W-moordorf 04936-2352 Jugendwart: Gerold Hinrichs Westerwieke 26 26532 Berumerfehn 04936-7112 Paßangelegenheiten: Bernd Dettmers Waldweg 3a 26532 Westermoordorf 04936-916929 Wurfstrecke: ab Vereinsheim K 203 Westermoordorf in Richtung Leezdorf bzw.Halbemond Jugend in Richtung Berumbur K 206 / F-Jugend Brückstraße in Westermoordorf Vereinslokal: Vereinsheim, 04936-1790 Boßelergebnisse: Johann Bünting Sonnabends: 04936-7763 Sonntags: 04936-7763 Stand: Sep. 2012 -

Liebe Norderinnen Und Norder
A usgabe 2 ORDER September 2007 Ausgabe 2 September 2007 OTIZEN %◊œÿ¤÷ ›“ÿ◊Œ◊ ÕŒ¤ *ÿ¤ÕŒ¤ /,B Haben Sie Fragen, Vorschläge oder Ideen zur Politik der Norder SPD ? Liebe Norderinnen und Norder, Wenden Sie sich direkt an einen der vier Norder Ortsvereine oder an den ORDER seit 1993 präsentieren sich alle zwei Jahre Handel, Hand- Stadtverband. Sie können sich direkt an folgende Ansprechpartner wenden: OT IZ EN werk und Dienstleistungsunternehmen auf der Norder Ge- • Vorsitzender Stadtverband Norden werbeschau „Fleisch und Knolle“. Zum achten Mal öffnet Hans Forster, Kirchstraße 44, 26506 Norden, Tel.: 16 80 28 eine Ausstellung ihre Pforten, die ein deutliches Zeichen für das Engagement zur weiteren wirtschaftlichen Ent- • Vorsitzende Ortsverein Norden wicklung unserer Region ist. Den Organisatoren gilt unsere Bettina Behnke, Baumstraße 3, 26506 Norden, Tel.: 16 72 5 Anerkennung für ihre ehrenamtlich geleistete Mühe. Sie tragen mit dazu bei, Nordens Position als Mittelzentrum zu • Vorsitzende Ortsverein Süderneuland Barbara Kleen, Am Diekschloot 34, 26506 Norden, Tel.: 35 78 stärken. • Vorsitzende Ortsverein Norddeich Die Norder SPD ist deshalb stolz darauf, auch in diesem Dorothea van Gerpen, Norddeicher Str. 105, 26506 Norden, Tel.: 33 11 Jahr mit einem eigenen Stand auf der Gewerbeschau vertreten zu sein. Wir wollen die drei Tage vom 7. bis zum • Vorsitzender Ortsverein Westermarsch/Leybucht 9. September nutzen, um mit Ihnen ins Gespräch zu Gerd Zitting, Langhauser Weg 4, 26506 Norden, Tel.: 97 17 88 kommen. Wir sind sehr an Ihren Meinungen, Vorschlägen Kennen Sie schon den Wackel-Wulff ? Hans Forster und Ideen zu allen politischen Fragen interessiert. Wir Stadtverbands- freuen uns auf Ihren Besuch. -

History and Heritage of German Coastal Engineering
HISTORY AND HERITAGE OF GERMAN COASTAL ENGINEERING Hanz D. Niemeyer, Hartmut Eiben, Hans Rohde Reprint from: Copyright, American Society of Civil Engineers HISTORY AND HERITAGE OF GERMAN COASTAL ENGINEERING Hanz D. Niemeyer1, Hartmut Eiben2, Hans Rohde3 ABSTRACT: Coastal engineering in Germany has a long tradition basing on elementary requirements of coastal inhabitants for survival, safety of goods and earning of living. Initial purely empirical gained knowledge evolved into a system providing a technical and scientific basis for engineering measures. In respect of distinct geographical boundary conditions, coastal engineering at the North and the Baltic Sea coasts developed a fairly autonomous behavior as well in coastal protection and waterway and harbor engineering. Emphasis in this paper has been laid on highlighting those kinds of pioneering in German coastal engineering which delivered a basis that is still valuable for present work. INTRODUCTION The Roman historian Pliny visited the German North Sea coast in the middle of the first century A. D. He reported about a landscape being flooded twice within 24 hours which could be as well part of the sea as of the land. He was concerned about the inhabitants living on earth hills adjusted to the flood level by experience. Pliny must have visited this area after a severe storm surge during tides with a still remarkable set-up [WOEBCKEN 1924]. This is the first known document of human constructions called ‘Warft’ in Frisian (Fig. 1). If the coastal areas are flooded due to a storm surge, these hills remained Figure 1. Scheme of a ‘warft’ with a single building and its adaptions to higher storm surge levels between 300 and 1100 A.D.; adapted from KRÜGER [1938] 1) Coastal Research Station of the Lower Saxonian Central State Board for Ecology, Fledderweg 25, 26506 Norddeich / East Frisia, Germany, email: [email protected] 2) State Ministry for Food, Agriculture and Forests of Schleswig-Holstein. -

Gemeindeverzeichnis 31.12.2012
Gemeindeverzeichnis Herausgeber: Landkreis Aurich, Kommunalaufsicht der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich Telefon 04941 16-1011, Fax 04941 16-1096 Einwohnerzahlen Stand: 31.12.2012 e-mail:[email protected] aktualisiert: 10/2013 http://www.landkreis-aurich.de/fileadmin/civserv/3452/forms/gemeindeverzeichnis_07_08.pdf Stadt/Gemeinde/ Mitgliedsgemeinden/ Gemeinde- Fläche Ein- Einwohner Hauptverwaltungs- Postanschrift, Telefon/Fax Bürgermeister/in Samtgemeinde Ortsteile schlüssel km²km²km² wohner pro km² beamtin/er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Städte Ortsteile Aurich Aurich 03452001 197,22 40.604 205,9 26587 Aurich Bürgermeister Heinz-Werner Brockzetel Postfach 1769 Windhorst Dietrichsfeld Tel.: 04941/12-0 Egels Fax: 04941/12-1517 Extum [email protected] Georgsfeld www.aurich.de Haxtum Kirchdorf Langefeld Middels Pfalzdorf Plaggenburg Popens Rahe Sandhorst Schirum Spekendorf Tannenhausen Walle Wallinghausen Wiesens NordenNordenNorden Norden 03452019 106,32 24.873 233,9 26495 Norden Bürgermeisterin Barbara Bargebur Postfach 528 Schlag Leybuchtpolder Tel.: 04931/923-0 Neuwesteel Fax: 04931/923-456 Norddeich [email protected] Ostermarsch www.norden.de Süderneuland I Süderneuland II Tidofeld Westermarsch I Westermarsch II Norderney 03452020 26,29 5.820 221,4 26537 Norderney Bürgermeister Frank Postfach 1565 Ulrichs Tel.: 04932/920-0 Fax: 04932/920-222 [email protected] Wiesmoor Marcardsmoor 03452025 82,96 12.790 154,226633 Wiesmoor Bürgermeister Alfred Meyer Voßbarg Hauptstraße 193 Wiesederfehn 26639 Wiesmoor Wiesmoor Tel.: 04944/305-0 Zwischenbergen Fax: 04944/305-250 04944/305-147 [email protected] 2. Gemeinden Baltrum 03452002 6,5 554 85,2 26574 Baltrum Bürgermeisterin Antje Postfach 1355 Wietjes-Paulick Tel.: 04939/80-0 Fax: 04939/80-27 [email protected] www.baltrum.de Dornum Dornum 03452027 76,78 4.467 58,226553 Dornum Bürgermeister Michael Hook Roggenstede Schatthauser Str.