Rug 1999 2-3.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
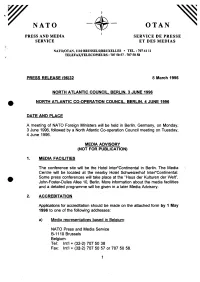
PRESS RELEASE (96)32 8 March 1996
NATO w OTAN PRESS AND MEDIA SERVICE DE PRESSE SERVICE ET DES MEDIAS NATO/OTAN, 1110 BRUSSELS/BRUXELLES • TEL. : 70741 11 TELEFAX/TELECOPIEURS : 707 50 57 - 707 50 58 PRESS RELEASE (96)32 8 March 1996 NORTH ATLANTIC COUNCIL. BERLIN. 3 JUNE 1996 NORTH ATLANTIC CO-OPERATION COUNCIL. BERLIN. 4 JUNE 1996 DATE AND PLACE A meeting of NATO Foreign Ministers will be held in Berlin, Germany, on Monday, 3 June 1996, followed by a North Atlantic Co-operation Council meeting on Tuesday, 4 June 1996. MEDIA ADVISORY (NOT FOR PUBLICATION) 1. MEDIA FACILITIES The conference site will be the Hotel InterContinental in Berlin. The Media Centre will be located at the nearby Hotel Schweizerhof InterContinental. Some press conferences will take place at the “Haus der Kulturen der Welt”, John-Foster-Dulles Allee 10, Berlin. More information about the media facilities and a detailed programme will be given in a later Media Advisory. 2. ACCREDITATION Applications for accreditation should be made on the attached form by 1 May 1996 to one of the following addresses: a) Media representatives based in Belgium: NATO Press and Media Service B-1110 Brussels Belgium Tel: Int’l + (32-2) 707 50 38 Fax: Int’l + (32-2) 707 50 57 or 707 50 58. 1 ') b) All other media representatives: Ministry of Foreign Affairs Spokesman’s Office (Pressereferat) Attn.: Mrs. Klein/Mrs. Kuhn . P.O. Box 1148 D-53OO1 Bonn Germany Tel: Int’l + (49-228) 17 20 99 or 17 22 20 Fax: Int’l + (49-228) 17 32 45 3. PASS COLLECTION AND SECURITY CHECK Passes can be collected from 10:00 hours on Friday, 31 May 1996, at the Media Centre’s accreditation desk on presentation of a valid press card and photographic proof of identity. -

Und Audiovisuellen Archive As
International Association of Sound and Audiovisual Archives Internationale Vereinigung der Schall- und audiovisuellen Archive Association Internationale d'Archives Sonores et Audiovisuelles (I,_ '._ • e e_ • D iasa journal • Journal of the International Association of Sound and Audiovisual Archives IASA • Organie de I' Association Internationale d'Archives Sonores et Audiovisuelle IASA • Zeitschchrift der Internationalen Vereinigung der Schall- und Audiovisuellen Archive IASA Editor: Chris Clark,The British Library National Sound Archive, 96 Euston Road, London NW I 2DB, UK. Fax 44 (0)20 7412 7413, e-mail [email protected] The IASA Journal is published twice a year and is sent to all members of IASA. Applications for membership of IASA should be sent to the Secretary General (see list of officers below). The annual dues are 25GBP for individual members and IOOGBP for institutional members. Back copies of the IASA Journal from 1971 are available on application. Subscriptions to the current year's issues of the IASA Journal are also available to non-members at a cost of 35GBP I 57Euros. Le IASA Journal est publie deux fois I'an etdistribue a tous les membres. Veuillez envoyer vos demandes d'adhesion au secretaire dont vous trouverez I'adresse ci-dessous. Les cotisations annuelles sont en ce moment de 25GBP pour les membres individuels et 100GBP pour les membres institutionels. Les numeros precedentes (a partir de 1971) du IASA Journal sont disponibles sur demande. Ceux qui ne sont pas membres de I'Association peuvent obtenir un abonnement du IASA Journal pour I'annee courante au coOt de 35GBP I 57 Euro. -

Gewinnspiele Im Radio Ruben Rosa
BACHELORARBEIT Herr Ruben Jörg Christoph Rosa Gewinnspiele im Radio Eine vergleichende Analyse des öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Rundfunks 2017 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Gewinnspiele im Radio Eine vergleichende Analyse des öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Rundfunks Autor: Herr Ruben Jörg Christoph Rosa Studiengang: Angewandte Medien Seminargruppe: AM14wK5-B Erstprüfer: Prof. Hermann Mayer Zweitprüfer: Vanessa Neumann Einreichung: Frankfurt am Main, 24. Juni 2017 Faculty of Media BACHELOR THESIS Prize competition in radio A comparative analysis between public service and private radio broadcasting author: Mr. Ruben Jörg Christoph Rosa course of studies: Applied Media seminar group: AM14wK5-B first examiner: Prof. Hermann Mayer second examiner: Vanessa Neumann submission: Frankfurt am Main, the 24th of June 2017 Bibliografische Angaben Rosa, Ruben Jörg Christoph Gewinnspiele im Radio Eine vergleichende Analyse des öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Rundfunks Prize competition in radio A comparative analysis between public service and private radio broadcasting 50 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2017 Abstract Ziel dieser Arbeit ist es, das Themenfeld Gewinnspiele im Radio aus ausgewählten Perspektiven näher zu betrachten. Dazu wird zunächst aufgezeigt, welche Besonderheiten privatwirtschaftlichem und öffentlich- rechtlichem Rundfunk zu Grunde liegen und worin dabei markante Unterschiede bezüglich der Gestaltung und Umsetzung -

Press, Radio and Television in the Federal Republic of Germany
DOCUMENT RESUME ED 353 617 CS 508 041 AUTHOR Hellack, Georg TITLE Press, Radio and Television in the Federal Republic of Germany. Sonderdienst Special Topic SO 11-1992. INSTITUTION Inter Nationes, Bonn (West Germany). PUB DATE 92 NOTE 52p.; Translated by Brangwyn Jones. PUB TYPE Reports Evaluative/Feasibility (142) EDRS PRICE MF01/PC03 Plus Postage. DESCRIPTORS Developing Nations; Foreign Countries; Freedom of Speech; *Mass Media; *Mass Media Effects; *Mass Media Role; Media Research; Professional Training; Technological Advancement IDENTIFIERS *Germany; Historical Background; Journalists; Market Analysis; Media Government Relationship; Media Ownership; Third World; *West Germany ABSTRACT Citing statistics that show that its citizens are well catered for by the mass media, this paper answers questions concerning the media landscape in the Federal Republic of Germany. The paper discusses: (1) Structure and framework conditions of the German media (a historical review of the mass media since 1945); (2) Press (including its particular reliance on local news and the creation of the world status media group, Bertelsmann AG);(3) News agencies and public relations work (which insure a "never-ending stream" of information);(4) Radio and Television (with emphasis on the Federal Republic's surprisingly large number of radio stations--public, commercial, and "guest");(5) New communication paths and media (especially communication and broadcasting satellites and cable in wideband-channel networks);(6) The profession of journalist (which still relies on on-the-job training rather than university degrees); and (7) Help for the media in the Third World (professional training in Germany of journalists and technical experts from underdeveloped countries appears to be the most appropriate way to promote Third World media). -

25 Jahre Deutsche Einheit – Fernsehnutzung in Ost Und West 455 | Media Perspektiven 10/2015
453 | Media Perspektiven 10/2015 einige Kommissare der nach 1992 im Ersten Pro- Angleichungen und Unterschiede gramm der ARD weitergeführten Krimireihe Polizei- ruf 110, sowie weitere Sendereihen, Moderatoren und Darsteller, die von den neugegründeten Dritten 25 Jahre Deutsche Programmen der ARD oder auch anderen Sendern Einheit – Fernsehnutzung übernommen wurden (z. B. „Außenseiter Spitzen- reiter“, „Umschau“, „Defa Märchen“, als Modera- in Ost und West toren und Darsteller Carmen Nebel oder Wolfgang Von Gerlinde Frey-Vor* und Inge Mohr** Lippert, Wolfgang Stumpf, Andreas Schmidt- Schaller, Wilfried Glatzeder u.a.). Mit der Nutzung und Rezeption von medialen Angeboten im Transformationsprozess beschäftig- Die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990 te sich 1994/1995 eine erste Schwerpunktstudie gilt – wie auch die politische und gesellschaftliche der ARD/ZDF-Medienkommission, die sogenannte Transformation unserer osteuropäischen Nachbar- Ost-Studie. Die Studie suchte nach Gründen für die staaten – inzwischen als einer der großen gesell- abweichende Fernsehnutzung in den neuen Bun- schaftspolitischen Umbrüche der jüngeren Ge- desländern und stellte unterschiedliche Bedürfnis- schichte. Die Vereinigung der Menschen, die mehr lagen fest. (3) als 40 Jahre in getrennten Staatssystemen lebten, wurde durch den offiziellen Akt der politischen In den Folgejahren wurde in mehreren Studien das 1990er Jahre: Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 jedoch nicht Nutzungs- und Rezeptionsverhalten in den neuen Ostdeutsche sehen vollendet. Sie ist vielmehr Teil eines andauernden Bundesländern untersucht und mit dem in den anders fern als Transformationsprozesses. Dieser Prozess betrifft alten Bundesländern verglichen. (4) Der Hauptfokus Westdeutsche die Menschen beider deutscher Teilstaaten. Für die lag dabei – wie schon bei der Ost-Studie von 1994/ Ostdeutschen hat er jedoch über lange Jahre mehr 1995 – auf dem Fernsehen. -

1965-01-12.Pdf
r/////////////////////////////////(/////////////////~ ~ · . · ~ · TOP SECRET ¥. · ~ ~ 1'\PPROVED FOR ~ ~: RELEASE- AR :;1"~ /. 70-14 - ,~ ~ HISTORICAL ,~ · .r. COLLECTION :;1"~ /_ DIVISION - :;1"~ - ~ DATE: 06-17-2013 ~ ~ ~ . ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ THIS DOCUMENT CONTAINS CODE WORD MATERIAL ~ .,..~- %· WARNING ~ ~ This document contains classified information affecting the national ·% security of the United States within the meaning of the espionage "~ laws, US Code, Title 18, Sections 793, 794, and 798. The law prohibits ~ its transmission or the revelation of its contents in any manner to .r~ an unauthorized person, as well as its use in any manner prejudicial % to the safety or interest of the United States or for the benefit of any ~ ;:~::~:~::::t :~:: d::i:::: o:~h~:n~:~:~::~IONS ~ ~ INTELLIGENCE CHANNELS AT ALL TIMES ~ "~ It is to be seen only by US personnel especially indoctrinated 1"/ ~ and authorized to receive COMMUNICATIONS INTELLIGENCE /"/ ~ information; its security must be maintained in accordance with /"/ % COMMUNICATIONS INTELLIGENCE REGULATIONS. 0 ~ No action is to be taken on any COMMUNICATIONS INTELLI- 0 .r~ GENCE which may be contained herein, regardless of the advantages I"/ % to be gained, unless such action is first approved by the Director 0 ~ of Central Intelligence. 0 ~ 0 ~ TOP SECRET 0 ~//////////////////////////////////////////////////.M SECRET · ·\~jt:dt. ~ - ~ )·; V /tt 1 Ap~ed For Yo epORE~'\40~'f%s§~-RDMT00472A0~0001 0002-~ OCI No. 0521/65 Copy No. 2S 12 January 1965 A Chronology of Reports Concerning the Berlin Situation (Received During the Week Ending at 1200 EST 12 January 1965) This is a working paper prepared in the 25X1A EE Division, Sino-Soviet Bloc Area, Office of Current Intelligence, CIA Prepared by Ext 7441 State, DIA, Army, JCS declassification & release instructions on file , SECRET , , App,_d For ~~a~:ftl<ft:i\\191~ s§t!MRDPMT00472A00120001 0002-6 28 Dec Moscow beamed to the UK an English language commentary reiterating the Soviet UN proposal for a nonaggression pact between NATO and Pact countries. -

Medienvermittelte Transnationale ¨Offentlichkeiten Im Zeitalter Praktischer Hybridisierung
Medienvermittelte transnationale Offentlichkeiten¨ im Zeitalter praktischer Hybridisierung von Aneta Podkalicka1 und Thomas Petzold2 Summary This article is concerned with the repercussions of social change on transnational media. It offers a new understanding of multilin- gual programming strategies by examining “Radio MultiKulti” (RM), a public service radio station discontinued from 1/1/2009 by Rund- funk Berlin-Brandenburg. In its 14 years of existence, “RM” had to implement a well-intended and politically-motivated logic of “mul- tiethnic, intercultural service station”. However, as we demonstrate, such a direction, despite some achievements, has resulted in the con- straints to “RM”’s journalistic activities and language policy, drawing criticism for the station’s economic viability. This paper proposes that multilingual media services are to be framed by the concept of practical hybridity that allows a necessary responsiveness towards an ever-changing media environment, at the moment within digital cul- ture. Our appoach draws on Mikhail Bakhtin’s and Yuri Lotman’s theories of hybridity, as well as empirical study of “RM” involving in-depth interviews from 2005 onwards conducted with “RM” staff (especially with the editor-in-chief, Ilona Marenbach) further inter- views with key agents outside “RM” and a continuous monitoring of the public debate which culminated at the end of 2008 in the controversial decision to shut down the radio station. Against this background, the concluding remarks are meant to contribute to the scholarly debate surrounding the concept of hybridization and to in- form multilingual media policy in the 21st century. Aus dem Deutschen ubersetzt¨ von Louis Marvick, Reno 1 ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, Swinburne University, Australia. -

Ambassador Auditorium Collection ARS.0043
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt3q2nf194 No online items Guide to the Ambassador Auditorium Collection ARS.0043 Finding aid prepared by Frank Ferko and Anna Hunt Graves This collection has been processed under the auspices of the Council on Library and Information Resources with generous financial support from the Andrew W. Mellon Foundation. Archive of Recorded Sound Braun Music Center 541 Lasuen Mall Stanford University Stanford, California, 94305-3076 650-723-9312 [email protected] 2011 Guide to the Ambassador Auditorium ARS.0043 1 Collection ARS.0043 Title: Ambassador Auditorium Collection Identifier/Call Number: ARS.0043 Repository: Archive of Recorded Sound, Stanford University Libraries Stanford, California 94305-3076 Physical Description: 636containers of various sizes with multiple types of print materials, photographic materials, audio and video materials, realia, posters and original art work (682.05 linear feet). Date (inclusive): 1974-1995 Abstract: The Ambassador Auditorium Collection contains the files of the various organizational departments of the Ambassador Auditorium as well as audio and video recordings. The materials cover the entire time period of April 1974 through May 1995 when the Ambassador Auditorium was fully operational as an internationally recognized concert venue. The materials in this collection cover all aspects of concert production and presentation, including documentation of the concert artists and repertoire as well as many business documents, advertising, promotion and marketing files, correspondence, inter-office memos and negotiations with booking agents. The materials are widely varied and include concert program booklets, audio and video recordings, concert season planning materials, artist publicity materials, individual event files, posters, photographs, scrapbooks and original artwork used for publicity. -

Global Media Journal German Edition
Global Media Journal German Edition Vol. 6, No. 2, Autumn/Winter 2016 URN:nbn:de:gbv:547-201600620 A Case of Asynchronous Media Change in the 1950s: How US-American TV Series Came to Early West German Television Andre Dechert1 Abstract: The influence of radio and cinema on the first television program designs in West Ger- many, and other nations, can be explained by a theory which has recently been put forward by communication scholar Gabriele Balbi. According to Balbi, in a first step new media imitate old media in manifold ways before they develop characteristics of their own and become a truly new medium. However, the 'producers' of early West German national television were not only looking to radio or cinema for clues on how to design the program of Deutsches Fernsehen (DFS), West Germany's first and only national television channel from 1954 to 1961/63. DFS' executives and executive employees were also looking to other nations, particularly to those – like the United States – that were years ahead in television's evolution. Especially the implementation of the enter- tainment series in West German television is strongly rooted in visits to the United States and new- ly gathered information and impressions. To exemplify this argument, I delve into examples which demonstrate that West German television executives and executive employees were either creating television series on the basis of US-American television series or were broadcasting the latter after synchronization. In this context, major findings of diffusion research constitute a useful addition to current theories on media change. Keywords: media change, television history, TV series, USA, West Germany, diffusion theory Introduction “You can only approach television, if you understand its people, the inhabitants of the U.S.A.” (Haensel, 1952, p. -

Television and the Cold War in the German Democratic Republic
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages Envisioning Socialism Revised Pages Revised Pages Envisioning Socialism Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The University of Michigan Press Ann Arbor Revised Pages Copyright © by Heather L. Gumbert 2014 All rights reserved This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (be- yond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid- free paper 2017 2016 2015 2014 5 4 3 2 A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN 978– 0- 472– 11919– 6 (cloth : alk. paper) ISBN 978– 0- 472– 12002– 4 (e- book) Revised Pages For my parents Revised Pages Revised Pages Contents Acknowledgments ix Abbreviations xi Introduction 1 1 Cold War Signals: Television Technology in the GDR 14 2 Inventing Television Programming in the GDR 36 3 The Revolution Wasn’t Televised: Political Discipline Confronts Live Television in 1956 60 4 Mediating the Berlin Wall: Television in August 1961 81 5 Coercion and Consent in Television Broadcasting: The Consequences of August 1961 105 6 Reaching Consensus on Television 135 Conclusion 158 Notes 165 Bibliography 217 Index 231 Revised Pages Revised Pages Acknowledgments This work is the product of more years than I would like to admit. -

This Is the Published Version of a Chapter
http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany. Citation for the original published chapter: Hultén, G., Graf, H. (2011) Exploring media and ethnic diversity in Sweden and Germany. In: Heike Graf (ed.), Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany (pp. 23-46). Göteborg: Nordicom N.B. When citing this work, cite the original published chapter. CC BY-NC-ND 3.0 Permanent link to this version: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-7916 Exploring Media and Ethnic Diversity in Sweden and Germany Gunilla Hultén & Heike Graf The way media are organized in both Sweden and Germany falls under the category of democratic corporatist, according to Hallin and Mancini (2004). The publishing sector is an important part of the democratic corporatist model, and both countries have high levels of newspaper readership with Sweden’s being one of the highest in the world. There is a competitive market for print media, but despite this the market is – especially in Sweden – regulated by different measures such as press subsidies. The Swedish and the German media systems are also ‘duopolies’, where public service broadcasters coexist alongside commercially funded companies, with the public service broadcasters still remaining comparatively strong. Both countries also have a high level of journalistic professionalization, including the sharing of professional standards and a tradition of public-sector involvement in the media landscape (Hallin & Mancini 2004: 145). Since the beginning of the 21st century the media companies in both countries face economic constraints due to several media crises, including a structural crisis (new possibilities within Internet communication), a cyclical crisis, that is, a downturn in advertising revenue (Weischenberg et al. -

Downloaded from Brill.Com09/30/2021 03:47:12PM Via Free Access of That Period Was Dominated by Magazine-Type Formats
Gesnerus 76/2 (2019) 172–191, DOI: 10.24894/Gesn-en.2019.76009 “Because every recipient is also a potential patient” – TV Health Programmes in the FRG and the GDR, from the 1960s to the 1980s Susanne Vollberg Abstract In the television programme of West Germany from the 1960s to the 1980s, health magazines like Gesundheitsmagazin Praxis [Practice Health Maga- zine] (produced by ZDF)1 or ARD-Ratgeber: Gesundheit [ARD Health Ad- visor] played an important role in addressing health and disease as topics of public awareness. With their health magazine Visite [Doctor’s rounds], East German television, too relied on continuous coverage and reporting in the fi eld. On the example of above magazines, this paper will examine the his- tory, design and function of health communication in magazine-type for- mats. Before the background of the changes in media policy experienced over three decades and the different media systems in the then two Germanys, it will discuss the question of whether television was able to move health rele- vant topics and issues into public consciousness. health magazine, GDR television, FRG television, Gesundheitsmagazin Praxis Health-related programmes were, right from the early days of television, part of the common TV repertoire in both German countries but it was in the health, disease and medicine, which was well-received by the audience. The- coverage of medicine and health issues in East and West German television 1 Abbreviation for Zweites Deutsches Fernsehen – Second German Television; public-service broadcaster. Apl. Prof. Dr. Susanne Vollberg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musik, Medien- und Sprechwissenschaften, Abt.