Wird Durch Die Lektorierte Fassung Ersetzt. Vorabfassung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
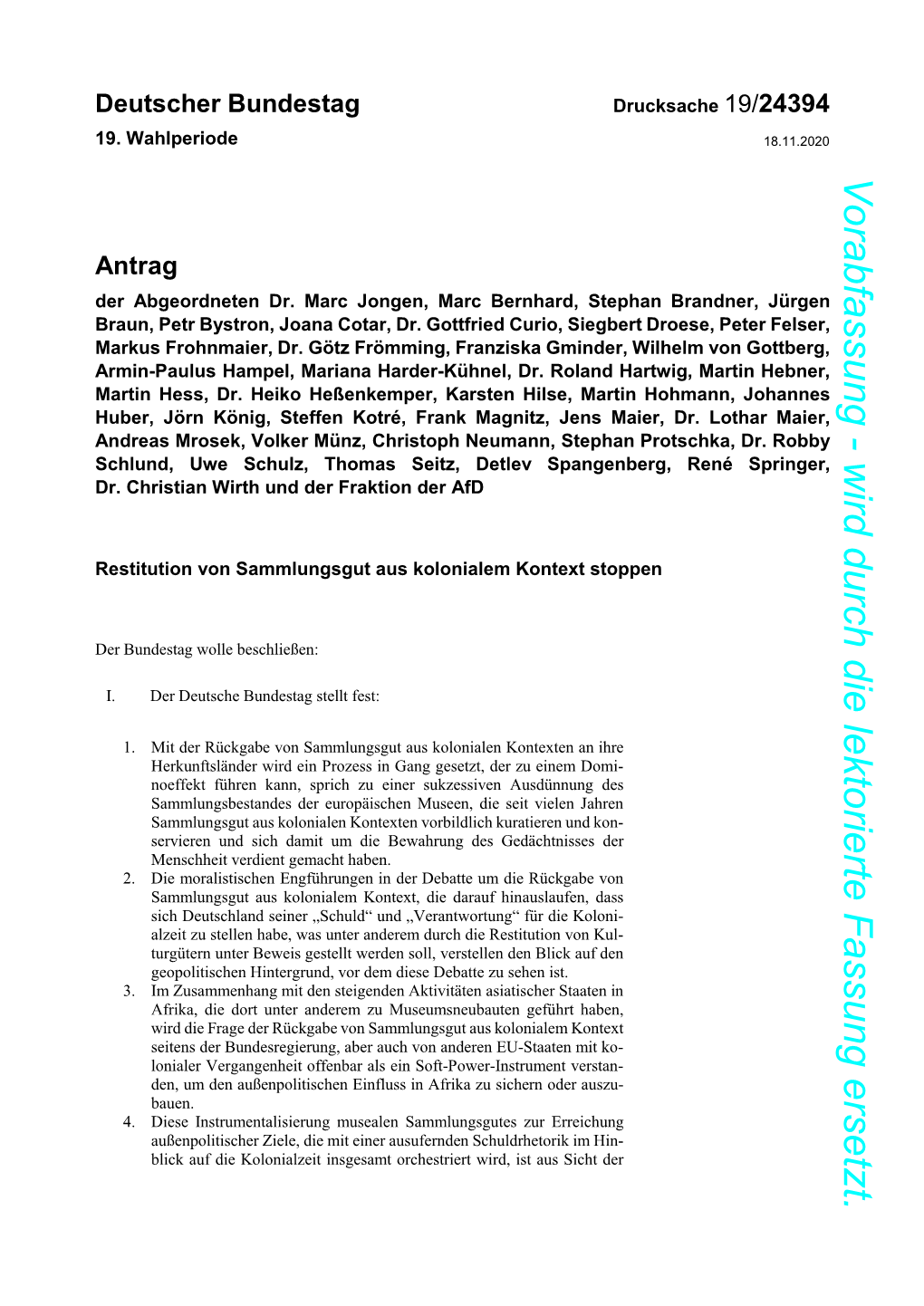
Load more
Recommended publications
-

Vorabfassung
Deutscher Bundestag Drucksache 19/7431 19. Wahlperiode 30.01.2019 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Andreas Mrosek, Dr. Dirk Spaniel, Matthias Büttner, Leif-Erik Holm, Frank Magnitz, Wolfgang Wiehle, Marc Bernhard, Jürgen Braun, Marcus Bühl, Petr Bystron, Peter Felser, Martin Hebner, Lars Herrmann, Martin Hess, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Enrico Komning, Jörn König, Dr. Birgit Malsack- Winkemann, Volker Münz, Christoph Neumann, Gerold Otten, Frank Pasemann, Jürgen Pohl, Martin Reichardt, Uwe Schulz, Thomas Seitz, Detlev Spangenberg, Dr. Harald Weyel, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD - wird Änderung der Verordnung über das Anlaufen der inneren Gewässer der Bundesrepublik Deutschland aus Seegebieten seewärts der Grenze des deutschen durch Küstenmeeres und das Auslaufen – Anlaufbedingungsverordnung Der Bundestag wolle beschließen: die I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: lektorierte Die Anlage zu § 1 Abs. 1 Anlaufbedingungsverordnung (AnlBV) be- stimmt in Nummer 6, für welche Fahrzeuge eine Verpflichtung zur Be- nutzung des Verkehrstrennungsgebietes (VTG) „German Bight Western Approach“ (Tiefwasserweg) besteht. In a) bis d) sind Tankschiffe über 5.000 BRZ bzw. 10.000 BRZ mit gefährlicher Ladung und Gastank- schiffe über 10.000 BRZ aufgeführt. Es fehlt jedoch an einer grundsätz- lichen Regelung, die Bezug auf den spezifischen Tiefgang der Schiffe nimmt. Fassung II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Nummer 6 der Anlage zu §1 Abs. 1 Anlaufbedingungsverordnung (AnlBV) um eine Nummer e) zu ergänzen. Nummer 6 e) soll lauten: „Alle Fahrzeuge mit einem Tiefgang von mehr als 10 Meter,“ ersetzt. Berlin, den 29. Januar 2019 Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion Drucksache 19/7431 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Vorabfassung Begründung Das Frachtschiff „MSC ZOE“ hat in der Nacht vom 01. -

Wird Durch Die Lektorierte Fassung Ersetzt
Deutscher Bundestag Drucksache 19/14684 19. Wahlperiode 04.11.2019 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Dr. Bruno Hollnagel, Tino Chrupalla, Dr. Michael Espendiller, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Kay Gottschalk, Prof. Dr. Heiko Heßenkemper, Leif-Erik Holm, Stefan Keuter, Enrico Komning, Steffen Kotré, Hansjörg Müller, Marc Bernhard, Petr Bystron, Siegbert Droese, Peter Felser, Markus Frohnmaier, Dr. Götz Frömming, Martin Hebner, Karsten Hilse, Jörn König, Dr. Rainer Kraft, Frank Magnitz, Andreas Mrosek, Volker Münz, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Frank Pasemann, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René - Springer, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD wird Marktwirtschaft und Subsidiarität erhalten statt Sustainable Finance durch Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: die Mit einem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums kündigte die Europäische Kommission die Förderung „nachhaltiger Finanzen“ (Sustainable Fi- lektorierte nance-Initiative) im März 2018 an. Die Initiative besteht aus drei Verordnungs- vorschlägen und einer Folgenabschätzung. Zentral ist der „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung ei- nes Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen“. Dieser passierte im März 2019 die erste Lesung im Europäischen Parlament und wurde während der rumänischen Ratspräsidentschaft verstärkt behandelt. Der Europäische Wirt- schafts- und Sozialausschuss und der Europäische Ausschuss der Regionen haben die Initiative in Gänze -

Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019
Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019 Politische und Rechtliche Entwicklungen Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Forschung Kofinanziert durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019 Politische und Rechtliche Entwicklungen Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020 Das Europäische Migrationsnetzwerk 5 Das Europäische Migrationsnetzwerk Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde Im Rahmen des EMN wird in der Regel keine Primär- im Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im forschung betrieben, sondern es werden bereits Auftrag des Europäischen Rates eingerichtet, um dem vorhandene Daten und Informationen aufbereitet Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verläss- und analysiert; nur bei Bedarf werden diese durch lichen Informationen im Migrations- und Asylbereich eigenständige Erhebung von Daten und Informationen auf europäischer Ebene nachzukommen. Seit 2008 ergänzt. bildet die Ratsentscheidung 2008/381/EG die dauer- hafte Rechtsgrundlage des EMN, und es wurden natio- EMN-Studien werden nach einheitlichen Spezifika- nale Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten der Euro- tionen erstellt, um innerhalb der Europäischen Union päischen Union (mit Ausnahme Dänemarks, welches und Norwegens vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Beobachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen. Um -

Master Thesis International Relations - European Union Studies
A FRONT ROW MULTILATERALIST On German parliamentary justifications for a more assertive defence policy Master thesis International Relations - European Union Studies By Jonathan Provoost - s1446185 Supervisor: Dr. M.E.L. David 3 July 2020 Word count: 16136 List of parliamentarians Tobias Pflüger (The Left) Nils Annen (SPD) Eckhard Pols (CDU) Franziska Brandtner (The Greens) Achim Post (SPD) Daniela De Ridder (SPD) Norbert Röttgen (CDU) Marcus Faber (CDU) Karin Stenz (CDU) Fritz Felgentreu (SPD) Thorsten Frei (CDU) List of abbreviations Ingo Gädechens (CDU) AfD Alternative for Germany Wolfgang Gehrcke (The Left) CDU Christian Democratic Union Florian Hahn (CSU) CSU Christian Social Union Heike Hänsel (The Left) CSDP Common Security and Defence Policy Jürgen Hardt (CDU) EDF European Defence Fund Mark Hauptmann (CDU) EEAS European Union External Action Service Martin Hebner (AfD) eFP Enhanced Forward Presence Wolfgang Hellmich (SPD) ESDP European Security and Defence Policy Thomas Hitschler (SPD) EU European Union Alois Karl (CSU) EUGS European Union Global Strategy Roderick Kiesewetter (CDU) FDP Free Democratic Party Günther Krichbaum (CDU) GDR German Democratic Republic Alexander Graf Lambsdorff (FDP) FRG Federal Republic of Germany Karl Lamers (CDU) NATO North Atlantic Treaty Organization Stefan Liebich (The Left) PESCO Permanent Structured Cooperation on Defence Wilfried Lorenz (CDU) QCA Qualitative Content Analysis Rüdiger Lucassen (AfD) SDP Social Democratic Party Elisabeth Motschmann (CDU) US United States (of America) Alexander Neu -

Drucksache 19/2392
Deutscher Bundestag Drucksache 19/2392 19. Wahlperiode 30.05.2018 Antrag der Abgeordneten Dr. Bernd Baumann, Marc Bernhard, Andreas Bleck, Peter Boehringer, Stephan Brandner, Jürgen Braun, Marcus Bühl, Matthias Büttner, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Dr. Gottfried Curio, Siegbert Droese, Thomas Ehrhorn, Berengar Elsner von Gronow, Dr. Michael Espendiller, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Anton Friesen, Dr. Götz Frömming, Markus Frohnmaier, Dr. Alexander Gauland, Dr. Axel Gehrke, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Wilhelm von Gottberg, Kay Gottschalk, Armin-Paulus Hampel, Mariana Harder-Kühnel, Verena Hartmann, Dr. Roland Hartwig, Jochen Haug, Martin Hebner, Udo Theodor Hemmelgarn, Waldemar Herdt, Lars Herrmann, Martin Hess, Dr. Heiko Heßenkemper, Karsten Hilse, Nicole Höchst, Martin Hohmann, Dr. Bruno Hollnagel, Leif-Erik Holm, Johannes Huber, Fabian Jacobi, Dr. Marc Jongen, Uwe Kamann, Jens Kestner, Stefan Keuter, Norbert Kleinwächter, Enrico Komning, Jörn König, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, Rüdiger Lucassen, Frank Magnitz, Jens Maier, Dr. Lothar Maier, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Corinna Miazga, Andreas Mrosek, Hansjörg Müller, Volker Münz, Sebastian Münzenmaier, Christoph Neumann, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Frank Pasemann, Tobias Matthias Peterka, Paul Viktor Podolay, Jürgen Pohl, Stephan Protschka, Martin Reichardt, Martin Erwin Renner, Roman Reusch, Ulrike Schielke-Ziesing, Dr. Robby Schlund, Jörg Schneider, Uwe Schulz, Thomas Seitz, Martin Sichert, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Beatrix von Storch, Dr. Alice Weidel, Dr. Harald Weyel, Wolfgang Wiehle, Dr. Heiko Wildberg, Dr. Christian Wirth, Uwe Witt und der Fraktion der AfD Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Asyl- und Migrationspolitik Der Bundestag wolle beschließen: A. Der Deutsche Bundestag beschließt: Es wird ein Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes eingesetzt. -

Ukraine-Analysen Nr. 220, 12.07.2019 2
NR. 220 12.07.2019 ukraine- analysen www.laender-analysen.de/ukraine AUSBLICK AUF DIE PARLAMENTSWAHLEN 2019 SOZIALPOLITIK UND SOZIALDATEN ■■VON DER REDAKTION На дачу – in die Sommerpause 2 ■■ANALYSE Die Parlamentswahlen 2019 in der Ukraine: (k)ein Sprung ins Ungewisse? 2 Von Sergej Sumlenny (Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Kiew – Ukraine) ■■UMFRAGE Sonntagsfrage und Stimmung im Land 6 ■■ANALYSE Sozialpolitik in der Ukraine: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 9 Von Oleksandra Betliy (Institute for Economic Research and Policy Consulting, Kiew) ■■GRAFIK ZUM TEXT Mindestlohn und Existenzminimum 2013 bis 2019 12 ■■STATISTIK Aktuelle Sozialdaten 13 ■■DOKUMENTATION Russland erhält Stimmrecht im Europarat zurück – Reaktionen 15 ■■CHRONIK 11. – 23. Juni 2019 17 Leibniz-Institut für Leibniz-Institut für Zentrum für Osteuropa- und Deutsche Gesellschaft für Deutsches Forschungsstelle Osteuropa Agrarentwicklung in Ost- und Südosteuropa- internationale Studien Osteuropakunde Polen-Institut an der Universität Bremen Transformationsökonomien forschung (ZOiS) gGmbH Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen UKRAINE-ANALYSEN NR. 220, 12.07.2019 2 VON DER REDAKTION На дачу – in die Sommerpause Die Ukraine-Analysen machen wie üblich eine Sommerpause. Die nächste Ausgabe – Ukraine-Analysen 221 – erscheint voraussichtlich am 10. September 2019. Sie wird sich mit dem Ausgang der Parlamentswahlen am 21. Juli befassen. Ferner sind Hefte zu Biolandwirtschaft, Korruptionsbekämpfung und Gender geplant. Vorerst wüschen wir unseren Leserinnen und Lesern einen erholsamen Sommer. Die Redaktion der Ukraine-Analysen Evgeniya Bakalova, Katharina Hinz, Eduard Klein und Matthias Neumann ANALYSE Die Parlamentswahlen 2019 in der Ukraine: (k)ein Sprung ins Ungewisse? Von Sergej Sumlenny (Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Kiew – Ukraine) Zusammenfassung Am 21. Juli 2019 finden in der Ukraine vorgezogene Parlamentswahlen statt. -

Drucksache 19/21376
Deutscher Bundestag Drucksache 19/21376 19. Wahlperiode 30.07.2020 Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 21. bis 25. Januar 2019 in Straßburg Inhaltsverzeichnis Seite I. Delegationsmitglieder ........................................................................ 2 II. Einführung ......................................................................................... 5 III. Ablauf der 1. Sitzungswoche 2019 .................................................... 6 III.1 Wahlen und Geschäftsordnungsfragen ................................................ 7 III.2 Schwerpunkte der Beratungen ............................................................. 8 III.3 Auswärtige Redner .............................................................................. 20 IV. Tagesordnung der 1. Sitzungswoche 2019 ....................................... 24 V. Verabschiedete Empfehlungen und Entschließungen .................... 29 VI. Reden deutscher Delegationsmitglieder ........................................... 69 VII. Berichterstattermandate deutscher Mitglieder ............................... 79 VIII. Funktionsträgerinnen und -träger in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ........................................................ 80 IX. Sitzung des Ständigen Ausschusses in Helsinki............................... 82 X. Mitgliedsländer des Europarates .................................................... -

Drucksache 19/14684
Deutscher Bundestag Drucksache 19/14684 19. Wahlperiode 04.11.2019 Antrag der Abgeordneten Dr. Bruno Hollnagel, Tino Chrupalla, Dr. Michael Espendiller, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Kay Gottschalk, Dr. Heiko Heßenkemper, Leif-Erik Holm, Stefan Keuter, Enrico Komning, Steffen Kotré, Hansjörg Müller, Marc Bernhard, Petr Bystron, Siegbert Droese, Peter Felser, Dr. Götz Frömming, Markus Frohnmaier, Martin Hebner, Karsten Hilse, Jörn König, Dr. Rainer Kraft, Frank Magnitz, Andreas Mrosek, Volker Münz, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Frank Pasemann, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD Marktwirtschaft und Subsidiarität erhalten statt Sustainable Finance Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Mit einem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums kündigte die Euro- päische Kommission die Förderung „nachhaltiger Finanzen“ (Sustainable Finance-Ini- tiative) im März 2018 an. Die Initiative besteht aus drei Verordnungsvorschlägen und einer Folgenabschätzung. Zentral ist der „Vorschlag für eine Verordnung des Europä- ischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichte- rung nachhaltiger Investitionen“. Dieser passierte im März 2019 die erste Lesung im Europäischen Parlament und wurde während der rumänischen Ratspräsidentschaft ver- stärkt behandelt. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Europäi- sche Ausschuss der Regionen haben die Initiative in Gänze oder in Teilbereichen kom- mentiert. Das Sustainable-Finance-Konzept -

Wird Durch Die Lektorierte Fassung Ersetzt
Deutscher Bundestag Drucksache 19/17126 19. Wahlperiode 11.02.2020 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, Jochen Haug, Beatrix von Storch, Dr. Christian Wirth, Marc Bernhard, Stephan Brandner, Marcus Bühl, Matthias Büttner, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Siegbert Droese, Thomas Ehrhorn, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Götz Frömming, Kay Gottschalk, Dr. Roland Hartwig, Martin Hebner, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Johannes Huber, Jörn König, - Steffen Kotré, Rüdiger Lucassen, Jens Maier, Andreas Mrosek, Christoph wird Neumann, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Martin Reichardt, Dr. Robby Schlund, Uwe Schulz, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Dr. Harald Weyel und der Fraktion der AfD durch Verstärktes und effektiveres Vorgehen gegen die Ausbreitung des Islamismus in Deutschland die Der Bundestag wolle beschließen: lektorierte I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 1. Es besteht eine zunehmende Gefährdungslage für die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland durch islamistische Organisati- onen, die einen religiösen Allmachtsanspruch anmelden und auf langfristige Sicht eine Abschaffung des säkularen Staates mit Gewalt oder auch auf gewaltfreiem Wege herbeiführen wollen. 2. Diese islamistischen Organisationen verfolgen eine bewusste Verschleierungs- taktik, indem sie exemplarisch jegliche Verbindungen zu international vernetzten Fassung Organisationen wie der Muslimbruderschaft vehement leugnen. Sie agieren in Deutschland äußerst -
The Petitions Committee
The Petitions Committee 2 “Since 1949, the Petitions Commit tee has been the central point of contact at the Bundestag for anyone in the Federal Republic of Germany who wishes to raise their concerns, draw attention to hardships or make suggestions. The Committee has moved with the times, offering the option to submit online and public petitions, and is responsive to public needs. Petitions received by the German Bundestag’s Petitions Committee benefit from a threefold guarantee: the Committee must accept, examine and take a decision on them. That is required by the constitution.” Marian Wendt, CDU/CSU Chairman of the Petitions Committee 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab lished at the start of each elec toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

20210421 6-Data.Pdf
Deutscher Bundestag 223. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 21. April 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite - Drs. 19/28444, 19/28692 und 19/28732 Abgegebene Stimmen insgesamt: 656 Nicht abgegebene Stimmen: 53 Ja-Stimmen: 342 Nein-Stimmen: 250 Enthaltungen: 64 Ungültige: 0 Berlin, den 21.04.2021 Beginn: 14:53 Ende: 15:27 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Maika Friemann-Jennert X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr. -

Die Abgeordneten Des 19. Deutschen Bundestages Direkt- Und Listenmandate
Die Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages Direkt- und Listenmandate CDU/CSU Schleswig-Holstein Landeslistenplätze 85 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Bernhard Daldrup, 182 Frankfurt am Main I 220 München-West/Mitte 266 Neckar-Zaber Petra Pau (DIE LINKE) Kerstin Griese, Prof. Dr. Matthias Zimmer (CDU) Stephan Pilsinger (CSU) Eberhard Gienger (CDU) 1 Flensburg – Schleswig CDU Stephan Albani, Sebastian Hartmann, Petra Nicolaisen (CDU) Dr. Maria Flachsbarth, 86 Berlin-Lichtenberg 183 Frankfurt am Main II 221 München-Land 267 Heilbronn SPD Wolfgang Hellmich, 2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Fritz Güntzler, Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) Bettina M. Wiesmann (CDU) Florian Hahn (CSU) Alexander Throm (CDU) Dr. Barbara Hendricks, Astrid Damerow (CDU) Dr. Ursula von der Leyen*, 184 Groß-Gerau 222 Rosenheim 268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Landeslistenplätze Elvan Korkmaz-Emre, AfD 3 Steinburg – Dithmarschen Süd Carsten Müller, Stefan Sauer (CDU) Daniela Ludwig (CSU) Christian Freiherr von Stetten (CDU) CDU Prof. Monika Grütters, Dietmar Nietan, Mark Helfrich (CDU) Ingrid Pahlmann** 185 Offenbach 223 Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach 269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Kai Wegner Andreas Rimkus, DIE LINKE 4 Rendsburg-Eckernförde Björn Simon (CDU) Alexander Radwan (CSU) Norbert Barthle (CDU) SPD Dr. Daniela De Ridder, SPD Cansel Kiziltepe, Udo Schiefner, Dr. Johann David Wadephul (CDU) 186 Darmstadt 224 Starnberg – Landsberg am Lech 270 Aalen – Heidenheim Kirsten Lühmann, Klaus Mindrup Ulla Schmidt, Dr. Astrid Mannes (CDU) Michael Kießling (CSU) Roderich Kiesewetter (CDU) BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 5 Kiel Caren Marks, AfD Dr. Gottfried Curio, Ursula Schulte, 1 Mathias Stein (SPD) Susanne Mittag, Dr. Götz Frömming, Martin Schulz, 187 Odenwald 225 Traunstein 271 Karlsruhe-Stadt 6 Plön – Neumünster Markus Paschke**, Dr.