Heuschrecken & Wanzen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Catalogue of the Type Specimens Deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic*
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 30.iv.2014 Volume 54(1), pp. 399–450 ISSN 0374-1036 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:7479D174-4F1D-4465-9EEA-2BBB5E1FC2A2 Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic* Polyneoptera Lenka MACHÁýKOVÁ & Martin FIKÁýEK Department of Entomology, National Museum in Prague, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4-Kunratice, Czech Republic & Department of Zoology, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, Viniþná 7, CZ-128 43, Praha 2, Czech Republic; e-mails: [email protected]; m¿ [email protected] Abstract. Type specimens from the collection of the polyneopteran insect orders (Dermaptera, Blattodea, Orthoptera, Phasmatodea) deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague are catalogued. We provide precise infor- mation about types of 100 taxa (5 species of Dermaptera, 3 species of Blattodea, 4 species of Phasmatodea, 55 species of Caelifera, and 33 species of Ensifera), including holotypes of 38 taxa. The year of publication of Calliptamus tenuicer- cis anatolicus MaĜan, 1952 and Calliptamus tenuicercis iracus MaĜan, 1952 are corrected. The authorship of the names traditionally ascribed to J. Obenberger is discussed in detail. Only the name Podisma alpinum carinthiacum Obenberger, 1926 is available since the publication by OBENBERGER (1926a). ‘Stenobothrus (Stauroderus) biguttulus ssp. bicolor Charp. 1825’ and ‘Stenobothrus (Stau- roderus) ssp. collinus Karny’ sensu OBENBERGER (1926a,b) refer to Gryllus bicolor Charpentier, 1825 and Stauroderus biguttulus var. collina Karny, 1907, respectively, which both have to be considered available already since their original descriptions by CHARPENTIER (1825) and KARNY (1907). Key words. -

Arthropod Diversity and Conservation in Old-Growth Northwest Forests'
AMER. ZOOL., 33:578-587 (1993) Arthropod Diversity and Conservation in Old-Growth mon et al., 1990; Hz Northwest Forests complex litter layer 1973; Lattin, 1990; JOHN D. LATTIN and other features Systematic Entomology Laboratory, Department of Entomology, Oregon State University, tural diversity of th Corvallis, Oregon 97331-2907 is reflected by the 14 found there (Lawtt SYNOPSIS. Old-growth forests of the Pacific Northwest extend along the 1990; Parsons et a. e coastal region from southern Alaska to northern California and are com- While these old posed largely of conifer rather than hardwood tree species. Many of these ity over time and trees achieve great age (500-1,000 yr). Natural succession that follows product of sever: forest stand destruction normally takes over 100 years to reach the young through successioi mature forest stage. This succession may continue on into old-growth for (Lattin, 1990). Fire centuries. The changing structural complexity of the forest over time, and diseases, are combined with the many different plant species that characterize succes- bances. The prolot sion, results in an array of arthropod habitats. It is estimated that 6,000 a continually char arthropod species may be found in such forests—over 3,400 different ments and habitat species are known from a single 6,400 ha site in Oregon. Our knowledge (Southwood, 1977 of these species is still rudimentary and much additional work is needed Lawton, 1983). throughout this vast region. Many of these species play critical roles in arthropods have lx the dynamics of forest ecosystems. They are important in nutrient cycling, old-growth site, tt as herbivores, as natural predators and parasites of other arthropod spe- mental Forest (HJ cies. -

Entomologische Erhebungen Bei Unterpurkla Und Dirnbach Im Blaurackenbrutgebiet Der Südost-Steiermark
Entomologische Erhebungen bei Unterpurkla und Dirnbach im Blaurackenbrutgebiet der Südost-Steiermark Heuschrecken, Fangschrecken, Wanzen, Tagfalter & Käfer (Saltatoria, Mantodea, Heteroptera, Diurna & Coleoptera) Europaschutzgebiet: „Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Grabenlandbäche und Höll“ Im Auftrag von: Verein Lebende Erde im Vulkanland (L.E.i.V.), Bernard Wieser Bearbeitung: Thomas Frieß, Erwin Holzer & Anton Koschuh Graz, im Mai 2012 Entomologische Kartierung 2011 / Dirnbach & Unterpurkla L.E.i.V. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Fragestellungen .................................................................................... 3 2 Untersuchte Standorte ................................................................................................... 4 3 Ergebnisse und Diskussion ......................................................................................... 10 3.1 Heuschrecken & Fangschrecken (Saltatoria & Mantodea) ............................... 10 3.2 Wanzen (Heteroptera) .......................................................................................... 16 3.3 Tagfalter (Lepidoptera: Diurna) ........................................................................... 31 3.4 Käfer (Coleoptera) ................................................................................................ 39 4 Literatur .......................................................................................................................... 54 5 Anhang: Rohdatenliste Wanzen ................................................................................. -

Annotated Checklist of the Plant Bug Tribe Mirini (Heteroptera: Miridae: Mirinae) Recorded on the Korean Peninsula, with Descriptions of Three New Species
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGYENTOMOLOGY ISSN (online): 1802-8829 Eur. J. Entomol. 115: 467–492, 2018 http://www.eje.cz doi: 10.14411/eje.2018.048 ORIGINAL ARTICLE Annotated checklist of the plant bug tribe Mirini (Heteroptera: Miridae: Mirinae) recorded on the Korean Peninsula, with descriptions of three new species MINSUK OH 1, 2, TOMOHIDE YASUNAGA3, RAM KESHARI DUWAL4 and SEUNGHWAN LEE 1, 2, * 1 Laboratory of Insect Biosystematics, Department of Agricultural Biotechnology, Seoul National University, Seoul 08826, Korea; e-mail: [email protected] 2 Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University, Korea; e-mail: [email protected] 3 Research Associate, Division of Invertebrate Zoology, American Museum of Natural History, New York, NY 10024, USA; e-mail: [email protected] 4 Visiting Scientists, Agriculture and Agri-food Canada, 960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1A, 0C6, Canada; e-mail: [email protected] Key words. Heteroptera, Miridae, Mirinae, Mirini, checklist, key, new species, new record, Korean Peninsula Abstract. An annotated checklist of the tribe Mirini (Miridae: Mirinae) recorded on the Korean peninsula is presented. A total of 113 species, including newly described and newly recorded species are recognized. Three new species, Apolygus hwasoonanus Oh, Yasunaga & Lee, sp. n., A. seonheulensis Oh, Yasunaga & Lee, sp. n. and Stenotus penniseticola Oh, Yasunaga & Lee, sp. n., are described. Eight species, Apolygus adustus (Jakovlev, 1876), Charagochilus (Charagochilus) longicornis Reuter, 1885, C. (C.) pallidicollis Zheng, 1990, Pinalitopsis rhodopotnia Yasunaga, Schwartz & Chérot, 2002, Philostephanus tibialis (Lu & Zheng, 1998), Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794), Yamatolygus insulanus Yasunaga, 1992 and Y. pilosus Yasunaga, 1992 are re- ported for the fi rst time from the Korean peninsula. -

The Effects of Native and Non-Native Grasses on Spiders, Their Prey, and Their Interactions
Spiders in California’s grassland mosaic: The effects of native and non-native grasses on spiders, their prey, and their interactions by Kirsten Elise Hill A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Environmental Science, Policy, and Management in the GRADUATE DIVISION of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Joe R. McBride, Chair Professor Rosemary G. Gillespie Professor Mary E. Power Spring 2014 © 2014 Abstract Spiders in California’s grassland mosaic: The effects of native and non-native grasses on spiders, their prey, and their interactions by Kirsten Elise Hill Doctor of Philosophy in Environmental Science and Policy Management University of California, Berkeley Professor Joe R. McBride, Chair Found in nearly all terrestrial ecosystems, small in size and able to occupy a variety of hunting niches, spiders’ consumptive effects on other arthropods can have important impacts for ecosystems. This dissertation describes research into spider populations and their interactions with potential arthropod prey in California’s native and non-native grasslands. In meadows found in northern California, native and non-native grassland patches support different functional groups of arthropod predators, sap-feeders, pollinators, and scavengers and arthropod diversity is linked to native plant diversity. Wandering spiders’ ability to forage within the meadow’s interior is linked to the distance from the shaded woodland boundary. Native grasses offer a cooler conduit into the meadow interior than non-native annual grasses during midsummer heat. Juvenile spiders in particular, are more abundant in the more structurally complex native dominated areas of the grassland. -
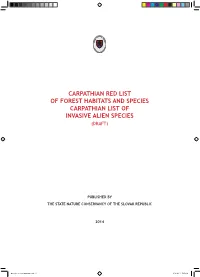
Draft Carpathian Red List of Forest Habitats
CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT) PUBLISHED BY THE STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 1 227.8.20147.8.2014 222:36:052:36:05 © Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014 Editor: Ján Kadlečík Available from: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Slovakia ISBN 978-80-89310-81-4 Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme Slovenská republika This publication was elaborated within BioREGIO Carpathians project supported by South East Europe Programme and was fi nanced by a Swiss-Slovak project supported by the Swiss Contribution to the enlarged European Union and Carpathian Wetlands Initiative. zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 2 115.9.20145.9.2014 223:10:123:10:12 Table of contents Draft Red Lists of Threatened Carpathian Habitats and Species and Carpathian List of Invasive Alien Species . 5 Draft Carpathian Red List of Forest Habitats . 20 Red List of Vascular Plants of the Carpathians . 44 Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca) . 106 Red List of Spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. 118 Draft Red List of Dragonfl ies (Odonata) of the Carpathians . 172 Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains . 186 Draft Red List of Butterfl ies (Lepidoptera: Papilionoidea) of the Carpathian Mts. 200 Draft Carpathian Red List of Fish and Lamprey Species . 203 Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia) . 209 Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia) . 214 Draft Carpathian Red List of Birds (Aves). 217 Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) . -

Insects of Larose Forest (Excluding Lepidoptera and Odonates)
Insects of Larose Forest (Excluding Lepidoptera and Odonates) • Non-native species indicated by an asterisk* • Species in red are new for the region EPHEMEROPTERA Mayflies Baetidae Small Minnow Mayflies Baetidae sp. Small minnow mayfly Caenidae Small Squaregills Caenidae sp. Small squaregill Ephemerellidae Spiny Crawlers Ephemerellidae sp. Spiny crawler Heptageniiidae Flatheaded Mayflies Heptageniidae sp. Flatheaded mayfly Leptophlebiidae Pronggills Leptophlebiidae sp. Pronggill PLECOPTERA Stoneflies Perlodidae Perlodid Stoneflies Perlodid sp. Perlodid stonefly ORTHOPTERA Grasshoppers, Crickets and Katydids Gryllidae Crickets Gryllus pennsylvanicus Field cricket Oecanthus sp. Tree cricket Tettigoniidae Katydids Amblycorypha oblongifolia Angular-winged katydid Conocephalus nigropleurum Black-sided meadow katydid Microcentrum sp. Leaf katydid Scudderia sp. Bush katydid HEMIPTERA True Bugs Acanthosomatidae Parent Bugs Elasmostethus cruciatus Red-crossed stink bug Elasmucha lateralis Parent bug Alydidae Broad-headed Bugs Alydus sp. Broad-headed bug Protenor sp. Broad-headed bug Aphididae Aphids Aphis nerii Oleander aphid* Paraprociphilus tesselatus Woolly alder aphid Cicadidae Cicadas Tibicen sp. Cicada Cicadellidae Leafhoppers Cicadellidae sp. Leafhopper Coelidia olitoria Leafhopper Cuernia striata Leahopper Draeculacephala zeae Leafhopper Graphocephala coccinea Leafhopper Idiodonus kelmcottii Leafhopper Neokolla hieroglyphica Leafhopper 1 Penthimia americana Leafhopper Tylozygus bifidus Leafhopper Cercopidae Spittlebugs Aphrophora cribrata -

Heteroptera Checklist
rECOrd Chester Zoological Gardens Upton, Chester RECORD Cheshire, CH2 1LH Tel: 01244 383749 / 383569 The Biodiversity Information System for [email protected] Cheshire, Halton, Warrington and Wirral Provisional Checklist Of Cheshire Heteroptera (True Bugs) Provided by: Steve Judd - Cheshire County Heteroptera Recorder 20th January 1987 - LCES Report & Proceedings Amended by: Steve J. McWilliam - July 2002 Taken from the Lancashire and Cheshire Entomological Society (LCES) Report and Annual Proceedings One Hundred and Tenth Session 1986/87, Pages 60-65. The checklist is based on previous county checklists compiled by Whittaker (1906, 1908), Britten (1930) and Massee (1955). Additional unpublished annotations made by Massee to his 1955 checklist were made available by the Biological Records Centre at Monks Wood. Records were extracted from the Lancashire and Cheshire Fauna Committee cards housed at Manchester Museum. Data has been extracted from the Liverpool Museum collection and all post 1970 records are supported by voucher specimens in the Museum's collection. Scientific Name: English Name: National Status: Aradidae: Aradus depressus (F.) Local Acanthosomatidae: Acanthosoma haemorrhoidalis (L.) Hawthorn Shieldbug Common Elasmostethus interstinctus (L.) Birch Shield Bug Common Elasmostethus tristriatus (F.) Juniper Shieldbug Local Elasmucha grisea (L.) Parent Bug Cydnidae: Sehirus bicolor (L.) Common Scutelleridae: Palomena prasina (L.) Green Shieldbug Common Dolycoris baccarum (L.) Sloe Bug Common Piezodorus lituratus (F.) Gorse Shieldbug Common Pentatoma rufipes (L.) Forest Bug Common Picromerus bidens (L.) Common Troilus luridus (F.) Local Rhacognathus punctatus ((L.) Local Zicrona caerulea (L.) Blue Bug Local Coreidae: Coriomeris denticulatus (Scop.) Common Alydidae: Alydus calcaratus (L.) Local Rhopalidae: Corizus hyoscyami ((L.) Local Rhopalus maculatus ((Fieber) Notable B Chorosoma schillingi (Schum.) Local A Company Limited by Guarantee Registered in England No. -

Response of Orthoptera Assemblages to Management of Montane Grasslands in the Western Carpathians
Biologia 66/6: 1127—1133, 2011 Section Zoology DOI: 10.2478/s11756-011-0115-1 Response of Orthoptera assemblages to management of montane grasslands in the Western Carpathians Vladimíra Fabriciusová, Peter Kaňuch &AntonKrištín* Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Ľ. Štúra 2,SK-96053 Zvolen, Slovakia; e-mail: [email protected] Abstract: Montane grassy habitats in the Western Carpathians are relatively well preserved, maintain high species richness and are often important in accordance to the nature conservation policy in Europe. However, knowledge about the impact of farming on the habitat quality there is rather poor. The influence of various management types (permanent sheep pen, irregular grazing, mowing) on Orthoptera diversity and species determining assemblages of these habitats were analysed on 72 plots in Poľana Mts Biosphere Reserve. Altogether, 36 Orthoptera species (15 Ensifera, 21 Caelifera) were found, whereas the highest number of species was found on plots with irregular grazing (28 species), followed by plots with mown grass (17) and permanent sheep pens (14). All four measures of the assemblages’ diversity confirmed significant differences. Using Discriminant Function Analysis, correct classification rate of Orthoptera assemblages was unambiguous according to the type of management. Each form of the management harboured several characteristic species. Thus implications regarding the biodiversity conservation and grassland management were given. Key words: bush-crickets; grasshoppers; pasture; ecology; nature conservation Introduction or the influence of plant succession in meadows without any management (Marini et al. 2009). Higher species Various systems used to manage grasslands have a diversity was found in grazed compared to mowed significant influence on plant and animal communi- meadows in alpine habitats (Wettstein & Schmid 1999; ties, their species richness and abundance (Kampmann Kampmann et al. -

A NEW SPECIES of EPHIPPIGER BERTHOLD, 1827 from the NORTHERN APENNINES in ITALY (Insecta Orthoptera Bradyporidae)
P. FONTANA & B. ODÉ: A new species of Ephippiger Berthold, 1827... 81 PAOLO FONTANA (*) & BAUDEWIJN ODÉ A NEW SPECIES OF EPHIPPIGER BERTHOLD, 1827 FROM THE NORTHERN APENNINES IN ITALY (Insecta Orthoptera Bradyporidae) ABSTRACT - FONTANA P. & ODÉ B., 2003 - A new species of Ephippiger Berthold, 1827 from the Northern Apennines in Italy (Insecta Orthoptera Bradyporidae). Atti Acc. Rov. Agiati, a. 253, 2003, ser. VIII, vol. III, B: 81-103. Ephippiger carlottae n. sp. from Northern Apennine is described. The authors briefly present the status of the knowledge in Italy concerning the genus Ephippiger and in particular of the taxa of the Ephippiger ephippiger group. The new species is characterised by the subrectangular supragenital plate, the stout and short cerci and the medium length of titillators. Ephippiger carlottae n. sp. at present is known from the Emilia Romagna region and Tuscany only; it is a submontane to montane species and lives on bushes especially of Rubus sp. The bioacoustics of the species is de- scribed and illustrated by oscillograms. Several photos and drawings illustrate the main morphological characters and their variability, the habitat in the locus typicus restrictus and the distribution of the new species. KEY WORDS - Ephippiger carlottae n. sp., Ephippiger ephippiger group, Morpho- logy, Bioacoustics. RIASSUNTO - FONTANA P. & ODÉ B., 2003 - Una nuova specie di Ephippiger Berthold, 1827 dell’Appennino settentrionale in Italia (Insecta Orthoptera Bradyporidae). Viene descritto Ephippiger carlottae n. sp. dell’Appennino settentrionale. Gli au- tori presentano una breve rassegna sulle conoscenze relative al genere Ephippiger in Italia ed in particolare sui taxa del gruppo dell’Ephippiger ephippiger. -

Annotated Checklist of the Hemiptera Heteroptera of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation “Alpi Marittime” (NW Italy)
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Bruno David Président du Muséum national d’Histoire naturelle RÉDACTRICE EN CHEF / EDITOR-IN-CHIEF : Laure Desutter-Grandcolas ASSISTANTS DE RÉDACTION / ASSISTANT EDITORS : Anne Mabille ([email protected]), Emmanuel Côtez MISE EN PAGE / PAGE LAYOUT : Anne Mabille COMITÉ SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD : James Carpenter (AMNH, New York, États-Unis) Maria Marta Cigliano (Museo de La Plata, La Plata, Argentine) Henrik Enghoff (NHMD, Copenhague, Danemark) Rafael Marquez (CSIC, Madrid, Espagne) Peter Ng (University of Singapore) Norman I. Platnick (AMNH, New York, États-Unis) Jean-Yves Rasplus (INRA, Montferrier-sur-Lez, France) Jean-François Silvain (IRD, Gif-sur-Yvette, France) Wanda M. Weiner (Polish Academy of Sciences, Cracovie, Pologne) John Wenzel (The Ohio State University, Columbus, États-Unis) COUVERTURE / COVER : Eurydema fieberi Fieber, 1837. Photo: S. Bambi. Zoosystema est indexé dans / Zoosystema is indexed in: – Science Citation Index Expanded (SciSearch®) – ISI Alerting Services® – Current Contents® / Agriculture, Biology, and Environmental Sciences® – Scopus® Zoosystema est distribué en version électronique par / Zoosystema is distributed electronically by: – BioOne® (http://www.bioone.org) Les articles ainsi que les nouveautés nomenclaturales publiés dans Zoosystema sont référencés par / Articles and nomenclatural novelties published in Zoosystema are referenced by: – ZooBank® (http://zoobank.org) Zoosystema est une revue en flux continu publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris / Zoosystema is a fast track journal published by the Museum Science Press, Paris Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi / The Museum Science Press also publish: Adansonia, Geodiversitas, Anthropozoologica, European Journal of Taxonomy, Naturae, Cryptogamie sous-sections Algologie, Bryologie, Mycologie. Diffusion – Publications scientifiques Muséum national d’Histoire naturelle CP 41 – 57 rue Cuvier F-75231 Paris cedex 05 (France) Tél. -

Comparative Analysis of Chromosomes in the Palaearctic Bush-Crickets of Tribe Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniinae)
COMPARATIVE A peer-reviewed open-access journal CompCytogenComparative 11(2): 309–324 analysis (2017) of chromosomes in the Palaearctic bush-crickets of tribe Pholidopterini... 309 doi: 10.3897/CompCytogen.v11i2.12070 RESEARCH ARTICLE Cytogenetics http://compcytogen.pensoft.net International Journal of Plant & Animal Cytogenetics, Karyosystematics, and Molecular Systematics Comparative analysis of chromosomes in the Palaearctic bush-crickets of tribe Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniinae) Elżbieta Warchałowska-Śliwa1, Beata Grzywacz1, Klaus-Gerhard Heller2, Dragan P. Chobanov3 1 Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, 31-016 Krakow, Poland 2 Grillenstieg 18, 39120 Magdeburg, Germany 3 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, 1 Tsar Osvoboditel Boul., 1000 Sofia, Bulgaria Corresponding author: Elżbieta Warchałowska-Śliwa ([email protected]) Academic editor: D. Cabral-de-Mello | Received 2 February 2017 | Accepted 28 March 2017 | Published 5 May 2017 http://zoobank.org/8ACF60EB-121C-48BF-B953-E2CF353242F4 Citation: Warchałowska-Śliwa E, Grzywacz B, Heller K-G, Chobanov DP (2017) Comparative analysis of chromosomes in the Palaearctic bush-crickets of tribe Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniinae). Comparative Cytogenetics 11(2): 309–324. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v11i2.12070 Abstract The present study focused on the evolution of the karyotype in four genera of the tribe Pholidopterini: Eupholidoptera Mařan, 1953, Parapholidoptera Mařan, 1953, Pholidoptera Wesmaël, 1838, Uvarovistia Mařan, 1953. Chromosomes were analyzed using fluorescencein situ hybridization (FISH) with 18S rDNA and (TTAGG)n telomeric probes, and classical techniques, such as C-banding, silver impregna- tion and fluorochrome DAPI/CMA3 staining. Most species retained the ancestral diploid chromosome number 2n = 31 (male) or 32 (female), while some of the taxa, especially a group of species within genus Pholidoptera, evolved a reduced chromosome number 2n = 29.