Oder Wie Die Firma Blohm & Voss Zum Flugzeugbau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
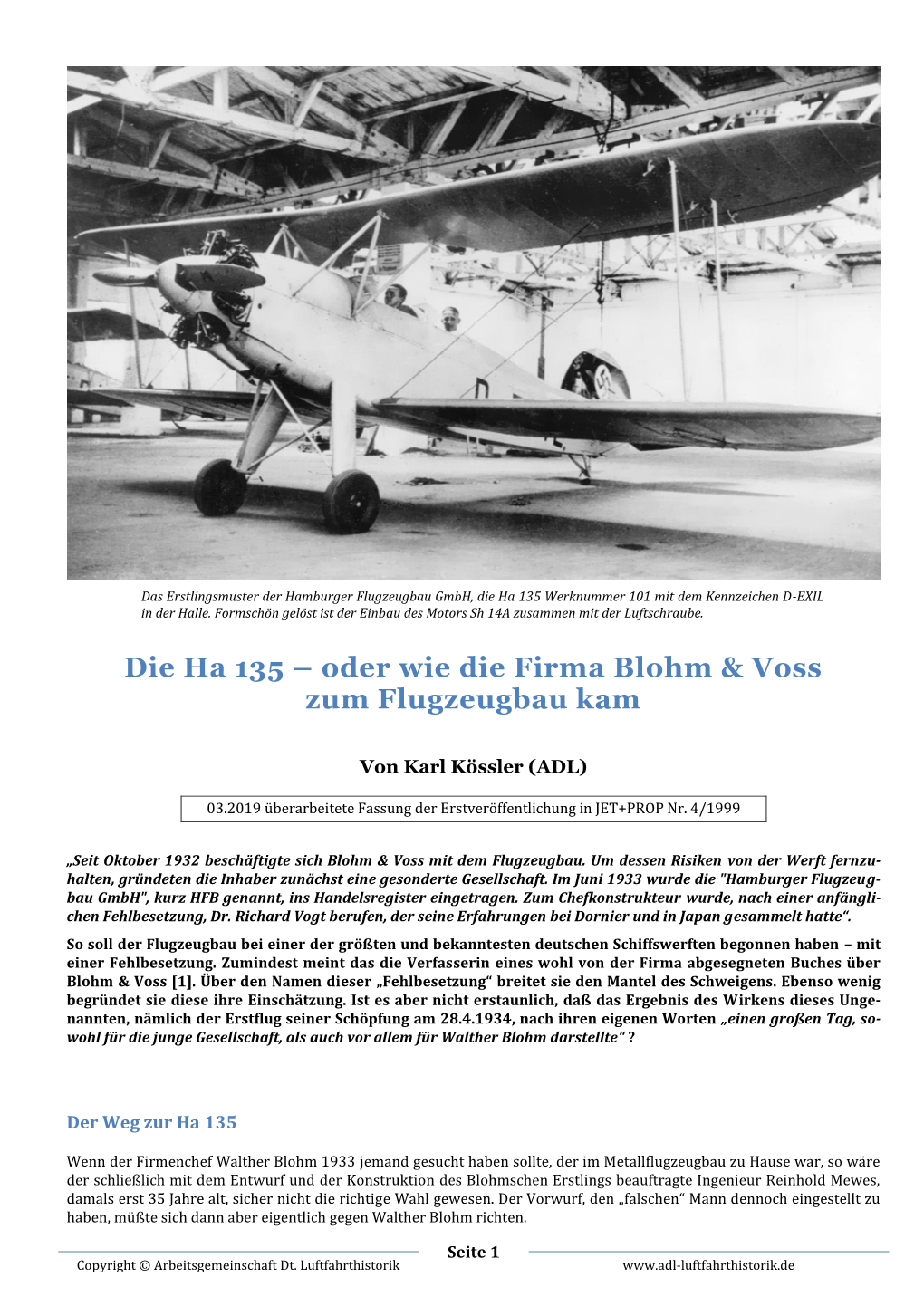
Load more
Recommended publications
-

Von Karlheinz Hansen Im Walde 5 21228 Harmstorf Tel.: 04105 2306 Mobil: 0172 41 39 87 Mail: [email protected]
Von Karlheinz Hansen Im Walde 5 21228 Harmstorf Tel.: 04105 2306 Mobil: 0172 41 39 87 Mail: [email protected] 1 Zur Geschichte der Transatlantik-Postflugzeuge des Hamburger Flugzeugbau von Karlheinz Hansen-Harmstorf 06.11.28.-1-G-CD Alle Rechte bleiben dem Verfasser vorbehalten. Kopien und Zitate, auch auszugsweise, nur nach ausdrücklicher Genehmigung. 2 27. 04. 2005 Ein großer Tag in der Geschichte des Flugzeugbaues Der Erstflug des A 380 in Toulouse begeistert die Menschen und lässt sie auf die erste Landung zur Ausstattung in Hamburg hoffen. 3 Zur Geschichte der Transatlantik-Postflugzeuge des Hamburger Flugzeugbau Mit einer Übersicht der HFB-Flugzeuge von 1933 bis 1945, den Erstflügen nach der Neugründung des Hamburger Flugzeugbau 1955 in Finkenwerder und der Übersicht der Airbus-Flugzeugfamilie und deren Bauaufteilung der europäischen Partner. A 318-Erstflug am 15.01.2002 in Hamburg-Finkenwerder Auf dem Finkenwerder Hauptdeich stehen am 15. Januar 2002 Menschen und sehen dem Erststart des jüngsten Mitgliedes der Airbus-Flugzeugfamilie zu. Die „A 318“, hat zu ihrem Jungfernflug vom Werkflugplatz Airbus Deutschland abgehoben. Unter den Zuschauern sind Menschen, die Jahrzehnte hier in Hamburg-Finkenwerder Flugzeuge gebaut haben. Die Menschen schauen der neuen Maschine nach, die in den Wolken nach Westen entschwindet, um über der Nordsee die erste Erprobung aufzunehmen. Sie denken an die Erstflüge, die sie hier miterlebt haben. Für einige, die seit der Neugründung des „Hamburger Flugzeugbau“ nach dem Krieg im Jahre 1955 dabei sind, ist dies heute der sechste Erstflug eines neuen Flugzeugmusters in Hamburg. Nord-2501 Noratlas Das erste Flugzeug nach der Neugründung des Hamburger Flugzeugbau ist die „Noratlas“, ein Lizenznachbau des französischen Transportflugzeuges Nord-2501, das am 09.09.1958 in Finkenwerder vom „HFB“ an die neu gegründete Deutsche Luftwaffe übergeben wird und dann als „Nora“ in den Serienbau geht. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Zur Gecchichte das Flugzeugs 7 7 Transavia PI-12 „Airtruk'7PL-12 U „Flying CHINA Mango" 36/570 1. Die Nachahmung des Vogelflugs 77 Harbin C-11 57/572 „Jie-Fang" 57/572 2. Die Vorbilder Nanchang F-6bis 58/572 für den Flug des Menschen 12 BELGIEN „Peking-1" 58/572 3. Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 Avions Fairey „Tipsy Nipper" 37/570 4. Die Verwirklichung des Gleitflugs- SABCAS-2 37/570 Voraussetzung für den Motorflug 14 Stampe et Renard SV-4 C 38/570 CSSR 6. Der erste Motorflug der Brüder Wright 75 Aero Ae-02 59/572 6. Die ersten Motorflüge in Europa AeroA-42 59/572 und die Entwicklung der Luftfahrttechnik BRASILIEN Aero 145 60/572 bis zum Jahre 1914 76 AviaBH-3 60/572 7. Der erste Weltkrieg EMBRAER EMB-110 „Bandeirante" 39/570 Avia B-534 67/572 und die Luftfahrttechnik 17 EMBRAER EMB-200/201 „Ipanema" 39/570 AviaB-135 67/572 ITA „Urupema" 40/570 HC-2 „Heli Baby'7HC-102 62/572 8. Der Aufschwung der Luftfahrttechnik Neiva 360 C „Regente"/„Regenta Elo'7 L-13„Blanik" 63/572 in den Jahren 1919 bis 1939 19 „Lanceiro" 40/570 L-60 „Brigadyr" 63/572 8.1. Bauweisen 19 Neiva Paulistinha 56-C/56-D 47/570 L-40 „Meta Sokol" 64/572 8.2. Triebwerke 20 Neiva N-621 „Universal"/T-25 47/570 L-200 „Morava" 64/572 8.3. Aerodynamik 21 L-29 „Delfin" 65/572 8.4. Geschwindigkeiten 22 L-39 „Albatros" 65/572 8.5. Das Verkehrsflugzeug 24 L-410 „Turbolet" 66/572 8.6. -

Auto Union Und Junkers
Peter Kohl/Peter Bessel Auto Union und Junkers Die Geschichte der Mitteldeutschen Motorenwerke GmbH Taucha 1935-1948 Franz Steiner Verlag Inhaltsübersicht Vorwort 7 (PETER KOHL) Einleitung 9 1. Prolog: 1933-1934 15 Die Ausgangslage 15 Die Einbeziehung der Flugzeugindustrie 16 Leipzig als Standort der Luftrüstung 22 2. Teil I: 1935-1939 29 Ein Flugmotorenwerk in Leipzig 29 Die Gründung der Motorenwerke 40 Von Leipzig nach Taucha 44 Das neue Werk entsteht 49 Produktion im Anlauf 62 Von Auftrag zur Großserie 62 Der Flugzeugmotor Jumo 205C und sein Einsatz 65 Junkers Ju 86 C-l 69 Junkers Ju 86 D-l 70 Blohm & Voß/Hamburger Flugzeugbau Ha 139 70 Der Flugzeugmotor Jumo 211 und sein Einsatz 74 Heinkel He 111 76 Junkers Ju 87 77 Junkers Ju 88 78 Arbeitskräfte von nah und fern 86 Arbeiten und Wohnen in Taucha 91 3. Teil II: 1939-1945 101 Die Auto Union kauft ein ;... 101 Produktion im Aufwind 104 Der Flugzeugmotor Jumo 213 und sein Einsatz : :... 107 Junkers Ju 188 A-2 •... 108 Focke-WulfFw 190 D-9 : :... 109 Der Flugzeugmotor Jumo 222 und sein Einsatz :... 114 Junkers Ju 288 115 Der Flugzeugmotor Jumo 205D und sein Einsatz :... 116 Dornier Do 18 118 Blohm & Voß BV 138 118 6 Inhaltsübersicht Der Flugzeugmotor Jumo 207 und sein Einsatz 124 Junkers Ju 86P und Ju 86R 124 Blohm & Voß BV 222 126 Der Flugzeugmotor Jumo 208 und sein Einsatz 127 Die Auto Union als Zulieferer 140 Aufladung von Höhenmotoren 144 Die Auto Union als Flugmotorenentwickler 146 Schiebersteuerung 147 Kriegswirtschaft und Arbeitseinsatz 155 „Holzhäuseraktion" und „Behelfsheime" 177 Luftschutz und Luftangriffe 182 Mehr Jagdflugzeuge, mehr Motoren - der „Jägerstab" 190 Der Krieg geht zu Ende 205 Das Strahltriebwerk Jumo 004 und sein Einsatz 205 Messerschmitt Me 262 208 Arado Ar 234 210 Flugmotorenfertigung im Vergleich 217 (PETER BESSEL) 4. -

F-104 German Industry
FLIGHT, 611 19 OcroAer 1961 F-/04G centre fuse/ages being made by Dormer at Neuaubing The German Industry THE AIRFRAME MAKERS: FROM LICENSED BUILDING TO PROJECTS 611 The Airframe Makers 621 Industry Directory 622 Super Star-fighter 629 Aircraft, Engines and Missiles Fiat G.9IR3 wing panel being made by Heinkel ISEN like a phoenix from the ashes of the Third Reich's industry, the new German aircraft companies have reason R to be proud of the progress they have made in five years of post-war existence. From almost literally nothing, they have pro- gressed in that time to the production in quantity of one of the world's fastest strike fighters and to the design of modern aircraft of their own. By 1945 most of the factories had been destroyed by air and ground attacks and what had not been destroyed was then system- atically dismantled and taken away. Skilled personnel were dis- persed, either being taken to other countries or driven by necessity into other industries. Then came an interval of ten years' enforced idleness during which no aircraft development was allowed. The workers who remained in Germany were perforce absorbed into other work, so that while aircraft technology and design were moving ahead faster than ever in other countries, German knowledge and skill lay virtually dormant. When sovereignty, and with it permission to make aircraft, were granted again in 1955, the companies had to start from scratch, the only ready-made resources being the former skill and knowledge they could attract back to aircraft-making from abroad and from other industries. -
Arbeit - Umwelt Am Wissenschaftszentrum Berlin Für Sozialforschung
Schriftenreihe der Forschungsgruppe "Große technische Systeme" des Forschungsschwerpunkts Technik - Arbeit - Umwelt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung FS II93-506 The Airbus Matrix: The Reorganization of the Postwar European Aircraft Industry Glenn E. Bugos Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung gGmbH (WZB) Reichpietschufer 50, D-10785 Berlin Tel. (030)-25 491-0 Fax (030)-25 491-254 od. -684 THE AIRBUS MATRIX: THE REORGANIZATION OF THE POSTWAR EUROPEAN AIRCRAFT INDUSTRY Abstract The history of the European airbus family has several implications for large technical sytems research. First, it represents the successful attempt of the European aircraft industry at breaking the American monopoly on the technical key component of global air traffic, namely the production of large passenger aircraft. Secondly, it stands for a major technical development project in which not only R&D activities of many heterogeneous and partly rivaling enterprises had to be harmonized but also the research and economic policies of various European countries. Thirdly, it is an account of the establishment and operation of a production system that—being scattered all over Europe—heavily depends on communication, logistics and other infrastructure systems. The author relates the history of European aircraft industry from the first European cooperative projects in the area of military aircraft and missile engineering up to the commercial breakthrough of the civil airbus in the 1980s. According to the author, the transition from conventional, rather rigid staff/line organization to flexible matrix organizations that are adaptable to heterogeneous conditions was the crucial prerequisite for the success of the air bus program. DIE AIRBUS-MATRIX: ZUR REORGANISIERUNG DER EUROPÄISCHEN LUFTFAHRTINDUSTRIE NACH DEM 2. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Zur Geschichte des Flugzeugs 1. Die Nachahmung des Vogelflugs 11 7. , Die Verwendung des Flugzeugs - 10. Die Luftfahrttechnik in zweiten Welt zum Glück oder zum Unglück krieg 26 2. Die Vorbilder für den Flug des Menschen? 18 des Menschen 12 11. Die Luftfahrttechnik nach 1945 27 8. Der erste Weltkrieg und die Luftfahrt 11.1. Die Verkehrsflugzeuge der ersten, 3. Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 • technik 18 zweiten und dritten Generation sowie die Überschallverkehrsfltigzeuge 27 4. Die Verwirklichung des Gleitflugs — 9. Der Aufschwung der Luftfahrttechnik 11.2. Die Militärfliegerei 29 Voraussetzung für den Motorflug 14 in den Jahren 1919 bis 1939 20 11.3. Einiges über den Hubschrauber 31 11.4. Entwicklungstendenzen seit dem Jahr 5. Der erste Motorflug der Brüder 9.1. Bauweisen 20 1975 32 Wright 15 9.2. Triebwerke 21 9.3. Aerodynamik 22 12. Ausblick 34 6. Die ersten Motorflüge in Europa 9.4. Geschwindigkeiten 22 und die Entwicklung der Luftfahrttechnik 9.5. Das Verkehrsflugzeug 24 bis zum Jahr 1914 16 9.6. Die sowjetische Luftfahrttechnik 25 Typenbeschreibungen ARGENTINIEN BRD Avia B-135 60 HC-2 „Heli Baby"/HC-102 61 Aero Boero AB 95/115/180/210/260 35 Aero-Technik-Canary/Bücker L-60 „Brigadyr" 62 FMA I.A.50 „Guarani II" 36 Bü-133 D „Jungmeister" 47 L-40 „Meta Sokol" 62 FMA I.A.53 36 Dornier Do 27 47 L-200 „Morava" 63 FMA I.A.58 „Pucara" 37 Dornier Do 28 / Do 28 D „Skyservant" 48 L-29 „Delfin" 63 FMA I.A.63 „Pampa" 37 Dornier Do 128 / Do 228 48 L-39 „Albatros" 64 Hamburger Flugzeugbau HFB 320 „Hansa Jet" L-410 „Turbolet" 64 49 Letov SM-1 65 AUSTRALIEN MBB Bo 207 50 Letov 5-8 65 MBB SIAT 223 „Flamingo" 50 Letov 5-231 66 Commonwealth Aircraft Corporation MBB Bo 105 51 Letov 5-328 66 CA-1 „Wirraway" 38 MBB Bo 209 „Monsun" 52 Praga E-114 „Air Baby" 67 Commonwealth Aircraft Corporation Pützer „Elster" 52 Z-126/Z-226 „Trener"/Z-326 „Trener Master" CA. -

Flight Lines
July 2021 Flight Lines Cover Page: Grant Finlay’s Avro 504 takes flight recently at Waharoa 2 FLIGHT LINES HAMILTON MODEL AERO CLUB INC. July 2021 www.hamiltonmac.org.nz PATRON Graeme Bradley – Retired and living a well-deserved life of luxury PRESIDENT Grant Finlay 027-273-7461 VICE PRESIDENT Gordon Meads 021-125-2911 SECRETARY Alan Rowson 07-843-3889 TREASURER Alan Rowson 021-025-93002 CLUB CAPTAIN Sel Melville 027-482-3459 BULLETIN Ed. Dave Crook 021-123-6040 (Editorial Email: send to: [email protected] ) COMMITTEE: Mike Sutton Chris Tynan 022-353-9231 Sel Melville 027-482-3459 Dave Crook 021-123-6040 Lyndon Perry 021-0251-8474 Wayne Cartwright 022-1534-679 WEB SITE Grant Finlay CATERER Colleen Tynan CLUB NIGHT: Wednesday 14 July, 2021 7.30 pm VENUE: Beerescourt Bowling Club 68a Maeroa Road - Hamilton Club Night Theme: Anything goes plus bring along your current project. Club Themed Flying Day: Float Plane Day, July 11 at Lake Kainui (Lake D) 3 Presidents Report Grant Winters here…go north for warmer weather they say…so what did I do, I went south to Queenstown for ten days ….well I got that wrong, it certainly was not North and definitely not warmer….but apparently it was a lot drier down there than back here in the Waikato! Yes it appears the weather in the Waikato has been a bit wet for the last few weeks and only last weekend’s huge high with frost and sunshine could make up for it! A large turnout at the field on Sunday helped release some of the winter blues for many and there was a heap of flying done. -

The Rohrbach Chronicles
The Rohrbach Chronicles ADOLF KARL ROHRBACH 1889-1939 German Airplane Designer, Entrepreneur ii iii The Rohrbach Chronicles ADOLF KARL ROHRBACH 1889-1939 German Airplane Designer, Entrepreneur by G. J. Staalman private edition – not for publication Park Newport CA – 2014 iv Colofon ABBREVIATIONS RMF : Rohrbach Metalflugzeugbau RVM: Reichsverkehrsministerium RLM : Reichsluftfahrtministerium RWM: Reichswehrministerium DLH : (Deutsche) Luft Hansa, later Lufthansa DVL: Deutsche Versuchsanstallt für Luftfahrt M: Million NOTES to the READER 1. This document is in PDF format, A4 paper size. 2. This document is for personal usage only; it is not for general publication. The illustrations are meant as examples only and copyright has not been verified in all cases. Where quotations appear in the text, the source is indicated between square brackets [ ]. Square brackets may also be used by the author to indicate changes in quotations and to indicate statements which need further checking. 3. The reader is invited to make corrections, improvements and/or additions to the text and send them to:: [email protected]. Version 5.0 A4 / April 2014 Compiled and written by Gerrit J. Staalman – Typographic expertise by Monica M. Wagner Newport Beach, CA USA v THE ROHRBACH CHRONICLES A Word from the Writer My fascination with Adolf Karl Rohrbach (Gotha, Germany, 1889-1939) may seem surprising. He is not the foremost German aviation pioneer with a name surviving to this day. I came across Dr.-Ing. Rohrbach while searching the literature on early aviation for an answer to the question why it took the aviation industry so long before it could build airliners that could cross the Atlantic Ocean comfortably. -

Bremen Airport Bremen, Germany Members of the the Bremer Verein Für Luftfahrt on Neuenlander Feld
American Institute of Aeronautics and Astronautics Historic Aerospace Site Bremen Airport Bremen, Germany Members of the the Bremer Verein für Luftfahrt on Neuenlander Feld. American Institute of Aeronautics and Astronautics Historic Aerospace Site Bremen Airport Bremen, Germany The history of Bremen Airport begins infrastructure was geared towards in the early 20th century with the early aircraft operations, including several years of the airplane. The Bremer hangars. Verein für Luftschiffahrt (BVL), a local aviation club, used some land in During World War I, the airport was Bremen belonging to the local garrison used by the military, and civilian to conduct the first experimental flights operations ceased. The military in Germany, in the summer of 1910. erected a wooden hangar, but conducted only a small number The Senate of Bremen supported of operations from the airfield. establishing an airfield in order Construction continued after the A flyover of Bremen. to connect Bremen to the growing war ended, and the Bremen Airport airship route network, and on 16 May officially opened on 18 July 1920. 1913 granted official permission for BVL to operate an airport. Although The first scheduled flight, from KLM the original purpose was supposed airline (which stands for Koninklijke to be airship support, the initial Luchtvaart Maatschappij, Royal Bremer Verein für Luftschiffahrt (BVL) The Bremen Airship Aviation Association The BVL was established in 1909 by local Bremen aerospace pioneers including Wilhelm and Heinrich Focke and Walter Schudeisky, as well as local businessmen. In 1910, four airplane hangars were built on a Fashionable flyers at Bremen Airport parade ground in nearby Neuenlander field, one of which was given in the 1920s. -

FAA HISTORICAL CHRONOLOGY, 1926-1996 You May Use This
FAA HISTORICAL CHRONOLOGY, 1926-1996 You may use this chronology in three ways: Browse by scrolling through this document. Search this document for words, phrases, or numbers (for example, Lindbergh Field or 747). To do this, select Edit, then Find, or use the Control + F command. To quickly reach the beginning of any year, search for that year preceded by an asterisk (for example, *1957). Use the index *1926 May 20, 1926: President Calvin Coolidge signed the Air Commerce Act of 1926 into law. The act instructed the Secretary of Commerce to foster air commerce; designate and establish airways; establish, operate, and maintain aids to air navigation (but not airports); arrange for research and development to improve such aids; license pilots; issue airworthiness certificates for aircraft and major aircraft components; and investigate accidents. (See Introduction.) May 23, 1926: Western Air Express (WAE) became one of the first U.S. airlines to offer regular passenger service, flying from Los Angeles to Salt Lake City via Las Vegas. WAE had begun flying on Apr 17 as the fourth carrier to begin operations under a new air mail contract system that became the major source of income for the era's small but growing airline industry (see Jun 3, 1926). Over twelve years earlier, the St. Petersburg-Tampa Airboat Line had offered the world's first regularly scheduled airline service using heavier-than-air craft. This enterprise lasted for only the first three months of 1914. On Mar 1, 1925, T. Claude Ryan's Los Angeles-San Diego Air Line had begun the first scheduled passenger service operated wholly over the U.S. -

Part 4 — Aircraft Manufacturers Partie 4 — Constructeurs D’Aéronefs Parte 4 — Fabricantes De Aeronaves Часть 4
4-1 PART 4 — AIRCRAFT MANUFACTURERS PARTIE 4 — CONSTRUCTEURS D’AÉRONEFS PARTE 4 — FABRICANTES DE AERONAVES ЧАСТЬ 4. ИЗГОТОВИТЕЛИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ COMMON NAME COMMON NAME NOM COURANT NOM COURANT NOMBRE COMERCIAL NOMBRE COMERCIAL CORRIENTE MANUFACTURER FULL NAME CORRIENTE MANUFACTURER FULL NAME ШИРОКО NOM COMPLET DU CONSTRUCTEUR ШИРОКО NOM COMPLET DU CONSTRUCTEUR РАСПРОСТРАНЕННОЕ FABRICANTE NOMBRE COMPLETO РАСПРОСТРАНЕННОЕ FABRICANTE NOMBRE COMPLETO НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ( A (any manufacturer) (USED FOR GENERIC AIRCRAFT TYPES) AERO ELI AERO ELI SERVIZI (ITALY) AERO GARE AERO GARE (UNITED STATES) 3 AERO ITBA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES / PROYECTO PETREL SA (ARGENTINA) 328 SUPPORT SERVICES 328 SUPPORT SERVICES GMBH (GERMANY) AERO JAEN AERONAUTICA DE JAEN (SPAIN) AERO KUHLMANN AERO KUHLMANN (FRANCE) 3XTRIM ZAKLADY LOTNICZE 3XTRIM SP Z OO (POLAND) AERO MERCANTIL AERO MERCANTIL SA (COLOMBIA) A AERO MIRAGE AERO MIRAGE INC (UNITED STATES) AERO MOD AERO MOD GENERAL (UNITED STATES) A-41 CONG TY SU'A CHU'A MAY BAY A-41 (VIETNAM) AERO SERVICES AÉRO SERVICES GUÉPARD (FRANCE) AAC AAC AMPHIBIAM AIRPLANES OF CANADA (CANADA) AERO SPACELINES AERO SPACELINES INC (UNITED STATES) AAK AUSTRALIAN AIRCRAFT KITS PTY LTD (AUSTRALIA) AEROALCOOL AEROÁLCOOL TECNOLOGIA LTDA (BRAZIL) AAMSA AERONAUTICA AGRICOLA MEXICANA SA (MEXICO) AEROANDINA AEROANDINA SA (COLOMBIA) AASI ADVANCED AERODYNAMICS AND STRUCTURES INC AERO-ASTRA AVIATSIONNYI NAUCHNO-TEKHNICHESKIY TSENTR (UNITED STATES) AERO-ASTRA -

HFB 320 HANSA JET HFB 320 HANSA JET Der Beste Prophet Der Zukunft Ist Die Vergangenheit Lord Byron, 1823 Flugzeugbau in Hamburg Seit 1911
HERZLICH WILLKOMMEN ! HFB 320 - Wegbereiterin der Airbus-Produktion in Hamburg HFB 320 HANSA JET HFB 320 HANSA JET Der beste Prophet der Zukunft ist die Vergangenheit Lord Byron, 1823 Flugzeugbau in Hamburg seit 1911 1903: Erster Motorflug der Gebrüder Wright, Kitty Hawk, USA. 1911: Gründung der Hamburger Luftschiffhallen GmbH 1911: Gründung der Hansa Flugzeugwerke - Bau der „Hansa Taube“ nach dem Vorbild der Etrich Taube. 1914: Friedrich „Krischan“ Christiansen, geb. in Wyk auf Föhr, erhält seine Fluglizenz bei der „Centrale für Aviatik“. Christiansen wird 1930 weltberühmt als Kapitän der Do-X. 1919: Zweite Fluglinienverbindung der Welt führt von Hamburg nach Berlin. (DLR) 1922: Gründung der Bäumer Aero GmbH. 1925 - 1928: Bau des Weltrekordflugzeugs Bäumer „Sausewind“. Ur-Ahn der Heinkel Schnellflugzeuge.Walter & Siegfried Günter. Flugzeugbau in Hamburg seit 1911 1925 - 1928 Bäumer Aero „Sausewind“ Flugzeugbau in Hamburg seit 1911 1929: Erfindung des „Terminal“-Gebäudetyps in Hamburg. 4. Juli 1933: Gründung der Hamburger Flugzeugbau GmbH / B&V. Bau von Ju 52 Teilen in Lizenz. 1937 - 1939: Rund 100 Überquerungen des Nord- und Südatlantiks per Ha 139 Postflugzeug. 1940: Erstflug des Großflugbootes BV 222 nach einer Forderung der Lufthansa für Routen nach New York und Rio de Janeiro. Spannweite 46m (A310: 43.90m) 1944: Erstflug BV 238 als damals größtes Flugzeug der Welt. Spannweite 60,17 m. Länge 43,36 m. Flugzeugbau in Hamburg seit 1911 1936 B&V Ha 139 Flugzeugbau in Hamburg seit 1911 1940 B&V 222 Auf dem Weg zum Hansa Jet Ju 287 - die Ur-Ahnin des Hansa Jets Auf dem Weg zum Hansa Jet Der vorgepfeilte Flügel - Ju 287: 1942: Junkers-Entwicklungschef Prof.