Chromosomenzahlen Von Hieracium (Compositae, Cichorieae) – Teil 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
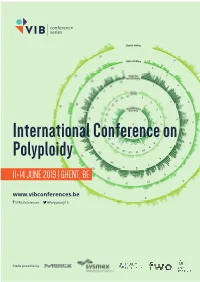
Polyploidy19 Program.Pdf
Preface Yves Van de Peer The study of polyploidy dates back more than 100 years to the work of biologists such as Hugo de Vries and G. Ledyard Stebbins Jr. It has since then been realized that polyploidy is widespread and commonplace in plants. Although polyploidy is much rarer in animals, there are also numerous cases of currently polyploid insects, fishes, amphibians and reptiles. For a long time, ancient polyploidy events, dating back millions of years, were much less well documented and it was not until the advent of genomic technologies that conclusive evidence of ancient whole genome duplications (WGD) events became available and we now have evidence for tens, or even hundreds, of ancient WGD events. Explanations of the short-term success of polyploids are usually centered on the effects of genomic changes and increased genetic variation, which are mediated by changes in gene expression and epigenetic remodeling. Increased genetic variation, together with the direct cytogenetic conse- quences of genome doubling, can potentially affect the morphology and physiology of newly formed polyploids and could lead to alterations of ecologically and envi- ronmentally suitable conditions. For instance, it has repeatedly been proposed that polyploids have increased environmental robustness than do diploids, potentially leading to evolutionary advantages during periods of environmental turmoil. More- over, polyploidy has also sometimes been linked with higher diversification rates. Long(er)-term implications of WGD might be evolutionary innovation and increase in biological complexity by the biased retention of regulatory and developmental genes, which, given time, might diversify in function or cause rewiring of gene regulatory networks. -

Molecular Phylogeny and Evolutionary Trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Botany Molecular phylogeny and evolutionary trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) Molekulární fylogeneze a evoluční trendy v rodě Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) Karol Krak Ph.D. thesis Prague, May 2012 Supervised by: Dr. Judith Fehrer Content Declaration.........................................................................................................1 Acknowledgements............................................................................................2 Sumary...............................................................................................................3 Introduction.........................................................................................................4 Aims of the thesis.............................................................................................14 References.......................................................................................................15 Papers included in the thesis 1. Intra-individual polymorphism in diploid and apomictic polyploid.................22 hawkweeds (Hieracium, Lactuceae, Asteraceae): disentangling phylogenetic signal, reticulation, and noise. Fehrer J., Krak K., Chrtek J. BMC Evolutionary Biology (2009) 9: 239 2. Genome size in Hieracium subgenus Hieracium (Asteraceae) is...............45 strongly correlated with major phylogenetic groups. Chrtek J., Zahradníček J., Krak K., Fehrer J. Annals of Botany (2009) 104: 161–178 3. Development of novel low-copy nuclear markers -

Asteraceae) from Central and Southeastern Europe
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica 53/1: 102–110, 2011 DOI: 10.2478/v10182-011-0014-3 CHROMOSOME NUMBERS IN HIERACIUM AND PILOSELLA (ASTERACEAE) FROM CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE TOMASZ ILNICKI1* AND ZBIGNIEW SZELĄG2** 1Department of Plant Cytology and Embryology, Jagiellonian University, Grodzka 52, 31-044 Cracow, Poland, 2Institute of Botany, Jagiellonian University, Kopernika 31, 31-501 Cracow, Poland Received March 20, 2011; revision accepted April 29, 2011 Chromosome numbers of 46 Hieracium L. and Pilosella Vaill. taxa from Austria, Bulgaria, Czech Republic, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia and Slovakia are presented. Chromosomes numbers are given for the first time for Hieracium amphigenum Briq. 2n = 3x = 27, H. bohatschianum Zahn 2n = 4x = 36, H. borbasii R. Uechtr. 2n = 4x = 36, H. cernuum Friv. 2n = 2x = 18, H. hazslinszkyi Pax 2n = 3x = 27, H. mirekii Szeląg 2n = 4x = 36, H. polyphyllobasis (Nyár. & Zahn) Szeląg 2n = 3x = 27, H. porphyriticum A. Kern. 2n = 4x = 36, H. racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. racemosum 2n = 3x = 27, H. scardicum Borm. & Zahn 2n = 4x = 36, H. sparsum subsp. ipekanum Rech. fil. & Zahn 2n = 4x = 36, H. sparsum subsp. peristeriense Behr & Zahn, H. sparsum subsp. squarrosobracchiatum Behr & al. 2n = 3x = 27, H. tomosense Simk. 2n = 4x = 36, H. tubulare Nyár. 2n = 4x = 36, H. werneri Szeląg 2n = 3x = 27 and Pilosella fusca subsp. subpe- dunculata (Zahn) Szeląg, as well as five species of Hieracium sect. Cernua R. Uechtr. not described to date and a hybrid between H. bifidum s. lat. and H. pojoritense Woł. Key words: Asteraceae, chromosome numbers, Europe, Hieracium, karyotypes, Pilosella. INTRODUCTION In the genus Pilosella, determining the mode of reproduction on the basis of ploidy level is more com- Hieracium L. -

An Empirical Assessment of a Single Family‐Wide Hybrid Capture Locus
APPLICATION ARTICLE An empirical assessment of a single family-wide hybrid capture locus set at multiple evolutionary timescales in Asteraceae Katy E. Jones1,14 , Tomáš Fér2 , Roswitha E. Schmickl2,3 , Rebecca B. Dikow4 , Vicki A. Funk5 , Sonia Herrando-Moraira6 , Paul R. Johnston7,8,9, Norbert Kilian1 , Carolina M. Siniscalchi10,11 , Alfonso Susanna6 , Marek Slovák2,12 , Ramhari Thapa10,11, Linda E. Watson13 , and Jennifer R. Mandel10,11 Manuscript received 27 February 2019; revision accepted PREMISE: Hybrid capture with high-throughput sequencing (Hyb-Seq) is a powerful tool for 5 September 2019. evolutionary studies. The applicability of an Asteraceae family-specific Hyb-Seq probe set and 1 Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie the outcomes of different phylogenetic analyses are investigated here. Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6–8, 14195 Berlin, Germany 2 Department of Botany, Faculty of Science, Charles University, METHODS: Hyb-Seq data from 112 Asteraceae samples were organized into groups at differ- Benátská 2, CZ 12800 Prague, Czech Republic ent taxonomic levels (tribe, genus, and species). For each group, data sets of non-paralogous 3 Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences, Zámek 1, CZ loci were built and proportions of parsimony informative characters estimated. The impacts 25243 Průhonice, Czech Republic of analyzing alternative data sets, removing long branches, and type of analysis on tree reso- 4 Data Science Lab, Office of the Chief Information lution and inferred topologies were investigated in tribe Cichorieae. Officer, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20013-7012, USA RESULTS: Alignments of the Asteraceae family-wide Hyb-Seq locus set were parsimony infor- 5 Department of Botany, National Museum of Natural mative at all taxonomic levels. -

Field Release of the Hoverfly Cheilosia Urbana (Diptera: Syrphidae)
USDA iiillllllllll United States Department of Field release of the hoverfly Agriculture Cheilosia urbana (Diptera: Marketing and Regulatory Syrphidae) for biological Programs control of invasive Pilosella species hawkweeds (Asteraceae) in the contiguous United States. Environmental Assessment, July 2019 Field release of the hoverfly Cheilosia urbana (Diptera: Syrphidae) for biological control of invasive Pilosella species hawkweeds (Asteraceae) in the contiguous United States. Environmental Assessment, July 2019 Agency Contact: Colin D. Stewart, Assistant Director Pests, Pathogens, and Biocontrol Permits Plant Protection and Quarantine Animal and Plant Health Inspection Service U.S. Department of Agriculture 4700 River Rd., Unit 133 Riverdale, MD 20737 Non-Discrimination Policy The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs, marital status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual's income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) To File an Employment Complaint If you wish to file an employment complaint, you must contact your agency's EEO Counselor (PDF) within 45 days of the date of the alleged discriminatory act, event, or in the case of a personnel action. Additional information can be found online at http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_file.html. To File a Program Complaint If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form (PDF), found online at http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form. -

Distribution of Mountain Hawkweeds (Hieracium S. Str.)
ISSN 2336 - 3193 Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 66: 193 - 229, 2017 DOI: 10.1515/cszma - 2017 - 0024 Published: online 31 th January 2018, print Fe bruary 2018 Distribution of mountain hawkweeds ( Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains Jiří Kocián & Jindřich Chrtek Distribution of mountain hawkweeds ( Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 66: 193 - 229 , 201 7 . Abstract : Field revision of current distribution of mountain hawkweeds ( Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mts was undertaken. Hieracium atratum, H. chlorocephalum, H. engleri , H. grabow - skianum and H. plumbeum , whose last occurrence was documented many decades or even a century ago, were rediscovered. H. plumbeum was even found in new localities. The occurrence of H. alpinum, H. bifidum, H. chrysostyl oides, H. inuloides, H. nigritum, H. prenanthoides, H. silesiacum, H. stygium and H. villosum was ascertained at many of their historical localities and a few new localities were found too. A neophyte species H. mixtum was discovered. Hieracium moravicum w as not found. Accurate locality description and population size are provided for each finding. Herbarium revision and excerption of crucial literature were performed to provide historical distribution. Distributional changes as well as threatening and bene ficial factors influencing Hieracium species in the Hrubý Jeseník Mts are discussed. Key words : Hieracium , Hrubý Jeseník, distribution, field revision, rediscovery, mountain plants Introduction The Hrubý Jeseník Mountains (referred to below as “HJM“ , also as an adjective) are the second highest mountains range in the Czech Republic. Their botanical richness has been systematically studied for two centuries and current knowledge of the botanical richness of this area is at a high level (Bureš 2013). -

A Guide to Frequent and Typical Plant Communities of the European Alps
- Alpine Ecology and Environments A guide to frequent and typical plant communities of the European Alps Guide to the virtual excursion in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) Peter M. Kammer and Adrian Möhl (illustrations) – Alpine Ecology and Environments B1 – Alpine plant biodiversity Preface This guide provides an overview over the most frequent, widely distributed, and characteristic plant communities of the European Alps; each of them occurring under different growth conditions. It serves as the basic document for the virtual excursion offered in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) of the ALPECOLe course. Naturally, the guide can also be helpful for a real excursion in the field! By following the road map, that begins on page 3, you can determine the plant community you are looking at. Communities you have to know for the final test are indicated with bold frames in the road maps. On the portrait sheets you will find a short description of each plant community. Here, the names of communities you should know are underlined. The portrait sheets are structured as follows: • After the English name of the community the corresponding phytosociological units are in- dicated, i.e. the association (Ass.) and/or the alliance (All.). The names of the units follow El- lenberg (1996) and Grabherr & Mucina (1993). • The paragraph “site characteristics” provides information on the altitudinal occurrence of the community, its topographical situation, the types of substrata, specific climate conditions, the duration of snow-cover, as well as on the nature of the soil. Where appropriate, specifications on the agricultural management form are given. • In the section “stand characteristics” the horizontal and vertical structure of the community is described. -

Chromosome Numbers of Polish Hieracia (Asteraceae)
Polish Botanical Journal 50(2): 139–143, 2005 CHROMOSOME NUMBERS OF POLISH HIERACIA (ASTERACEAE) ZBIGNIEW SZELĄG & VLADIMIR VLADIMIROV Abstract. Chromosome numbers are given for the following species of Hieracium L. from Poland: subgenus Hieracium – H. barbatum Tausch (2n = 27), H. bupleuroides C. C. Gmelin (2n = 36), H. laevigatum Willd. (2n = 27), H. laurinum Arvet- Touvet (2n = 18), H. sabaudum L. (2n = 27, 36), H. umbellatum L. (2n = 18), H. villosum Jacq. (2n = 36); subgenus Pilosella (Hill.) Gray – H. lactucella Wallr. (2n = 18), H. schultesii F. W. Schultz (2n = 36). The chromosome number of H. barbatum is published for the fi rst time. The diploid number is reported for the fi rst time for H. laurinum. Except for H. umbellatum and H. villosum, the chromosome counts are reported for the fi rst time from Poland. Key words: Asteraceae, Hieracium, chromosome numbers, karyotypes, Poland Zbigniew Szeląg, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland; e-mail: [email protected] Vladimir Vladimirov, Institute of Botany, Bulgarian Academy of Sciences, 23, Acad. G. Bonchev St., Sofi a 1113, Bulgaria; e-mail: [email protected] INTRODUCTION Publications dealing with karyology of Polish alcohol (1:3) for at least 2 h at room temperature, vascular plants give only sparse data on repre- hydrolyzed in 1 M HCl for 20 min at 60°C, stained in sentatives of the genus Hieracium L. (Skalińska Gomori’s hematoxylin (Melander & Wingstrand 1953) et al. 1959, 1968, 1974; Skalińska 1967, 1970; for 30 min at 60°C, and fi nally squashed in 45% acetic acid. -

Untersuchungen Zum Einfluss Von Proteasen Auf Dieil-6
Untersuchungen von pflanzlichen Latices hinsichtlich ihrer Proteaseaktivität und deren Einfluss auf die Interleukin-6 Sekretion monozytischer Zellen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) eingereicht im Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin vorgelegt von Apotheker André Domsalla Berlin 2012 Erster Gutachter: Prof. Dr. Matthias F. Melzig Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Harshadrai M. Rawel Disputation am: 25.04.2012 Für meine Familie I Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................ VI I. Einleitung ................................................................................................................................ 1 I.1. Proteasen .......................................................................................................................... 1 I.1.1. Klassifizierung proteolytischer Enzyme .................................................................... 1 I.1.1.1. Serinproteasen .................................................................................................... 2 I.1.1.2. Cysteinproteasen ................................................................................................ 3 I.1.1.3. Aspartatproteasen ............................................................................................... 3 I.1.1.4. Metalloproteasen ................................................................................................ 3 I.1.2. -

Evolution of Apomixis Loci in Pilosella and Hieracium (Asteraceae) Inferred from the Conservation of Apomixis-Linked Markers in Natural and Experimental Populations
Heredity (2015) 114, 17–26 & 2015 Macmillan Publishers Limited All rights reserved 0018-067X/15 www.nature.com/hdy ORIGINAL ARTICLE Evolution of apomixis loci in Pilosella and Hieracium (Asteraceae) inferred from the conservation of apomixis-linked markers in natural and experimental populations ML Hand1,PVı´t2, A Krahulcova´2, SD Johnson1, K Oelkers1, H Siddons1, J Chrtek Jr2,3, J Fehrer2 and AMG Koltunow1 The Hieracium and Pilosella (Lactuceae, Asteraceae) genera of closely related hawkweeds contain species with two different modes of gametophytic apomixis (asexual seed formation). Both genera contain polyploid species, and in wild populations, sexual and apomictic species co-exist. Apomixis is known to co-exist with sexuality in apomictic Pilosella individuals, however, apomictic Hieracium have been regarded as obligate apomicts. Here, a developmental analysis of apomixis within 16 Hieracium species revealed meiosis and megaspore tetrad formation in 1 to 7% of ovules, for the first time indicating residual sexuality in this genus. Molecular markers linked to the two independent, dominant loci LOSS OF APOMEIOSIS (LOA) and LOSS OF PARTHENOGENESIS (LOP) controlling apomixis in Pilosella piloselloides subsp. praealta were screened across 20 phenotyped Hieracium individuals from natural populations, and 65 phenotyped Pilosella individuals from natural and experimental cross populations, to examine their conservation, inheritance and association with reproductive modes. All of the tested LOA and LOP-linked markers were absent in the 20 Hieracium samples irrespective of their reproductive mode. Within Pilosella, LOA and LOP-linked markers were essentially absent within the sexual plants, although they were not conserved in all apomictic individuals. Both loci appeared to be inherited independently, and evidence for additional genetic factors influencing quantitative expression of LOA and LOP was obtained. -
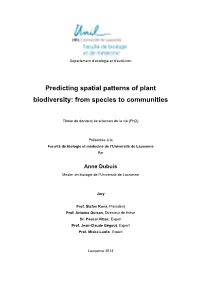
Predicting Spatial Patterns of Plant Biodiversity: from Species to Communities
Département d’écologie et d’évolution Predicting spatial patterns of plant biodiversity: from species to communities Thèse de doctorat ès sciences de la vie (PhD) Présentée à la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne Par Anne Dubuis Master en biologie de l’Université de Lausanne Jury Prof. Stefan Kunz, Président Prof. Antoine Guisan, Directeur de thèse Dr. Pascal Vittoz, Expert Prof. Jean-Claude Gégout, Expert Prof. Miska Luoto, Expert Lausanne 2013 SUMMARY Understanding the distribution and composition of species assemblages and being able to predict them in space and time are highly important tasks to investigate the fate of biodiversity in the current global changes context. Species distribution models are tools that have proven useful to predict the potential distribution of species by relating their occurrences to environmental variables. Species assemblages can then be predicted by combining the prediction of individual species models. In the first part of my thesis, I tested the importance of new environmental predictors to improve species distribution prediction. I showed that edaphic variables, above all soil pH and nitrogen content could be important in species distribution models. In a second chapter, I tested the influence of different resolution of predictors on the predictive ability of species distribution models. I showed that fine resolution predictors could ameliorate the models for some species by giving a better estimation of the micro-topographic condition that species tolerate, but that fine resolution predictors for climatic factors still need to be ameliorated. The second goal of my thesis was to test the ability of empirical models to predict species assemblages’ characteristics such as species richness or functional attributes. -

Morphological and Karyological Charakterisation Hieracium
6TH HIERACIUM WORKSHOP 17–24 July 2002 HIRSCHEGG (AUSTRIA) Hieracium in Croatia: an overview According to the ”Index Florae Croaticae” (PLAZIBAT 2000) genus Hieracium is represented by 141 species in Croatia. Endemic to this country are at least the following species : ● H. falcatiforme Degen & Zahn ● H. leucopelmatum Naeg. & Peter ● H. malovanicum Degen & Zahn ● H. mirificissimum Rohl. & Zahn ● H. obrovacense Degen & Zahn ● H. velebiticum Degen & Zahn A further series of taxa not known to occur elsewhere (numbering at least 20), were described from Croatia in the rank of subspecies, the great majority of them being representatives of subgen. Hieracium. All those endemic taxa had been described in the period from 1854 to 1935. Most of them had been described by K. H. Zahn and his collaborators (A. v. Degen, K. Malý, J. Rohlena) who had investigated floristically the area of the present territory of Croatia since 1906 (cf. Zahn 1922–1938). Six taxa had previously been described by Nägeli & Peter (1885, 1886), and further five species by other authors (L. Vukotinović, G. Beck, R. V. Uechtritz, J. Freyn). Since 1935, no new research is known on Hieracium in Croatia. For most of the endemic taxa any information still is restricted to the diagnosis. Only 12 Croatian endemic taxa were mentioned in the ”Flora Europaea” (SELL & WEST 1976). Additional data relating to distri- bution, ecology and phytosociology is lacking as well as recent taxonomic researches and nomenclature revisions. Antun Alegro, Zlatko Liber, Ivana Sočo, Petra Cigić CONTRIBUTION ABSTRACTS 3 6TH HIERACIUM WORKSHOP 17–24 July 2002 HIRSCHEGG (AUSTRIA) A case of reversal: the evolution and maintenance of sexuals from parthenogenetic clones in Hieracium pilosella, an invasive weed of New Zealand We provide evidence for the evolution of sexual populations from parthenogenetic (apo- mictic) progenitors, in the adventive invasive polyploid, Hieracium pilosella.