UVP Bericht Mark Landin Fassung Zur Offenlegung Text
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
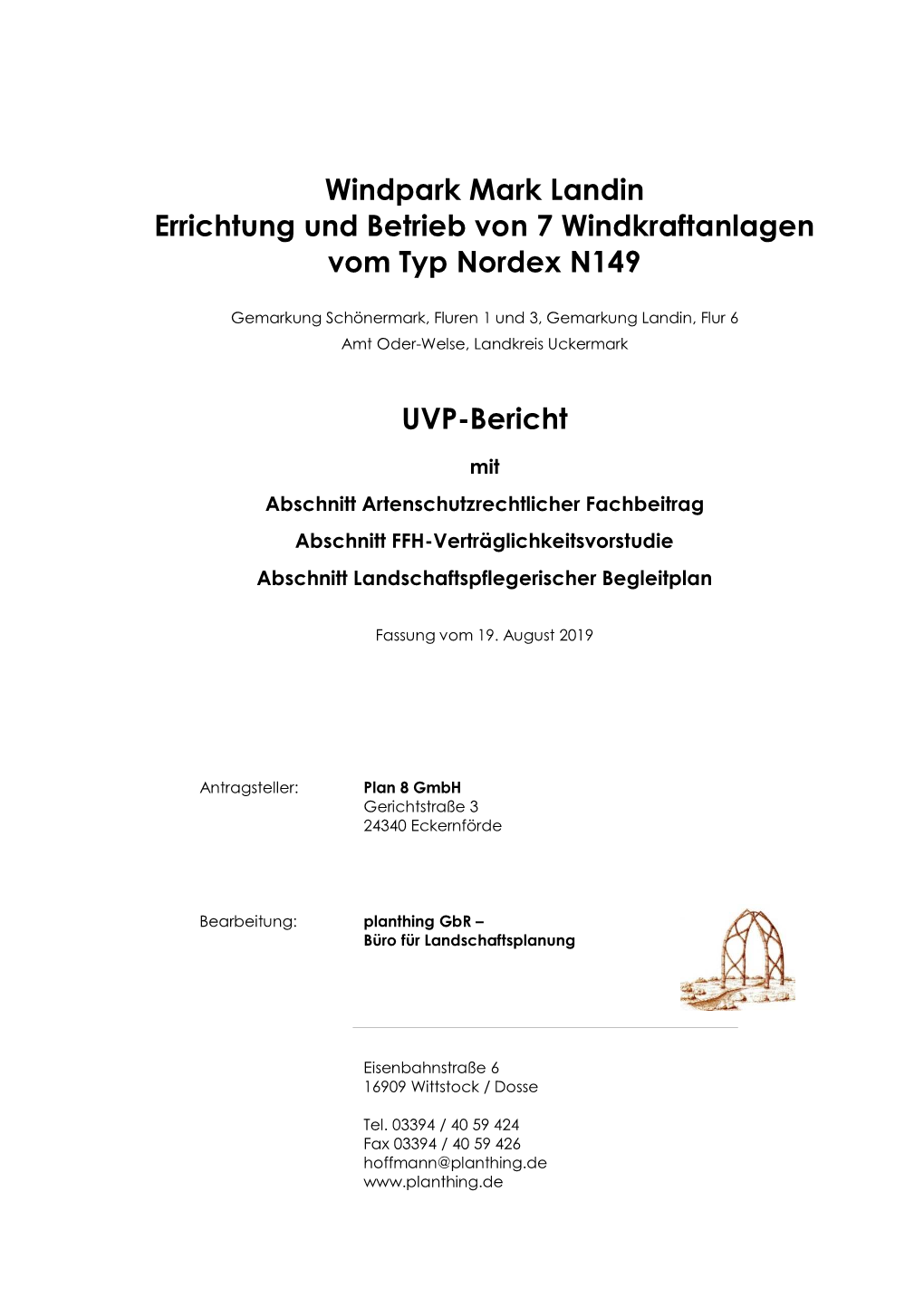
Load more
Recommended publications
-

0B 403 Prenzlau > Gramzow > Schwedt Gültig Ab 13.12.2020
0b 403 Prenzlau > Gramzow > Schwedt UVG gültig ab 13.12.2020 0b 403 0b 403 Montag - Freitag Fahrtnummer 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 Verkehrshinweise S F S F S F S b b b b b b b b b Prenzlau, ZOB ab 4.45 6.00 6.10 7.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 13.10 14.10 15.10 15.10 16.10 17.10 – Alte Sparkasse 4.46 6.01 6.11 7.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 13.11 14.11 15.11 15.11 16.11 17.11 – Baustraße 4.47 6.02 6.12 7.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 13.12 14.12 15.12 15.12 16.12 17.12 – Grabowstr. | | 6.14 7.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 13.14 14.14 15.14 15.14 16.14 17.14 – Schwedter Str. 4.48 6.03 6.16 7.16 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 13.16 14.16 15.16 15.16 16.16 17.16 – Einkaufszentrum 4.49 6.04 6.17 7.17 7.17 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 13.17 14.17 15.17 15.17 16.17 17.17 Prenzlau, Angermünder Str. -

… Simply Beautiful About the Uckermark
… Simply beautiful About the uckermArk Area: 3,o77 km2 ++ Population: 121,o14 ++ Population density: 39 inhabitants per km2 – one of the most sparsely populated areas in Germany ++ 5 % of the region is covered by water (compared with 2.4 % of Germany as a whole) ++ The Uckermark border to Poland runs mainly along the River Oder and is 52 km long. the uckermark – naturally What we want to do: Eco-friendly holidays Enable low-impact tourism close to nature Ensure products and services are high quality Create lasting natural and cultural experiences Generate value for the region What you can do: Treat nature with respect Buy regional products With its freshwater lakes, woodland swamps, Stay in climate-friendly accommodation natural river floodplains, and rare animals and Go by train, bicycle, canoe or on foot, and plants, almost half of the Uckermark is desig- treat your car to a break nated a protected landscape. We want to safe- guard this landscape for future generations. Our nature park and national park partners feel a close connection to these conservation areas, run their businesses sustainably and focus on high-quality services, including guid- ed canoe trips, eco-friendly accommodation, and regional cuisine. As winners of the Germany-wide competition holidaying in the uckermark: 1 Taking a break in the Uckermark Lakes Nature Park 2 Horses in the Uckermark meadows for sustainable tourism, we strive to achieve 3 Relaxing with a book by the Oberuckersee lake near Potzlow 4 Discovering nature 5 Places with history 6 Regional products long-term, sustainable goals. Large image: Canoe trip in the Lower Oder Valley National Park – starting off near Gartz 2 The Uckermark – naTURALLY The Uckermark – naTURALLY 3 enjoy nature Space to breathe NAture protectioN zoNes ANd LAkes The Uckermark Lakes Natural Park is a huge net- work of lakes with 1oo km of waterways for canoeists, more than 5o freshwater lakes and optimal nesting condi- tions for ospreys. -

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

AGRARINVESTOREN in BRANDENBURG Die Größten
AGRARINVESTOREN IN BRANDENBURG Die größten Holdings außerlandwirtschaftlicher Kapitalanleger – eine grobe Übersicht, zusammengestellt nach Angaben und Hinweisen der Mitglieder des Bauernbundes in Brandenburg ODEGA: ca. 5,4 Millionen Euro Direktzahlungen Über deren finanziellen Hintergrund kann nur spekuliert werden. In der Vergangen- heit bestanden Verbindungen zum Landhandel Märka, der inzwischen vom Biokraft- stoffhersteller Verbio übernommen wurde. Agrarbetriebe u. a. in • 16792 Badingen (Oberhavel) • 16230 Grüntal (Barnim) • 16356 Schönfeld (Barnim) • 16307 Staffelde (Uckermark) • 15306 Sachsendorf (Märkisch Oderland) • 15320 Neuhardenberg (Märkisch Oderland) • 15324 Groß Neuendorf (Märkisch Oderland) • 15324 Letschin (Märkisch Oderland) • 15324 Kienitz (Märkisch Oderland) • 15328 Golzow (Märkisch Oderland) • 15328 Rathstock (Märkisch Oderland) • 15328 Alt Tucheband (Märkisch Oderland) • 15328 Reitwein (Märkisch Oderland) • 15345 Prötzel (Märkisch Oderland) KTG Agrar: ca. 5,0 Millionen Euro Direktzahlungen Börsennotiertes Agrarunternehmen für Finanzanleger mit Sitz in Hamburg Internet: ktg-agrar.de Agrarbetriebe u. a. in • 16949 Putlitz (Prignitz) • 16515 Papenbruch (Ostprignitz-Ruppin) • 16909 Herzsprung (Ostprignitz-Ruppin) • 16818 Wuthenow (Ostprignitz-Ruppin) • 16515 Oranienburg (Oberhavel) • 16515 Germendorf (Oberhavel) • 15306 Marxdorf (Märkisch Oderland) • 15306 Sietzing (Märkisch Oderland) • 15306 Falkenhagen (Märkisch Oderland) • 15326 Podelzig (Märkisch Oderland) • 15377 Waldsieversdorf (Märkisch Oderland) • 03229 Altdöbern -

Schwedt Leben
Januar 2020 | Ausgabe 1 ! Stadtjournal SCHWEDTerLEBEN Das „Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder“ als Beilage zum Herausnehmen! INHALT Was passiert mit der ehemaligen 2 Neuer Mietspiegel erschienen Grundschule Ehm Welk? 3 24. Sportlerball EINLADUNG ZUR DISKUSSION AM 18. FEBRUAR 2020 4 Fairplay Soccer Tour 2020 in Schwedt 4 Kinderfasching im „Kosmonaut“ 5 Winterferien im Stadtmuseum 5 „Eilhard Lubin – Unbekannte Wege“ 6 Gedanken zum Leben in der DDR 6 Glasfaserausbau für Ihr Zuhause 7 Wer ist der beste Vorleser oder die beste Vorleserin? 8 „Montagskonzerte im Für eine neue Nutzung muss das Schulgebäude umgebaut und saniert werden und könnte Berlischky-Pavillon 2020“ einmal so aussehen. 8 Internationaler Zeichenwettbewerb Die Stadt Schwedt/Oder hat im vorigen Jahr das Architektur- und 10 Veranstaltungen Ingenieurbüro Prüfer & Wilke beauf- 12 Elke Ring – Was bleibt! tragt, die Nachnutzung der leerstehen- den Grundschule „Ehm Welk“ in der 13 Jubiläen Leverkusener Straße, nahe der neuen Festwiese, zu untersuchen. Bei dem Schulgebäude handelt es sich um ein 4-geschossiges Gebäude mit ca. 4.000 m² STADTVERWALTUNG SCHWEDT/ODER Fläche. Ab 2015 wurde das Gebäude Das zurzeit ungenutzte Schulgebäude in der Allgemeine Sprechzeiten zeitweise als Wohnheim für Asylbewer- Leverkusener Straße wurde in den 1980er- Dienstag 9–12 und 13–18 Uhr ber genutzt. Aktuell (noch bis zum Jahren errichtet und 2017 nur minimal Donnerstag 9–12 und 13–15 Uhr 14. Februar 2020) wird der Entwurf saniert. Freitag 9–12 Uhr dieser Machbarkeitsstudie zur Nachnut- Meldebehörde und Bürgerberatung zung der ehemaligen Grundschule in der schen Stadtverwaltung (als Auftrag - zusätzlich Montag 9–12 Uhr Alten Fabrik öffentlich ausgelegt. Auch geber) und einigen möglichen Nutzern Standesamt Freitag geschlossen im Internet unter www.schwedt.eu des Gebäudes sind bereits erfolgt. -

Alle Infos Zum Download Hier
Stadtwerke Schwedt GmbH Heinersdorfer Damm 55-57 16303 Schwedt/Oder Pressemeldung Schwedt/Oder, den 30.07.2021 Uckermark profitiert von der Datenautobahn Glasfaser Infomobil der Stadtwerke Schwedt berät vor Ort Rund 10.000 Haushalte in 33 Gemeinden profitieren vom Förderprojekt von Bund, Land und Landkreis und bekommen die Glasfaser kostenfrei direkt ins Haus gelegt. Der Anschluss verspricht störungsfreies Internet und – mit dem richtigen Produkt – uneingeschränktes Surfvergnügen und schnelle symmetrische Up- und Download- Geschwindigkeiten. Ein Quantensprung für alle geförderten Haushalte, die sich bisher mit Internetgeschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit/s begnügen mussten. Für das gigabitschnelle Internet kommen mehr als 1.600 Kilometer Kabeltrasse in den Boden. Die Vermarktung, Planung und Umsetzung des geförderten Ausbaus liegen in der Hand der e.discom Telekommunikation GmbH und dessen Kooperationspartner, den Stadtwerken Schwedt. Die Stadtwerke Schwedt sind in den kommenden Wochen im Landkreis unterwegs, um interessierte Bürger zum Ausbau in der Region, zur Glasfasertechnik und die passenden Internetprodukte zu informieren. Das grüne Infomobil macht an folgenden Orten Station: Wochenmarkt Templin Am Markt 19, 17268 Templin Dienstag 03.08.2021, 09:00 - 15:00 Uhr Dienstag 17.08.2021, 09:00 - 15:00 Uhr Dienstag 14.09.2021, 09:00 - 15:00 Uhr Wochenmarkt Lychen Am Markt 1, 17279 Lychen Mittwoch 04.08.2021, 08:00 – 13:00 Uhr Mittwoch 18.08.2021, 08:00 - 13:00 Uhr Mittwoch 15.09.2021, 08:00 - 13:00 Uhr Wochenmarkt Angermünde Markt, -

Inhaltsverzeichnis Des Amtlichen Teils
Schwedt/Oder, Mittwoch, den 26. Januar 2011 20. Jahrgang, Ausgabe 1/2011 Winterspaziergang am Schwedter Bollwerk mit Blick auf die Stadtbrücke Inhaltsverzeichnis des amtlichen Teils Zahlungserinnerung ................................................................. Seite 2 Öffentliche Bekanntmachung Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung Öffentliche Bekanntmachung zum Anhörungstermin für die Nebenbeteiligten ........................ Seite 5 Erläuterung und Auslegung der 1. Änderung zu den Ergebnissen zur Wertermittlung ..................................... Seite 2 Öffentliche Bekanntmachung im Bodenordnungsverfahren Biesenbrow Orts- und Feldlage, Öffentliche Bekanntmachung – 4. Änderungsbeschluss ............. Seite 3 AZ.: 5-005-F und 5 004-F – Einladung zur Teilnehmerversammlung ..................................... Seite 6 Öffentliche Bekanntmachung Niederschrift zur Teilnehmerversammlung _16.12.2010_FL Süd 2 und OL Stolpe, Gellmersdorf, Crussow und Neuhof .......... Seite 5 Das Amtsblatt der Stadt Schwedt/Oder erscheint in ausreichender Auflage nach Bedarf, mindestens monatlich. Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes ist die Stadt Schwedt/Oder, Der Bürgermeister, Lindenallee 25-29, 16303 Schwedt/Oder, Telefon 03332 446-205. Das Amtsblatt wird an alle Schwedter Haushalte einschließlich aller Ortsteile verteilt. Weitere Exemplare liegen im Rathaus und Rathaus Haus 2 zur Mitnahme aus. Interessierte Firmen, Bürger und Institutionen haben die Möglichkeit, es gegen Übernahme der Portogebühren per Abonnement -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

Schwedt Leben
Juli 2019 | Ausgabe 7 ! Stadtjournal SCHWEDTerLEBEN Das „Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder“ als Beilage zum Herausnehmen! INHALT Für ein wunderbares 2 Stadtfest 2020 in Vorbereitung 3 Nachhaltiger Wassertourismus Mittsommernachtsfest im Unteren Odertal BÜRGERMEISTER DANKT ALLEN HELFERN 4 Business-Hotel am Bollwerk geplant Traditionell feiern die 4 Grünstreifen in der Schwedterinnen und Nationalparkstadt Schwedter den längsten 5 Zerstörte Gedenktafel Tag des Jahres mit einem im Stengerhain leuchtenden Fest ver- streut in der Altstadt bis 5 Unerlaubte Entsorgung an den Uferbereich. Jedes von Müll und Grünschnitt Jahr stellt sich das Organi- 6 Internationaler sationsteam dieser Zeichenwettbewerb Herausforderung von der Programmgestaltung und 7 Sommer in der Stadtbibliothek Konzertkoordinierung 8 Neue Kurse der Volkshochschule über die logistische und technische Beaufsichti- 9 26 Jahre Tabakblütenfest gung bis hin zum indivi- in Vierraden duellen Ordnungs- und Das 15-minütige Feuerwerk erhielt sogar Applaus. 10 13,2 Millionen für die Sicherheitssystem. Uckermärkischen Bühnen Ich bedanke mich herzlich bei der rieplanungs- und Beratungs GmbH, 11 28. Internationales Arbeitsgruppe Mittsommernacht, WOBAG Schwedt eG, Arbeitssicherheit Landschaftspleinair insbesondere bei dem MomentUM e. V., & Brandschutz M. Naß, Asklepios der Musik- und Kunstschule „J. A. P. Klinikum Uckermark, KSB Service GmbH 12 Neue Ärzte für Schwedt Schulz“, der Evangelischen Kirchenge- Schwedt/Oder, Augentagesklinik 13 Die Uckermark on Tour meinde, dem Stadtmuseum, den Ucker- Konstanze Fischer, VR-Bank Ucker- märkischen Bühnen, dem Kunstverein, mark-Randow eG. 16 Veranstaltungen der AG Jugend sowie allen beteiligten Getanzt und gefeiert wurde auf den Vereinen, ehrenamtlichen Helfern und Plätzen der Innenstadt, dem Alten Akteuren. Mit ihren kreativen Ideen, Markt und an der Uferpromenade bis in einer großen Portion Engagement und die Nacht hinein. -

Amtlicher Teil in Dieser Ausgabe: Seiten 2 Bis 8
Pinnow, 10. Januar 2021 Nummer 1 | 31. Jahrgang | Woche 1 Amtlicher Teil in dieser Ausgabe: Seiten 2 bis 8 Hüllensanierung des ehemaligen Landarbeiterhauses in Pinnow abgeschlossen Bericht auf Seite 11 Herausgeber: Amt Oder-Welse – Die Amtsverwaltung | Gutshof 1, 16278 Pinnow | Telefon: (03 33 35) 7 19-0 | Fax: (03 33 35) 7 19 40 Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: • kostenlose Verteilung an die Haushalte der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Oder-Welse • kostenlose Abgabe während der öffentlichen Sprechzeiten beim Amt Oder-Welse, Gutshof 1, 16278 Pinnow • auf Antrag Versendung gegen Erstattung der Versand-/Zustellungskosten | 2 | 10. Januar 2021 | Nr. 1 | Woche 1 AMTSBLATT für das Amt Oder-Welse Inhaltsverzeichnis I. Amtlicher Teil • Bekanntmachung über den Jahresabschluss der Gemeinde Schöneberg per 31.12.2019 ............................................................................Seite 3 • Bekanntmachung über die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Oder-Welse für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Schöneberg ..............................................................................................................................................................................Seite 3 Informationen aus den Sitzungen • Informationen aus der Amtsausschusssitzung vom 24.11.2020 ....................................................................................................................Seite 3 • Informationen aus der Amtsausschusssitzung vom 15.12.2020 ....................................................................................................................Seite -

ANGERMÜNDER NACHRICHTEN | Ausgabe 3 | 19
19. März 2021 | Woche 11 Beilage in dieser Ausgabe Nummer 3 | 31. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Angermünde | Nr. 3/2021 E-Lastenanhänger „Carla Cargo“ als Transportmöglichkeit testen Neue Angebote und Entwicklungen für den Radverkehr in Angermünde Lastenfahrräder und -anhänger können vor allem im hinaus wird gerade ein Beschluss durch die zwei Fraktionen Stadtverkehr eine Transport-Alternative mit vielen Vortei- Bündnis 90/Die Grünen und CDU auf den Weg gebracht, mit len sein. Doch noch sind die innovativen Räder im Angermün- dem die Stadt zukünftig elektrische Lastenfahrräder anschaffen der Stadtbild eine Seltenheit. Die Stadtverwaltung bietet und kostenlos zur Verfügung stellen kann. Angermünder Unternehmen nun einen Elektro-Lastenanhän- Carla Cargo heißt der mit einem Elektromotor betriebene ger kostenlos zur Probe an. „Und auch die Verwaltung selbst Anhänger, den man als Handwagen mit bis 6 km/h oder als testet nun erste Anwendungsmöglichkeiten für die eigenen Fahrradunterstützung bis 25 km/h nutzen kann und der ab Aufgabenbereiche“, so Bürgermeister Frederik Bewer. Darüber sofort bei der Stadt zum Kennenlernen bereitsteht. >> Seite 4 ANZEIGEN | 2 | ANGERMÜNDER NACHRICHTEN | Ausgabe 3 | 19. März 2021 Mitmachen: Angebote fürs Agenda-Diplom melden Sommerdiplom in Angermünde findet auch 2021 wieder statt Sommerferien mit Mehrwert soll es und wird seit 2018 in Angermünde Auch die Stadtverwaltung bietet in auch in diesem Jahr wieder in umgesetzt. Vor den Sommerferien jedem Jahr eigene Veranstaltungen an. Angermünde geben. Die Stadt setzt 2021 erhalten alle Schulkinder der Angermün- Ob eine Tour durchs Rathaus mit dem in Zusammenarbeit mit der Volkssolida- der Grundschulen eine Broschüre mit Bürgermeister, Archäologische Ausgra- rität Uckermark wieder das Agenda-Dip- bungen mit dem Museumsteam oder lom um und spricht jetzt Unternehmen Rätselabenteuer im Stadtarchiv – die und Organisationen an, Angebote zu Kinder sollen die Vielfalt ihrer Stadt entwickeln und den Organisatoren zu kennenlernen und Dinge entdecken, die melden. -

16. Kranichwoche Im Nationalpark Unteres Odertal
Willkommen bei den Nationalpark-Partnern! www.anitas-eisstube.de www.dorotheenhof-mescherin.de www.erholung-uckermark.de www.ferienwohnung-tabakbluete.de www.flusslandschaft-reisen.de www.fuchsundhase-fahrradcafe.de www.kunstbauwerk.de www.landhotel-felchow.de www.linde-criewen.de www.pensionzummuehlenteich.de www.pommernstube-gartz.de WISSENSWERTES www.salveymuehle.de www.schwedt-hotel.de Haben Sie Fragen, Ideen, Anmerkungen? www.schweizerhaus-stolpe.de Unser Kranichteam ist ab dem 2. Oktober täglich für Sie da: Weitere Partner des Nationalparks unter: • 11:00 - 17:00 Uhr im Infozelt Gartz (Oder): www.nationalpark-unteres-odertal.eu Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, 16307 Gartz (Oder), Telefon: 0172 387 5390 Die Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal ist eine • 10:00 - 21:00 Uhr im Dorotheenhof Mescherin: Untere Gemeinschaftsveranstaltung von: Dorfstraße 13, 16307 Mescherin, Telefon: 033332 807 26 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Informationen zur Anreise unter www.uvg-online.de Amt/Stadt Gartz oder telefonisch 03332 442 670 Shuttleservice jeweils Sa. + So. 11:30 Uhr von Bahnhof Tantow nach Gartz (Oder), und 19:50 Uhr von Gartz (Oder) nach Tantow, Fahrservice Pahl, nur mit Voranmeldung unter: infrastruktur projektmanagement GmbH Telefon: 0172 3836401 Projektmanagement Projektträgerschaft Standortentwicklung Innovation Alle Informationen zur Anreise mit dem Zug unter Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung www.bahn.de, www.nationalpark-unteres-odertal.eu Park 2, 16303 Schwedt/Oder, OT Criewen Telefon: 03332 26770 PROGRAMM Informationen zu Ihrem Aufenthalt www.nationalpark-unteres-odertal.eu • MomentUM e.V. unter Telefon: 03332 2559-0 oder 16. Kranichwoche im Nationalpark MomentUM e. V. [email protected] Vierradener Straße 31, 16303 Schwedt/Oder Unteres Odertal 01.