Transzendentalliberalismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
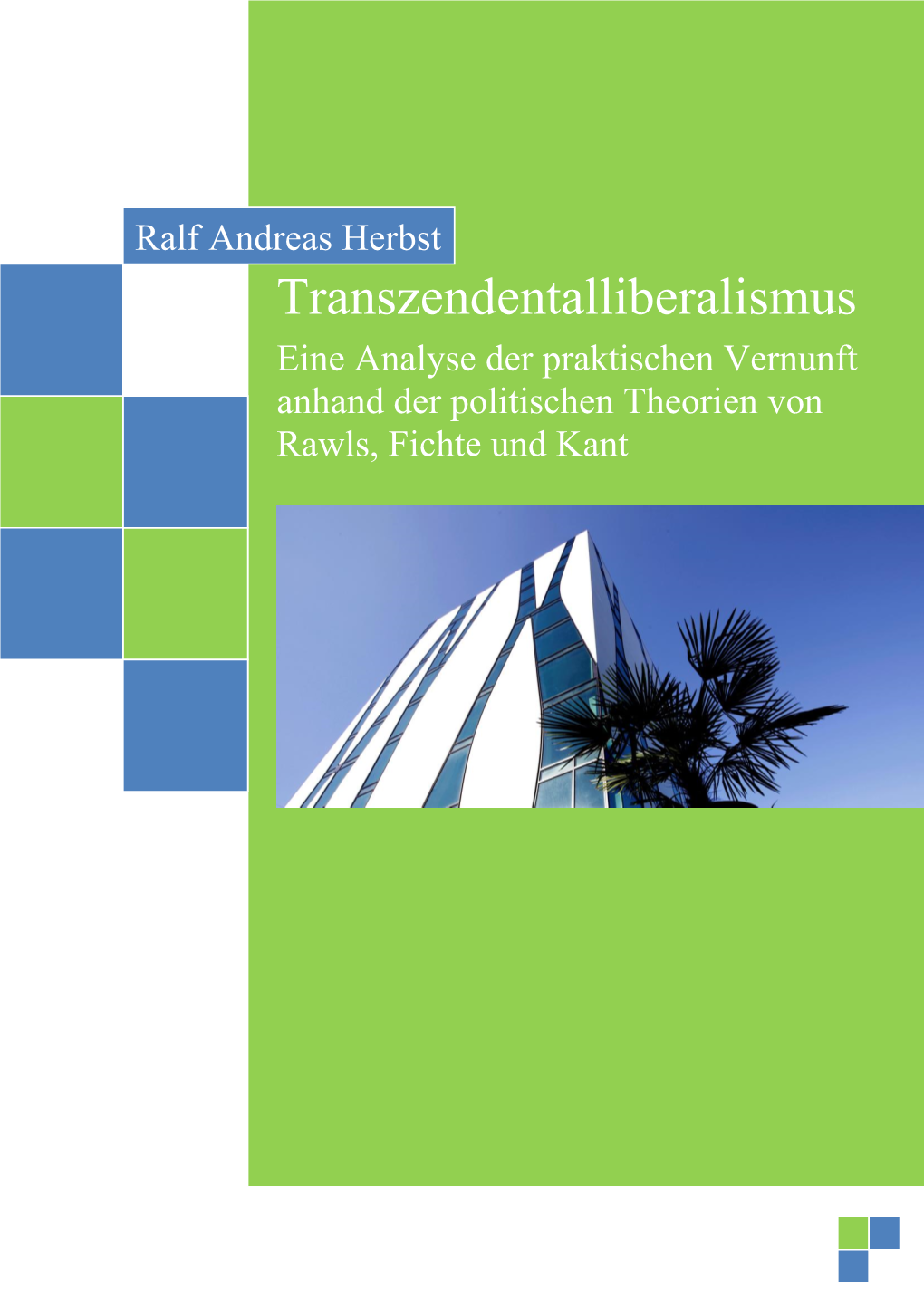
Load more
Recommended publications
-

German Idealism by Espen Hammer
GERMAN IDEALISM German Idealism is one of the most important movements in the history of philosophy. It is also increasingly acknowledged to contain the seeds of many current philosophical issues and debates. This outstanding collection of spe- cially commissioned chapters examines German idealism from several angles and assesses the renewed interest in the subject from a wide range of fields. Including discussions of the key representatives of German idealism such as Kant, Fichte and Hegel, it is structured in clear sections dealing with: metaphysics the legacy of Hegel’s philosophy Brandom and Hegel recognition and agency autonomy and nature the philosophy of German romanticism Amongst other important topics, German Idealism: Contemporary Perspectives addresses the debates surrounding the metaphysical and epistemological legacy of German idealism; its importance for understanding recent debates in moral and political thought; its appropriation in recent theories of language and the relationship between mind and world; and how German idealism affected sub- sequent movements such as romanticism, pragmatism, and critical theory. Contributors: Frederick Beiser, Jay Bernstein, Andrew Bowie, Richard Eldridge, Manfred Frank, Paul Franks, Sebastian Gardner, Espen Hammer, Stephen Houlgate, Terry Pinkard, Robert Pippin, Paul Redding, Fred Rush, Robert Stern. Espen Hammer is Professor of Philosophy at the University of Oslo and a Reader in Philosophy at the University of Essex. He is the author of Adorno and the Political (Routledge, 2006). GERMAN IDEALISM Contemporary Perspectives Edited by Espen Hammer First published 2007 by Routledge 2 Milton Park Square, Milton Park, Abingdon, OX14 4RN Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. -

The Social Philosophy of Gillian Rose: Speculative Diremptions, Absolute Ethical Life
Durham E-Theses The Social Philosophy of Gillian Rose: Speculative Diremptions, Absolute Ethical Life BROWER-LATZ, ANDREW,PHILLIP How to cite: BROWER-LATZ, ANDREW,PHILLIP (2015) The Social Philosophy of Gillian Rose: Speculative Diremptions, Absolute Ethical Life, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/11302/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 The Social Philosophy of Gillian Rose: Speculative Diremptions, Absolute Ethical Life by Andrew Brower Latz Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Theology and Religion Durham University 2015 ii Abstract This thesis provides an original reconstruction of Gillian Rose’s work as a distinctive social philosophy within the Frankfurt School tradition that holds together the methodological, logical, descriptive, metaphysical and normative moments of social theory; provides a critical theory of modern society; and offers distinctive versions of ideology critique based on the history of jurisprudence, and mutual recognition based on a Hegelian view of appropriation. -

EBUPT180342.Pdf
GERMAN IDEALISM German Idealism is one of the most important movements in the history of philosophy. It is also increasingly acknowledged to contain the seeds of many current philosophical issues and debates. This outstanding collection of spe- cially commissioned chapters examines German idealism from several angles and assesses the renewed interest in the subject from a wide range of fields. Including discussions of the key representatives of German idealism such as Kant, Fichte and Hegel, it is structured in clear sections dealing with: metaphysics the legacy of Hegel’s philosophy Brandom and Hegel recognition and agency autonomy and nature the philosophy of German romanticism Amongst other important topics, German Idealism: Contemporary Perspectives addresses the debates surrounding the metaphysical and epistemological legacy of German idealism; its importance for understanding recent debates in moral and political thought; its appropriation in recent theories of language and the relationship between mind and world; and how German idealism affected sub- sequent movements such as romanticism, pragmatism, and critical theory. Contributors: Frederick Beiser, Jay Bernstein, Andrew Bowie, Richard Eldridge, Manfred Frank, Paul Franks, Sebastian Gardner, Espen Hammer, Stephen Houlgate, Terry Pinkard, Robert Pippin, Paul Redding, Fred Rush, Robert Stern. Espen Hammer is Professor of Philosophy at the University of Oslo and a Reader in Philosophy at the University of Essex. He is the author of Adorno and the Political (Routledge, 2006). GERMAN IDEALISM Contemporary Perspectives Edited by Espen Hammer First published 2007 by Routledge 2 Milton Park Square, Milton Park, Abingdon, OX14 4RN Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. -

Jean-Fran\:Ois Lyotard the Postmodern Condition: a Report On
Jean-Fran\:ois Lyotard The Postmodern Condition: A Report on Knowledge Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi Foreword by Fredric Jameson Theory and History of Literature, Volume IO The Postmodern Condition Theory and History of Literature Edited by Wlad Godzich and Jochen Schulte-Sasse Volume 1. Tzvetan Todorov Introduction to Poetics Volume 2. Hans Robert Jauss To ward an Aesthetic of Reception Volume 3. Hans Robert Jauss Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics Volume 4. Peter Burger Theory of the Avant-Garde Volume 5. Vladimir Propp Theory and History of Folklore Volume 6. Edited by Jonathan Arac, Wlad Godzich, and Wallace Martin The Yale Critics: Deconstruction in America Volume 7. Paul de Man Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism 2nd ed., rev. Volume 8. Mikhail Bakhtin Problems of Dostoevsky's Poetics Volume 9. Erich Auerbach Scenes from the Drama of European Literature Volume 10. Jean-Frarn;ois Lyotard The Postmodern Condition: A Report on Knowledge The Posttnodern Condition: A Report on Knowledge Jean-Fran�ois Lyotard Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi Foreword by Fredric Jameson Theory and History of Literature, Volume 10 M IN NE so TA University of Minnesota Press, Minneapolis This book wasoriginally published in France as LaCondition postmoderne: rapport sur le savoir, copyright © 1979 by Les Editions de Minuit. English translation and Foreword copyright© 1984 by the University of Minnesota. All rights reserved. Published by the University of Minnesota Press 111 Third Avenue South, Suite 290, Minneapolis, MN 55401-2520 http://www.upress.umn.edu Printed in the United States of America on acid-free paper Library of Congress Cataloging in PublicationData Lyotard, Jean Fran�ois. -

The Emancipative Theory of Jürgen Habermas and Metaphysics
Cultural Heritage and Contemporary Change Series I. Culture and Values, Volume 13 The Emancipative Theory of Jürgen Habermas and Metaphysics by Robert Peter Badillo The Council for Research in Values and Philosophy 1 Copyright © 1991 by The Council for Research in Values and Philosophy Gibbons Hall B-20 620 Michigan Avenue, NE Washington, D.C. 20064 All rights reserved Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Badillo, Robert P. The emancipative theory of Jürgen Habermas and metaphysics / Robert P. Badillo. p.cm. — (Cultural heritage and contemporary change. Series I. Culture and values ; vol. 13) Includes bibliographical references and index. 1. Habermas, Jürgen. 2. Communication—Philosohpy. 3. Metaphysics. 4. Thomas Aquinas, Saint, 1225?-1274—Contributions in metaphysics. I. Title. II. Series ; Cultural heritage and contemporary change. Series I. Culture and values ; vol. 13. B3258.H234B33 1991 91-58112 110—dc21 CIP ISBN 1-56518-042-9 (pbk.) 2 Table of Contents Preface ix Introduction 1 Chapter I. The Objectivist/Relativist Dichotomy:The Habermasian Alternative 3 Bernstein's Practical Alternative Habermas’ Theoretical Alternative The Metaphysical Alternative Chapter II.The Theory of the Cognitive Interests:Primacy of the Emancipatory Interest 27 Preliminary Issues The Theory of Cognitive Interests The Primacy of the Emancipatory Interest Chapter III. The Theory of Universal Pragmatics:The Methodological Framework 55 Reconstruction of Consensual Speech The Discourse Theory of Truth Limits of -
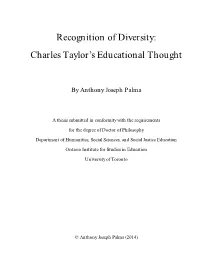
Recognition of Diversity: Charles Taylor's Educational Thought
Recognition of Diversity: Charles Taylor’s Educational Thought By Anthony Joseph Palma A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Humanities, Social Sciences, and Social Justice Education Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto © Anthony Joseph Palma (2014) RECOGNITION OF DIVERSITY: CHARLES TAYLOR’S EDUCATIONAL THOUGHT Doctor of Philosophy (2014) Anthony Joseph Palma Department of Humanities, Social Sciences, and Social Justice Education University of Toronto Abstract This study focuses on Charles Taylor’s educational thought with a view to understanding his contributions to the discipline of Philosophy of Education. No comprehensive study of Charles Taylor’s educational thought has been attempted. There is a single dissertation and a dozen or so published periodical articles that do take Taylor’s educational views into consideration, to be sure. Yet these studies, which limit themselves to Taylor’s account of the recognition and/or non-recognition of identity in multicultural societies, are insufficient on five accounts: i) they are indifferent to the historical nature of Taylor’s scholarly work; ii) they neglect the philosophical sources of his educational thought; iii) they fail to highlight the interconnections between the key educational themes he takes up; iv) they disregard his major critics and the dialectical tensions raised by these critics; and v) they are somewhat dated in that they do not consider his more recent scholarship. My dissertation seeks to fill these scholarly gaps. My thesis is that an inner logic is implicit in Charles Taylor’s educational thought. I argue that Taylor’s views on the modern condition, (i.e. -

Critique Betrayal
CRITIQUE CRITIQUE BETR AYAL RobeRt beRnasconi This first volume in a new EDITED BY bRenna bhandaR series of books from the archive AUSTIN GROSS FRançoise collin of the British journal Radical MATT HARE Philosophy reflects upon the MARIE LOUISE KROGH simon cRitchley rich and troubled history of PeneloPe deutscheR the Enlightenment concept of meena dhanda critique as it has been extended, haRRy haRootunian transformed, translated and Pauline Johnson betrayed in Marxism, feminism and postcolonial theory. BETR AYAL chRistian KeRslaKe The editors, Austin Gross, PhiliPPe lacoue-labaRthe MAtt HAre & MArie Louise KolJa lindneR KroGH, are PhD candidates in the JosePh mccaRney Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), andRew mcGettiGan Kingston University London. PeteR osboRne Rosa & chaRley PaRKin stella sandFoRd lynne seGal essays from the albeRto toscano radical philosophy archive isbn 978-1-9162292-0-4 9 781916 229204 CRITIQUE & BETRAYAL CRITIQUE & BETRAYAL Essays from the Radical Philosophy Archive volume 1 edited by Austin Gross MAtt HAre MArie Louise Krogh Published in 2020 by Radical Philosophy Archive www.radicalphilosophyarchive.com isbn 978-1-9162292-0-4 (pbk) isbn 978-1-9162292-1-1 (ebook) The electronic version of this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International License (CC-BYNC-ND). For more information, please visit creativecommons.org. The right of the contributors to be identified as authors of this work has been asserted by them in accordance with the Copyright,