Erdbeben, Feuer, Wasser
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
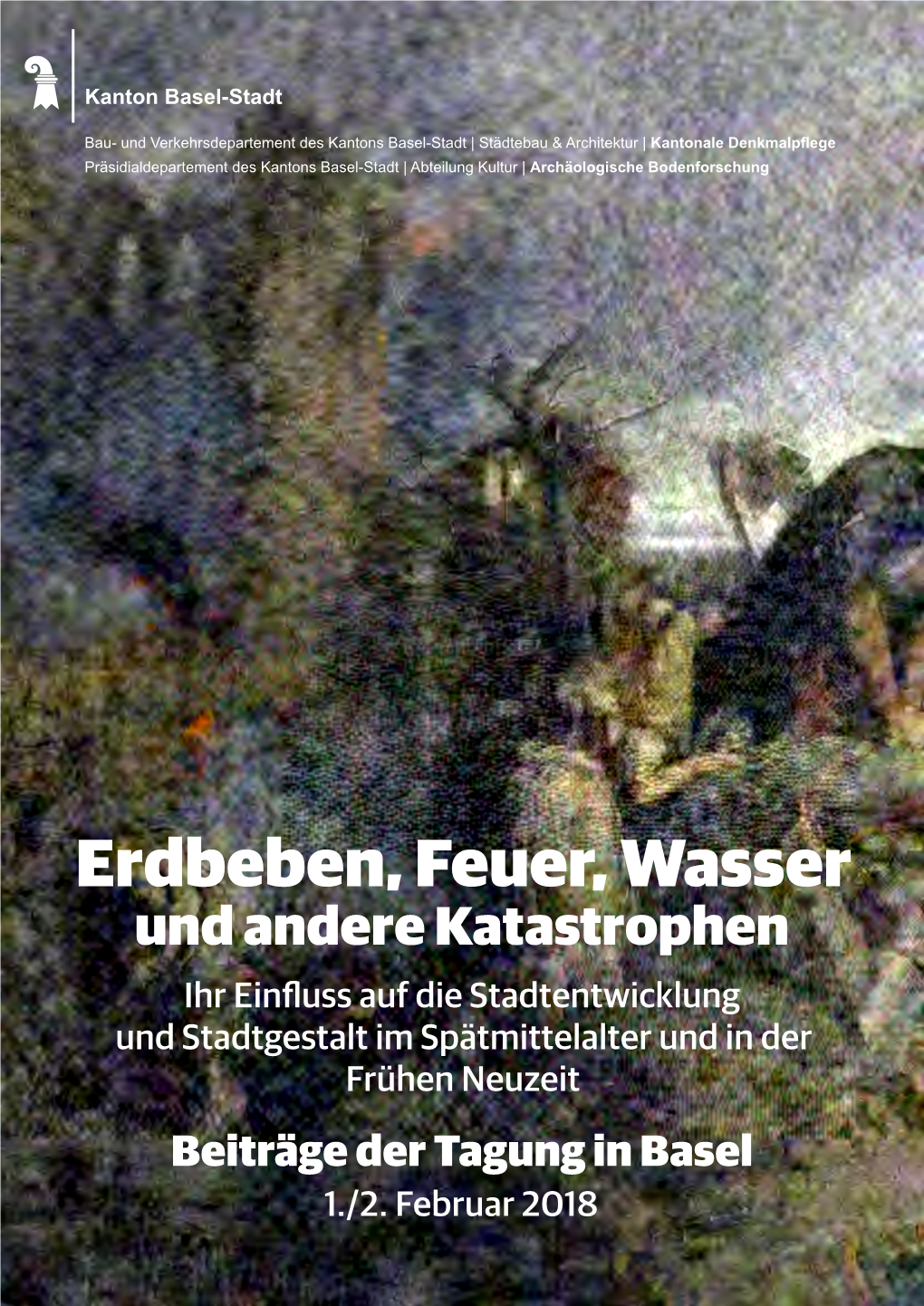
Load more
Recommended publications
-

Palača Luccari Na Pustijerni: Obnova Dubrovačke Stambene Arhitekture
Peristil 56/2013 (127–142) Katarina Horvat-Levaj, Relja Seferović: Palača Luccari na Pustijerni Katarina Horvat-Levaj Palača Luccari na Institut za povijest umjetnosti, Zagreb Relja Seferović Pustijerni: obnova Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik dubrovačke stambene Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper UDK / UDC: 728.3.034.5(497.5 Dubrovnik) arhitekture nakon 4. 11. 2013. potresa 1667. godine u svjetlu novih arhivskih istraživanja Ključne riječi: Dubrovnik, Pustijerna, vlasteoska obitelj Luccari, palača, renesansa, obnova nakon potresa 1667. godine Key words: Dubrovnik, Pustijerna, Luccari family palace, Renaissance, restoration after the 1667 earthquake Palača u Bandurevoj ulici 3 na Pustijerni, tradicionalno pripisivana vlasteoskoj obitelji Kaboga, pripada među najkvalitetnija ostvarenja renesansne stambene arhitekture u Dubrovniku, te je kao takva bila građevinski i restauratorski istražena 1980-ih godina. Novootkriveni dokumenti o njezinoj obnovi nakon potresa 1667. godine u Državnom arhivu Dubrovnika ne samo da su pokazali nove pojedinosti o povijesti gradnje same palače nego su otkrili da je u prošlosti pripadala vlasteoskoj obitelji Luccari (čiji grb, krivo tumačen kao Kabogin, obilježava njezine pročelne portale). Troškovnik obnove, vođene od 1670. do 1674. godine, donoseći imena majstora, ujedno svjedoči da je u kontekstu obnove dubrovačke stambene arhitekture neposredno nakon potresa, palača Luccari, u stanovitim elementima, poput formiranja otvorenog prostora s paviljonom, imala i svojevrsno prototipsko -

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht Zur
Internationale Flussgebietseinheit Rhein Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht zur Bestandsaufnahme; Teil B Bearbeitungsstand: 8. März 2005 Federführung der internationalen Koordinierung: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Zuständige Behörden: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Préfet Coordonnateur de Bassin (PCB) Rhin-Meuse Direction Régionale de l´Environment (DIREN) Alsace Für die Koordinierung im Bearbeitungsgebiet: BW : Regierungspräsidium Freiburg CH: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern F : DIREN Alsace, Strasbourg WRRL BG Hochrhein Stand: 08.03.05 S. 2 Inhaltsverzeichnis Kartenverzeichnis .................................................................................................... 4 Einführung und wichtige Fragen der Wasserbewirtschaftung im Bearbeitungsgebiet Hochrhein.......................................................................... 6 Französische Anteile des Bearbeitungsgebietes Hochrhein ............................... 8 1 Allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebietes .................................. 10 1.1 Übersicht und Basisinformationen .................................................................................... 10 1.2 Lage und Grenzen............................................................................................................. 11 1.3 Raumplanung und Landnutzung ....................................................................................... 11 1.4 Naturräume ...................................................................................................................... -

Petit Tour De Suisse Des Eaux Transfrontières
Petit tour de Suisse des eaux transfrontières On a coutume de dire que la Suisse est le château d'eau de l'Europe. En tout cas, chaque année, ce sont en moyenne quelque 52 milliards de mètres cubes d'eau qui sortent du périmètre national pour entrer dans un pays voisin. Mais il faut savoir aussi qu'un quart environ de ce volume provient de cours d'eau étrangers, tels l'Arve française ou les innombrables affluents allemands du bassin du Rhin avant sa sortie de Suisse. À regarder de près la frontière helvétique 1, on voit qu'un bon cinquième de son tracé se superpose à celui d'un cours d'eau, celui du Rhin en particulier, ou avec la ligne transversale de grands réservoirs transfrontières comme le Lac de Constance et le Léman (à quoi il faudrait ajouter un grand nombre de glaciers alpins dont la crête correspond souvent aux limites sud du pays, principalement entre le Valais et l'Italie). On trouvera ici un inventaire succinct des principaux cours d'eau suisses qui font partiellement office de frontière nationale, des points précis où certains d'entre eux pénètrent en Suisse et/ou en sortent, et de quelques-unes des particularités précisément liées au partage des eaux transfrontières. 2 En remontant le Rhin À tout seigneur tout honneur. Ce tour de Suisse commence par le Rhin, à Bâle, là où au rythme moyen de plus d'un million de litres par seconde sortent de Suisse les eaux provenant de plusieurs grands sous-bassins versants (Aar, Reuss, Limmat) qui recouvrent pas moins de 59 % du territoire national. -

The 1356 Basel Earthquake: an Interdisciplinary Revision
Research Collection Journal Article The 1356 Basel earthquake An interdisciplinary revision Author(s): Fäh, Donat; Gisler, Monika; Jaggi, Bernard; Kästli, Philipp; Lutz, Thomas; Masciadri, Virgilio; Matt, Christoph; Mayer-Rosa, Dieter; Rippmann, Dorothee; Schwarz-Zanetti, Gabriela; Tauber, Juerg; Wenk, Thomas Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000021256 Originally published in: Geophysical Journal International 178(1), http://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Geophys. J. Int. (2009) 178, 351–374 doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x The 1356 Basel earthquake: an interdisciplinary revision Donat Fah,¨ 1 Monika Gisler,1 Bernard Jaggi,2 Philipp Kastli,¨ 1 Thomas Lutz,2 Virgilio Masciadri,3 Christoph Matt,4 Dieter Mayer-Rosa,5 Dorothee Rippmann,6 Gabriela Schwarz-Zanetti,1 Jurg¨ Tauber7 and Thomas Wenk8 1Swiss Seismological Service, ETH Zurich, CH-8092 Zurich, Switzerland. E-mail: [email protected] 2Basler Denkmalpflege, Unterer Rheinweg 26, CH-4058 Basel, Switzerland 3Klassisch-Philologisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Ramistr.¨ 68, CH-8001 Zurich, Switzerland 4Archaologische¨ Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Petersgraben 11, CH-4001 Basel, Switzerland 5Schwandenholzstrasse 260, 8046 Zurich, Switzerland 6Historisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zurich, Switzerland 7Archaologie¨ und Museum Baselland, Amtshausgasse 7, CH-4410 Liestal, Switzerland 8Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH, Postfach 6063, CH-8023 Zurich, Switzerland Accepted 2009 January 26. Received 2009 January 26; in original form 2007 April 25 SUMMARY Within historical times one of the most damaging events in intra-plate Europe was the 1356 Basel earthquake. -
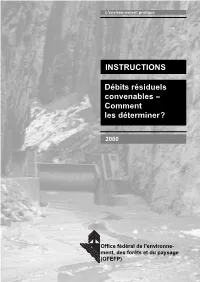
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19 -

Zur Geschichte Des Gewässerschutzes Am Ober- Und Hochrhein - Eine Fallstudie Zur Umwelt- Und Biologiegeschichte
Zur Geschichte des Gewässerschutzes am Ober- und Hochrhein - Eine Fallstudie zur Umwelt- und Biologiegeschichte - Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Fakultät für Biologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg vorgelegt von Jörg Lange aus Darmstadt August 2002 Dekan: Prof. Dr. H. Kleinig Leiter der Arbeit: Prof. Dr. J. Schwoerbel Referent: Prof. Dr. J. Schwoerbel / Prof. Dr. Rothaupt (Erstgutachten) Koreferent: Prof. Dr. N. Sander Promotionsausschuss- vorsitzender: Prof. Dr. K.F. Fischbach Tag der Verkündigung des Prüfungsergebnisses:11.12.2002 „Außerdem haben wir uns dem globalen Wasserproblem zu spät intensiv gewidmet. Die Frage, wie wir auf der Welt mit dem Wasser umgehen, wird an vielen Orten über Krieg und Frieden mitentscheiden. Daß wir Wasser immer noch als Trans- portmittel für Fäkalien und Industrieabwasser benutzen, um sie nachher aufwendig und unter hohem Energieverbrauch in der Kläranlage wieder herauszuholen, ist doch keine zukunftsfähige Lösung. Das kann kein Modell für Megastädte in den Entwicklungsländern mit 20 Millionen Einwohner sein.“ Der ehemalige Rheindurchschwimmer Klaus Töpfer in einem Interview in der FR v. 26.1.98 anläßlich seines Wechsels zum Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) Vorwort Der Arbeit „Geschichte des Gewässerschutzes am Hoch- und Oberrhein“ liegen folgende Beweggründe des Bearbeiters zugrunde: • Begeisterung für das Element Wasser und Gewässerlandschaften in all ihren Erscheinungsformen. • Die Hoffnung, daß man noch zu meinen Lebzeiten ohne jede Bedenken im Verlauf des gesamten Rheins baden gehen kann. • Die persönliche Erfahrung, durch die Auseinandersetzung mit Ge- schichte Anregung für gegenwärtige Probleme zu finden („zu lernen“). • Die Freude an der Erkenntnis von Zusammenhängen. • Die Vermutung, daß zukünftige Generationen ohne eine ressourcen- schonende Kreislaufwirtschaft kein sozial- und wirtschaftlich angemes- senes Leben werden führen können. -

Jahresbericht 2014 Der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 20 14 Bodenforschung Basel-Stadt Jahresbericht Derarchäologischen Inhalt
20 14Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt Jahresbericht 2014 der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt Bodenforschung 2014 der Archäologischen Jahresbericht inhalt t ätiGkeitsbericht für das Jahr 2014 Guido lassau 21 Jahresbericht 2014 4 | 5 tätiGkeitsbericht fundchronik coverstory GeoarchäoLoGischer für das Jahr 2014 ausGrabunGen und von fischen und fischern report funde im Jahr 2014 eine kurze Geschichte Guido lassau ichthyoarchäologische Unter des rheins Marco bernasconi suchungen zu Gewässerökologie 21 Marta imbach und Fischkonsum im Mittelalt er Geologische und Philippe rentzel und der neuzeit archäologische till scholz impressionen aus basel norbert spichtig simone häberle christine Pümpin Philippe rentzel 73 christine Pümpin 33 David brönnimann 109 EinE kurzE GEschichtE dEs rhEins Jahrb Es Ericht 2014 108 | 10 9 GeoarchäoloGischer report eine kurze Geschichte des rheins Geologische und archäologische impressionen aus basel Philippe rentzel christine Pümpin david brönnimann EinE kurzE GEschichtE dEs rhEins Jahresbericht 2014 110 | 111 Die Stadt Basel und der Rhein gehören untrennbar zusammen. Nicht von unge fähr ist die offizielle Hymne «z’Basel am mym Rhy» dem die Stadt prägenden Fluss gewidmet, und auch in der Aussenwahrnehmung ist Basel – zumin dest im schweizerischen Kontext – die Rheinstadt resp. die Stadt am Rhein. Tat sächlich bildet der Fluss seit je die Lebensader nicht nur der Stadt Basel, son dern auch ihrer ur und frühgeschichtlichen Vorgängersiedlungen. Archäologie in Basel und der -

Kartierungsbericht 2014/2015
Bericht Laichgrubenkartierung 2014/2015 Bericht Laichgrubenkartierung 2014/15 Über 30 Personen haben während der letzten Laichzeit! Ausschau nach laichenden Forellen gehalten und ihre Beobachtungen der FIBER gemeldet. Insgesamt wurden 35 Gewässer untersucht und 544 Laichplätze gezählt. Abbildung 1 Weisse Punkte sind Gewässer mit vollständigen Kartierungen, inkl. exakter Angabe zur Länge der untersuchten Strecken und zur Anzahl Laichplätze. Gelbe Punkte sind Gewässer mit relevanten Beobachtungen, ohne Detailangaben über Streckenlän- gen und Anzahl Laichplätzen. 1) Drize 2) Versoix 3) Venoge 4) Grande Eau 5) Chräbsbach 6) Mungaukanal 7) Lüssel 8) Lützel 9) Ibach 10) Chastelbach 11) Birsig 12) Pfaffneren 13) Tych 14) Himmelbach Laichgruben kartieren – worum geht es? 15) Töss 16) Rhein 2014 hat die Fischereiberatung Fiber den Workshop «Laichzeit! Laichgruben von Forel- 17) Biber 18) Hermishoferbach len erkennen, kartieren und vermessen» zum vierten Mal durchgeführt. In diesem Kurs 19) Jona (zwei Kartierungen) wird Interessantes rund um die Biologie und die Fortpflanzung der Forellen vermittelt 20) Lattenbach und im Feld wird gelernt, wie Laichgruben erkannt und kartiert werden. In der Laich- 21) Hinterrhein 22) Ragn da Ferrera zeit! 13/14 wurde begonnen, mit Hilfe von Kursteilnehmern und anderen Interessierten 23) Val Niemeter Bach Informationen über die Laichaktivitäten von Forellen zu sammeln. Dabei werden die 24) Averserrhein 25) Madrischerrhein Laichgruben gezählt, welche die Fische zur Laichzeit in den Kies der Gewässersoh- 26) Russen le schlagen, um ihre Eier zu vergraben. Während des Grabens der Grube reinigt das 27) Pfynkanal Weibchen den Kies von pflanzlichem Aufwuchs und feinen Sedimenten und so können Ab Seite 28 Laichgruben oft als helle Flecken auf dem dunkleren Gewässergrund erkannt werden 28) Hinterbach 29) Erusbach (Abbildung 2). -

The Fall of the Dubrovnik Republic and the Establishment of the French Administration in Dubrovnik in 1808 and 1809
55 Original Paper UDC 949.713-2Dubrovnik "18" THE FALL OF THE DUBROVNIK REPUBLIC AND THE ESTABLISHMENT OF THE FRENCH ADMINISTRATION IN DUBROVNIK IN 1808 AND 1809 STJEPAN ĆOSIĆ ABSTRACT: This paper is concerned with the state of social and political affairs in Dubrovnik prior to the abolishment of the Republic. It further illus trates the first phase of the organization and exertion of the new French ad ministration in 1808 and 1809. In order to provide a more complete and objective insight into the signifi cance of the French abolishment of the Republic of Dubrovnik (Ragusa) as well as to grasp the social, political and administrative changes which fol lowed, it is necessary to elucidate Dubrovnik at that time in its broader so cial, economic, and political context.1 Stjepan Ćosić, member of the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik. Address: Zavod za povijesne znanosti HAZU, Lapadska obala 6, 20000 Dubrovnik, Croatia. A longer version of this article has already been published in Croatian under the following title: »O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): pp. 177-203. 56 Dubrovnik Annals 2 (1998) Social and historical background preceding the fall of the Republic The turn of the eighteenth century witnessed some radical social changes throughout the European continent. The ideas of the French revolution, post- revolutionary events, and the Napoleonic campaigns enforced a considerable incursion upon the European political layout, thus introducing the concept of liberty with a profoundly new ideological meaning. -

Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl
Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl... http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=kt967nd088&chunk.id=0&doc.... Preferred Citation: Effros, Bonnie. Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. Berkeley: University of California Press, c2003 2003. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/kt967nd088/ Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages BONNIE EFFROS University of California Press BERKELEY LOS ANGELES LONDON 2003 ― ― [Dedication] To my parents, Gail Hochman Effros and Richard Matthew Effros Preferred Citation: Effros, Bonnie. Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. Berkeley: University of California Press, c2003 2003. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/kt967nd088/ ― ― [Dedication] To my parents, Gail Hochman Effros and Richard Matthew Effros ― ― [Epigraph] It is as though worldly stability had become transparent in the permanence of art so that a premonition of immortality, not the immortality of the soul or of life but of something immortal achieved by mortal hands, has become tangibly present, to shine and to be seen, to sound and to be heard, to speak and to be read. HANNAH ARENDT, The Human Condition 1 of 193 7/22/2006 1:55 AM Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl... http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=kt967nd088&chunk.id=0&doc.... ― ― Contents List of Illustrations xi Acknowledgments xiii List of Abbreviations xvii INTRODUCTION 1 ANTIQUARIES, HISTORIANS, AND ARCHAEOLOGISTS: CREATING A CULTURAL CONTEXT FOR 1. 12 EARLY MEDIEVAL GRAVES 2. MODERN ASSESSMENTS OF MEROVINGIAN BURIAL 71 3. GRAVE GOODS AND THE RITUAL EXPRESSION OF IDENTITY 119 4. -

Darinka NEVENIĆ — GRABOVAC 1Z POEZIJE DIDAKA PIRA ŽIVOTOM I Radom Didaka Pira, Velikom Ugledu, Uticaju Ii Pomooi Koju Je Sv
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Jewish Digital Library Darinka NEVENIĆ — GRABOVAC 1Z POEZIJE DIDAKA PIRA ŽIVOTOM i radom Didaka Pira, talentovanog pesnika versifikatora ii pozna- tog humanista, u poslednjih šezdeset godina, među ostalima, bavili su se naši istaknuti nauonici: Đuro Kerbler, Jorjo Tadić ii Petar Kolendić. To govoni o ne- prekidnoj iradoznalosti za poznatog i uvaženog pesrrnka, s jedne strane, i o njegovu velikom ugledu, uticaju ii pomooi koju je svojom kulturom pružio duhovnom izgra- đivanju Dubrovnika, s druge strane. Istraživanja, pronalasci i analize naših naučnika doprinose sve dubljem ras- vetljavanju života i rada Didaka Pira, jer svaki od njih ima nešto značajno da doda. S mnogih 'je stvari trebalo skinuti veo zaborava. I sami Dubrovčani su, posle zemljotresa od 1667, malo znali o svojem XVI veku. To je, pogotovu, mo- ralo pogoditi pesnika došljaka, izbeglicu koji je stvarao i mnogo pre dolaska u Dubrovnik u svojem nemirnom i burnom životu, lutajuoi posle progonstva iz Spanije (Hoiandija, ltaliija, Turska). Kasnije će se, međutim, svaki književni istoričar dubrovačkog latinizma sustretati s njegovim imenom. 1 Studija Đura Kerblera' je veoma opširna i obuhvata sve što se dotle znalo u svetu o Piru i što su o njemu već bili saopštili najraniji 'istraživači književne dubrovačke listorije — ,počev od Ignjata Đurđevića. Po .prvim vestima i činjeni- cama iz samih pesama (ijer Didak spominje događaje iz svojeg života, priijatelje i poznani'ke, književnike i naučnike svetskoga glasa, daje čitavu galeriju likova uticajnih Ijudi iz Italije i Dubrovnika), naravno, Kerbler će pokušati da rekon- struiše pesnikov život ii da se pozabavi pitanjem njegove profesije u Dubrovniku.