Vor-Denker Der Ökologiebewegung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
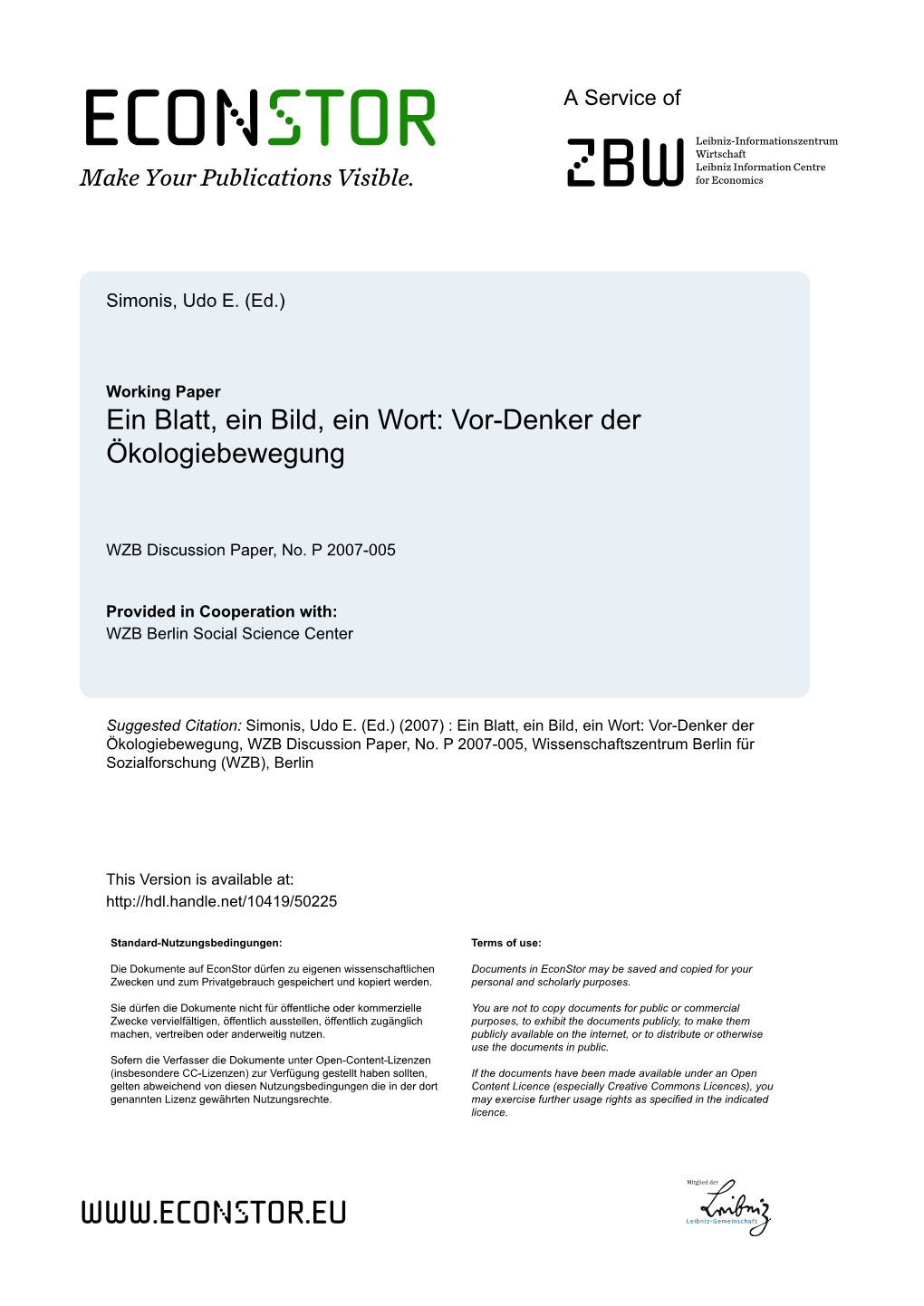
Load more
Recommended publications
-

Keynes and the Making of EF Schumacher
Keynes and the Making of E. F. Schumacher, 1929 - 1977 Robert Leonard* “I consider Keynes to be easily the greatest living economist”. Schumacher to Lord Astor, March 15, 19411 “The story goes that a famous German conductor was once asked: ‘Whom do you consider the greatest of all composers? ‘Unquestionably Beethoven’, he replied. ‘Would you not even consider Mozart?’. ‘Forgive me’, he said, ‘I though you were referring only to the others’. The same initial question may one day be put to an economist: ‘Who, in our lifetime, is the greatest? And the answer might come back: ‘Unquestionably Keynes’. ‘Would you not even consider Gandhi?’… ‘Forgive me, I thought you were referring only to all the others’”. Schumacher, in Hoda (1978), p.18 Introduction On Sunday, December 7, 1941, from a cottage deep in the Northamptonshire countryside, the 30- year old Fritz Schumacher wrote to fellow German alien, Kurt Naumann. He was reporting a recent encounter in London. “A man of great kindness, of downright charm; but, much more than I expected, the Cambridge don type. I had expected to find a mixture beween a man of action and a thinker; but the first impression is predominant, only that of a thinker. I do not know how far his practical influence goes today. Some tell me that it is extraordinarily great. The conversation was totally different from what I expected. I was ready to sit at his feet and listen to the Master’s words. Instead, there was an extremely lively discussion, a real battle of heavy artillery, and all this even though we were 99% in agreement from the outset. -

Design Ecologies, Creative Labor and Hybrid Ecological Democracy Re-Enchanting Humanity to Prepare for the Just Transition Beyond Trump and End Times Ecology
Design Ecologies, Creative Labor and Hybrid Ecological Democracy Re-enchanting humanity to prepare for the Just Transition beyond Trump and End Times Ecology DRAFT, DRAFT, DRAFT, ROUGH, ROUGH, ROUGH Comments and critiques most welcome. Damian White The Rhode Island School of Design. [email protected] Design Ecologies, Creative Labor and Ecological Democracy Thinking the Just Transition beyond Trump and End Times Ecology Damian White, Professor of Social Theory and Environmental Studies, The Rhode Island School of Design [email protected] It could be argued that the project of ecological democracy that emerged from green political theory has been essentially concerned with finding ways to democratically regulate environmental limits. Conversely, theorizations of ecological democracy emerging out of political ecology, critical geography and STS have been rather more interested in finding ways to democratize the making of our hybrid social- natures. Each tradition of ecodemocratic thinking shares a desire to push back against eco-authoritarian ecologies that once had wide purchase on certain survivalist and apocalyptic ecologies of times past. But each tradition has had different foci of concerns generating a certain degree of disengagement and detachment. We find ourselves now in a context where the climate crisis continues, authoritarian populists are on the march and the project of ecological democracy seems ever more distant. The need for a just transition beyond fossil fuels becomes urgent, however an ecology of panic and hopelessness increasingly seems to pervade all manner of environmental discourse. In this paper I want to explore the role that emerging work in critical design studies might offer, in conjunction with emerging currents of labor focused political ecologies, to recharge the project of ecological democracy thus moving us beyond both end times ecology and Trump-ism. -

Ernst Friedrich Schumacher
Ernst Friedrich Schumacher Ernst Friedrich Schumacher "Fritz" (16 August 1911 – 4 September 1977) was an internationally influential economic thinker, statistician and economist in Britain, serving as Chief Economic Advisor to the UK National Coal Board for two decades. [ 1 ] His ideas became popularized in much of the English-speaking world during the 1970s. He is best known for his critique of Western economies and his proposals for human-scale, decentralized and appropriate technologies . According to The Times Literary Supplement , his 1973 book Small Is Beautiful : a study of economics as if people mattered is among the 100 most influential books published since World War II . [ 2 ] and was soon translated into many languages, bringing him international fame. Schumacher's basic development theories have been summed up in the catch-phrases Intermediate Size and Intermediate Technology . In 1977 he published A Guide For The Perplexed 1 / 8 Ernst Friedrich Schumacher as a critique of materialist scientism and as an exploration of the nature and organization of knowledge . Together with long-time friends and associates like Professor Mansur Hoda , Schumacher founded the Intermediate Technology Development Group (now Practical Action ) in 1966. Early life Schumacher was born in Bonn, Germany in 1911. His father was a professor of political economy. The younger Schumacher studied in Bonn and Berlin, then from 1930 in England as a Rhodes Scholar at New College, Oxford, [ 1 ] and later at Columbia University in New York City, earning a diploma in economics. He then worked in business, farming and journalism. [ 1 ] Economist Protégé of Keynes Schumacher moved back to England before World War II, as he had no intention of living under Nazism. -

Democracy and Liberalism – Harmony at Human Measure
1/11 Democracy and Liberalism – Harmony at human measure Christoph Heuermann University of Konstanz „Dosis facit venenum“ - the dose makes the venom – already was reported by the famous physician Paracelsus. This wisdom is not only applicable on the human organism, but also on society. Symptomatic for our time is the cult of the whopping, which not only extends to prestige-projects like the Elbphilharmony of Hamburg. Wilhelm Röpke, about whom we speak later in more detail, concludes this cult in wise buzzwords: Hybris, Rationalism, Szienticism, Technocracy, Socialism, Mass Democracy of Jacobine character (Röpke 1958). These buzzwords of the Big do not seem to correspond with the ideals of liberalism, but to harmonize with the reality of democracy. However, the more it looks like a stress ratio, the less it is one. Democracy harmonizes with Liberalism – but only at human measure. For what in today's political science is called „liberal democracies“ has to do little with both Democracy and Liberalism. What now is the human measure will be clarified after an introduction in the here used comprehension of both Democracy and Liberalism, adding further implications afterwards. Democracy and Liberalism are both concepts falling prey to a Babylonian confusion. This is nothing to wonder about since most old as new „Isms“ can be compared to a megalomania like the building of the tower of Babel, because they overstretch comprehensible ideas to dangerous extremes. The idea historian Eric Voegelin saw this as the consequence of a political gnosticism, which leads to the three central types of progressivism, utopism and revolutionary activism (Voegelin 1999: 107f). -

Grassroots Post-Modernism Is Daring in Its Thesis That the Real Postmodernists Are to Be Found Among the Zapotecos and Rajasthanis of the Majority World
Grassroots Post-Modernism Remaking the soil of cultures Gustavo Esteva & Madhu Suri Prakash i 'Beyond its definite "No" to the Global Project, this book takes a stimulating glance at the renewed life of social majorities and offers good reasons for a common hope! GILBERT RIST 'Grassroots Post-modernism is daring in its thesis that the real postmodernists are to be found among the Zapotecos and Rajasthanis of the majority world. It is hard-hitting in its attacks against progressive commonplaces, like global responsibility, human rights, the autonomy of the individual, and democracy. And it is eye-opening in its illustrations of how ordinary people, amidst the rubble of the development epoch, stitch their cultural fabric together and unwittingly move beyond the impasse of modernity.' WOLFGANG SACHS 'Esteva and Prakash courageously and clear-sightedly take on some of the most entrenched of modern certainties such as the universality of human rights, the individual self, and global thinking. In their efforts to remove the lenses of modernity that education has bequeathed them, they dig deep into their own encounters with what they call the "social majorities" in their native Mexico and India. There they see not an enthralment with the seductions of modernity but evidence of a will to live in their own worlds according to their own lights. Esteva's and Prakash's reflections on the imperialism of the universality of human rights avoids the twin pitfalls of relativism and romanticism. Their alternative is demanding and novel, and deserves our most serious consideration. Grassroots Post-modernism is a much needed and most welcome counterpoint both to the nihilism of much post-modern thinking as well as to those who view the spread of the global market and of global thinking too triumphantly.' FREDERIQUE APFFEL-MARGLIN 'Quite simply, a book which will transform how one sees the world.’ NORTH AND SOUTH ii iii ABOUT THE AUTHORS GUSTAVO ESTEVA is one of Latin America's most brilliant intellectuals and a leading critic of the development paradigm. -

RES U R GEN CE Journal of the Fourth World Contents Contributors
RES U RGEN CE Journal of the Fourth World 24 Abercom Place, St. John's Wood, London, N.W.8 Vol. 3, No. 6 March/April 1971 Contents Editorial Group Roger Franklin Managing Editor 3 The Europe of a Thousand Flags Editorial Miles Gibson Layout and Art 7 Poems: 'Advent' John Haag Stephen Horne Newsletter 'Error' David Morris Michael and Frances Horovitz Poetry 8 Modern Industry in the E. F. Schumacher David Kuhrt Light of the Gospel Graham Keen Layout and Art 12 Quotes John Lloyd Publicity Business and 14 The Common Market Leopold Kohr Michael North subscriptions 17 Review, 'The Guilty Bystander' Dave Cunliffe John Papworth Editor 18 Letters Mrs. M. Rohde French Monitor 20 Cars, Profits and Pollution from WIN Andrew Singer German Monitor Martin Thom Spanish Monitor 22 Review, 'Love Poems' Miles Gibson Associate Editors: Ernest Bader, Danilo 23 Urban Notebook John Papworth Dolci, Paul Goodman, Ray Gosling, Prof. Leopold Kohr, jayaprakash 27 Poem, 'Links' David Cha/caner Narayan, Dr. E. F. Schumacher. MILES GIBSON-Born: New Forest, LEOPOLD KOHR, a native of Contributors: 1947. Educated: Yes. Published: Yes, Oberndorf, near Salzburg, graduated see Review; also articles for Daily from the Universities of Vienna and Telegraph Magazine. Works: Yes. Innsbruck; he left Austria during Married; lives in London. the dictatorship of Dolfuss and pur The C 0 VE R, drawn by MILES sued his studies further at the GIBSON, is based on a map from University of Paris and the London Leopold Kohr's book 'The Break School of Economics. He had a down of Nations' ( 1957 ). -
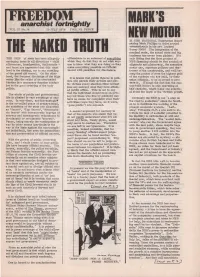
Scanned Image
anarchist fortnightly , l 7 No.1 TWE LVE PENCE _ lllllli IS, THE NATIONAL Enterprise Board paying Mark Phillips to drive around ostentatiously in his new Leyland A Rover 3500'? The integration of the nominal state, the actual state and big business has never been plainer. It's TI-IE SHIP of state has been allegedly officialdom is so ashamed of everfihing only fitting that the first product of springing leaks in all directions - child which they do that they do not wish any- NEB financing should be that symbol of allowances, immigration, thalidomide - one to 1(IlOW'..Wh8.ll they are doing so they oligarchy and plutocracy, the executive and fears are expressedithat this must make everything possible an Official motor car, supreme polluter and des- lead to the sinking, not to say scuttling Secret with penalties for disclosure. troyer of the countryside, and well be- of the grand old vessel. On the other yong the pocket of even the highest paid hand, the frequent discharge of the bilge 0 of the workers who are said, by their water like the relief of an overloaded It is ironic that public figures in poli- tics who parade their private and pub- union officials, to be so proud to pro- bladder is a necessary function conduc- lic virtues every election-time retreat duce it . (Though the fact that the cus- ive to the good ordering of the body into coy secrecy once they have attain- tom-built facory is only operating at politic. half capacity, might make one sceptic- ed public office. -

Catalá Oliveras, Francisco A.. Todo Es Cuestión De Medida. En Publicacion: Revista De Ciencias Sociales No
Catalá Oliveras, Francisco A.. Todo es cuestión de medida. En publicacion: Revista de Ciencias Sociales no. 16. CIS, Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, San Juan: Puerto Rico. Verano. 2007. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/pr/cis/rcs/16/FCatala.pdf Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO http://www.clacso.org.ar/biblioteca [email protected] Todo es cuestión de medida FRANCISCO A. CATALÁ OLIVERAS Departamento de Economía Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras RESUMEN El profesor Leopold Kohr (1909-1994) dictó cátedra en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras (UPR) del año 1955 al 1973. Sus aportes intelectuales siempre estuvieron centrados en una filosofía sobre el tamaño en la que, junto a una crítica severa al gigantismo, se destacaban las posibilidades de las unidades políticas de escala modesta. En este artículo se enlazan las ideas poco convencionales del profesor Kohr con recientes contribuciones en el campo de la economía de países pequeños. Se subraya el hecho de que los cambios institucionales y tecnológicos obligan a la reconceptualización del tamaño económico. Esto provee el marco para, desde una perspectiva institucionalista, darle una mirada a la experiencia de Puerto Rico, la que aquí se caracteriza como una en la que se ha conjugado el crecimiento económico con la hipertrofia. Palabras[ clave: tamaño óptimo, economías de escala, economías de alcance, costos de la heterogeneidad, proporcionalidad.] ... EVISTA DE IENCIAS OCIALES EVISTA DE IENCIAS OCIALES .. -

The Breakdown of Nations Leopold Kohr
The Breakdown of Nations Leopold Kohr 1957, 1978 To Colin Lodge CONTENTS Acknowledgments Foreword by Kirkpatrick Sale Introduction I. The Philosophies of Misery II. The Power Theory of Aggression III. Disunion Now IV. Tyranny in a Small-State World V. The Physics of Politics: The Philosophic Argument VI. Individual and Average Man: The Political Argument VII. The Glory of the Small: The Cultural Argument VIII. The Efficiency of the Small: The Economic Argument IX. Union Through Division: The Administrative Argument X. The Elimination of Great Powers: Can it be Done? XI. But Will it be Done? XII. The American Empire? Afterword by the Author Appendices: The Principle of Federation Presented in Maps (Maps Drawn By Franc Riccardi) Bibliography Index ACKNOWLEDGMENTS Most of my inspiration I owe to friends whose love of challenge and debate was invaluable in the formulation of my ideas. This book would therefore never have been written without a long string of animated discussions with Diana Lodge, Anatol and Orlene Murad, Max and Isabel Gideonse, Sir Robert and Lady Fraser, my venerable late friend Professor George M. Wrong and Mrs. Wrong, Noel and Donovan Bartley Finn, my brother John R. Kohr, David and Manning Farrell, Franc and Rosemary Ricciardi, and, above all, Joan and Bob Alexander who for five long years had to bear with my constructions of pleasurable gloom at breakfast, lunch and dinner. Nor would the book ever have been published without the advice and encouragement of Sir Herbert Read, or without my friends and colleagues from the University of Puerto Rico—Severo Colberg, Adolfo Fortier, Hector Estades, Dean Hiram Cancio, and Chancellor Jaime Benitez—whose interest led to a gratefully acknowledged grant from the Carnegie Foundation. -

Pico Della Mirandola Descola Gardner Eco Vernant Vidal-Naquet Clément
George Hermonymus Melchior Wolmar Janus Lascaris Guillaume Budé Peter Brook Jean Toomer Mullah Nassr Eddin Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Jerome of Prague John Wesley E. J. Gold Colin Wilson Henry Sinclair, 2nd Baron Pent... Olgivanna Lloyd Wright P. L. Travers Maurice Nicoll Katherine Mansfield Robert Fripp John G. Bennett James Moore Girolamo Savonarola Thomas de Hartmann Wolfgang Capito Alfred Richard Orage Damião de Góis Frank Lloyd Wright Oscar Ichazo Olga de Hartmann Alexander Hegius Keith Jarrett Jane Heap Galen mathematics Philip Melanchthon Protestant Scholasticism Jeanne de Salzmann Baptist Union in the Czech Rep... Jacob Milich Nicolaus Taurellus Babylonian astronomy Jan Standonck Philip Mairet Moravian Church Moshé Feldenkrais book Negative theologyChristian mysticism John Huss religion Basil of Caesarea Robert Grosseteste Richard Fitzralph Origen Nick Bostrom Tomáš Štítný ze Štítného Scholastics Thomas Bradwardine Thomas More Unity of the Brethren William Tyndale Moses Booker T. Washington Prakash Ambedkar P. D. Ouspensky Tukaram Niebuhr John Colet Abū Rayhān al-Bīrūnī Panjabrao Deshmukh Proclian Jan Hus George Gurdjieff Social Reform Movement in Maha... Gilpin Constitution of the United Sta... Klein Keohane Berengar of Tours Liber de causis Gregory of Nyssa Benfield Nye A H Salunkhe Peter Damian Sleigh Chiranjeevi Al-Farabi Origen of Alexandria Hildegard of Bingen Sir Thomas More Zimmerman Kabir Hesychasm Lehrer Robert G. Ingersoll Mearsheimer Ram Mohan Roy Bringsjord Jervis Maharaja Sayajirao Gaekwad III Alain de Lille Pierre Victurnien Vergniaud Honorius of Autun Fränkel Synesius of Cyrene Symonds Theon of Alexandria Religious Society of Friends Boyle Walt Maximus the Confessor Ducasse Rāja yoga Amaury of Bene Syrianus Mahatma Phule Chhatrapati Shivaji Maharaj Qur'an Cappadocian Fathers Feldman Moncure D. -

Decentralization 1 Decentralization
Decentralization 1 Decentralization Decentralization (or decentralisation) is the process of redistributing or dispersing functions, powers, people or things away from a central location or authority.[1][2] While decentralization, especially in the governmental sphere, is widely studied and practiced, there is no common definition or understanding of decentralization. The meaning of decentralization may vary in part because of the different ways it is applied.[3] Concepts of decentralization have been applied to group dynamics and management science in private businesses and organizations, political science, law and public administration, economics and technology. History The word "centralization" came into use in France in 1794 as the post-French Revolution French Directory leadership created a new government structure. The word "decentralization" came into usage in the 1820s.[4] "Centralization" entered written English in the first third of the 1800s;[5] mentions of decentralization also first appear during those years. In the mid-1800s Alexis de Tocqueville wrote that the French Revolution began with "a push towards decentralization...[but became,]in the end, an extension of centralization."[6] In 1863 retired French bureaucrat Maurice Block wrote an article called “Decentralization” for a French journal which reviewed the dynamics of government and bureaucratic centralization and recent French efforts at decentralization of government functions.[7] Ideas of liberty and decentralization were carried to their logical conclusions during the 19th and 20th centuries by anti-state political activists calling Alexis de Tocqueville themselves "anarchists", "libertarians and even decentralists. Alexis de Tocqueville was an advocate, writing: "Decentralization has, not only an administrative value, but also a civic dimension, since it increases the opportunities for citizens to take interest in public affairs; it makes them get accustomed to using freedom. -

Tesis Doctoral
Universitat Internacional de Catalunya Tesis doctoral La meta-economía de E.F.Schumacher como punto de partida de un nuevo paradigma económico basado en un modo más humano de vivir (y convivir) Joaquín Muñoz Traver Aquesta tesi doctoral està subjecta a la licencia Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) This doctoral thesis is licensed under the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA La meta-economía de E.F.Schumacher como punto de partida de un nuevo paradigma económico basado en un modo más humano de vivir (y convivir) Joaquín Muñoz Traver Dirigida por: Dr. Miquel Bastons Prat DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y JURÍDICAS 2 ÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................ 3 AGRADECIMIENTOS ................................................................................. 7 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 13 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA .................................................................... 21 HIPÓTESIS ............................................................................................. 27 METODOLOGÍA ..................................................................................... 29 PRIMERA PARTE E. F. SCHUMACHER: BREVE APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA