„Dem Anwenden Muss Das Erkennen Vorausgehen“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
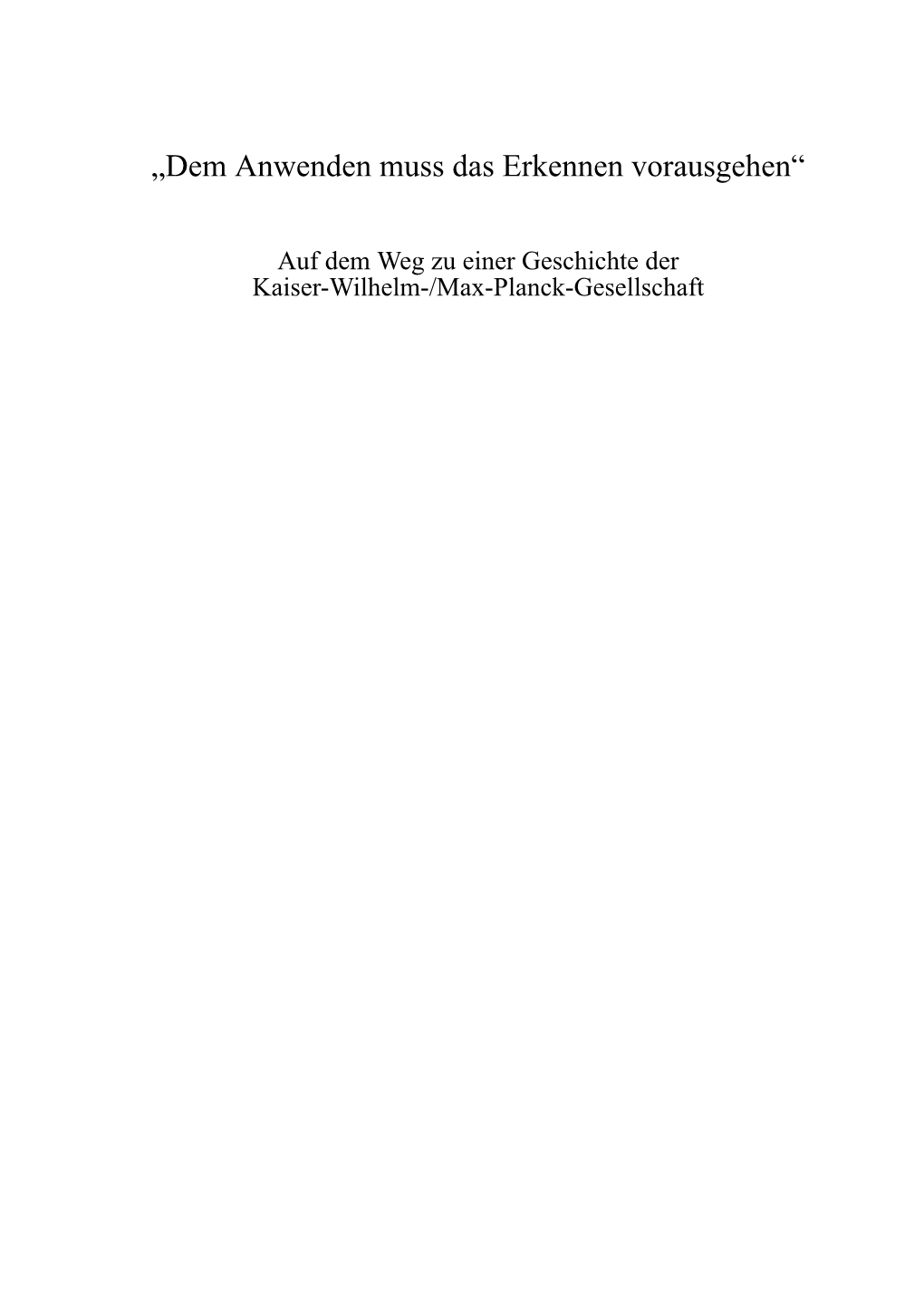
Load more
Recommended publications
-

Purges in Comparative Perspective: Rules for Exclusion and Inclusion in the Scientific Communityunder Political Pressure
Purges in Comparative Perspective: Rules for Exclusion and Inclusion in the Scientific Communityunder Political Pressure Richard Beyler,Alexei Kojevnikov,and Jessica Wang* ABSTRACT During the intense political upheavalthat dominatedthe middle decades of the twentiethcentury, modem states intensifiedtheir drives to disciplinebroad sectors of society and ensuretheir political reliability.Subjected to such pressures,scien- tific institutionsfaced the challenge of admittingnew, officially mandatedcriteria into the regulationof scientificlife. We examinethe effects of these policies on the KaiserWilhelm Society in NationalSocialist Germany,the Max PlanckSociety in occupied Germanyafter 1945, the USSR Academy of Sciences throughoutthe Stalinera, and the NationalAcademy of Sciences in early cold warAmerica. In all these cases, while academicelites largelyaccepted the requiredradical changes in the rules for membershipin the scientificcommunity, they also soughtto manipu- late the processto theirown institutionaladvantage. INTRODUCTION The relationship between state power and professional autonomy has long constituted a major theme in the history of science. Throughout the eras of turmoil that defined their respective nations' politics from the 1930s through the 1950s, the states in Ger- many, the Soviet Union, and the United States became obsessively, at times para- noically, preoccupied with defining and adjudicating their citizens' political, ethnic, or moral acceptability. These concerns frequently resulted in purges from scientific institutions of persons deemed undesirable: "non-Aryans," communists, and social- ists in National Socialist Germany; "bourgeois experts" and "cosmopolites" in Stal- inist Russia; "communist sympathizers" and "subversives" in cold war America. Purges of this kind have often been understood as morality plays, with an under- standable emphasis on the victimization of the innocent by the repressive state. In what follows, we attempt to broaden the discussion by going beyond the phenomenon of purges as such. -

Mildred Fish Harnack: the Story of a Wisconsin Woman’S Resistance
Teachers’ Guide Mildred Fish Harnack: The Story of A Wisconsin Woman’s Resistance Sunday, August 7 – Sunday, November 27, 2011 Special Thanks to: Jane Bradley Pettit Foundation Greater Milwaukee Foundation Rudolf & Helga Kaden Memorial Fund Funded in part by a grant from the Wisconsin Humanities Council, with funds from the National Endowment for the Humanities and the State of Wisconsin. Any views, findings, conclusions or recommendations expressed in this project do not necessarily represent those of the National Endowment for the Humanities. Introduction Mildred Fish Harnack was born in Milwaukee; attended the University of Wisconsin-Madison; she was the only American woman executed on direct order of Adolf Hitler — do you know her story? The story of Mildred Fish Harnack holds many lessons including: the power of education and the importance of doing what is right despite great peril. ‘The Story of a Wisconsin Woman’s Resistance’ is one we should regard in developing a sense of purpose; there is strength in the knowledge that one individual can make a difference by standing up and taking action in the face of adversity. This exhibit will explore the life and work of Mildred Fish Harnack and the Red Orchestra. The exhibit will allow you to explore Mildred Fish Harnack from an artistic, historic and literary standpoint and will provide your students with a different perspective of this time period. The achievements of those who were in the Red Orchestra resistance organization during World War II have been largely unrecognized; this is an opportunity to celebrate their heroic action. Through Mildred we are able to examine life within Germany under the Nazi regime and gain a better understanding of why someone would risk her life to stand up to injustice. -

Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle
Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Der Großvater, Fürst Philipp Eulenburg zu Hertefeld, Familie genießt als Jugendfreund des Kaisers lange Zeit des- sen Vertrauen und gilt am Hofe als sehr einflussreich. und Nach öffentlichen Anwürfen wegen angeblicher Kindheit homosexueller Neigungen lebt der Fürst seit 1908 zurückgezogen in Liebenberg. Aus der Ehe mit der schwedischen Gräfin Auguste von Sandeln gehen sechs Kinder hervor. 1909 heiratet die jüngste Tochter Victoria den Modegestalter Otto Haas-Heye, einen Mann mit großer Ausstrahlung. Die Familie Haas- Heye lebt zunächst in Garmisch, dann in London und seit 1911 in Paris. Nach Ottora und Johannes kommt Libertas am 20. November 1913 in Paris zur Welt. Ihr Vorname ist dem „Märchen von der Freiheit“ entnom- men, das Philipp Eulenburg zu Hertefeld geschrieben hat. Die Mutter wohnt in den Kriegsjahren mit den Kindern in Liebenberg. 1921 stirbt der Großvater, und die Eltern lassen sich scheiden. Nach Privatunterricht in Liebenberg besucht Libertas seit 1922 eine Schule in Berlin. Ihr Vater leitet die Modeabteilung des Staatlichen Kunstgewerbemu- seums in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Auf den weiten Fluren spielen die Kinder. 1933 wird dieses Gebäude Sitz der Gestapozentrale. Die Zeichenlehrerin Valerie Wolffenstein, eine Mitarbeiterin des Vaters, nimmt sich der Kinder an und verbringt mit ihnen den Sommer 1924 in der Schweiz. 4 Geburtstagsgedicht Es ist der Vorabend zum Geburtstag des Fürsten. Libertas erscheint in meinem Zimmer. Sie will ihr Kästchen für den Opapa fertig kleben[...] „Libertas, wie würde sich der Opapa freuen, wenn Du ein Gedicht in das Kästchen legen würdest!“ Sie jubelt, ergreift den Federhalter, nimmt das Ende zwischen die Lippen und läutet mit den Beinen. -

Ringberg Meeting “Bounding the Aerosol Effective Radiative Forcing”
Ringberg meeting “Bounding the aerosol effective radiative forcing” 26 February – 2 March 2018, Schloss Ringberg, Kreuth, Germany Goal: The aim1 is to exclude unlikely strong and weak aerosol forcings (e.g. provide arguments why the aerosol forcing cannot be more negative than -1.5 Wm-2, or why it cannot be positive). We aim for likelihood rather than certainty. Each participant is invited to submit a 1-page list of theses about likely/unlikely aerosol to the group ([email protected]) before the workshop. Concept: One presenter per session - prepares a limited number of theses that quantify or constrain forcings/mechanisms - all participants are invited to submit theses to the presentations - theses can (should) be corroborated briefly by explanations/graphics/references - presenters distribute the theses until late January so participants can prepare for the discussions At the meeting, one rapporteur per session - moderates the plenum discussions and - takes notes for the wrap-up discussions on Friday A large part of the discussions will be in breakout groups: - three breakout groups with 10-12 participants each; - distribution will be randomly selected and change each time, and - a rapporteur per breakout group per session will also be randomly appointed Location: Ringberg Castle (www.schloss-ringberg.de). Participants are expected to cover their own expenses (travel to Munich + 2 hr train from airport / 1 hr from railway station plus 126 € / night including all meals) and be in residence for the duration of the workshop. If financial restrictions might prevent you from coming please let us know and we will look for ways to help offset some or all of the costs. -

Bericht Gegner Des Nationalsozialismus 1933—1945
Bericht Gerd R. Ueberschär Gegner des Nationalsozialismus 1933—1945 Volksopposition, individuelle Gewissensentscheidung und Rivalitätskampf konkurrie- render Führungseliten als Aspekte der Literatur über Emigration und Widerstand im Dritten Reich zwischen dem 35. und 40. Jahrestag des 20. Juli 1944 Die historische Forschung in den ehemaligen Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland hat sich nach Kriegsende erst allmählich in mehreren Entwicklungspha- sen und keineswegs geradlinig mit dem Widerstand gegen Hitler als einem bedeuten- den Phänomen der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 beschäftigt, da ins- besondere das Vorhandensein einer deutschen Opposition gegen den Nationalsozia- lismus von den Alliierten in den ersten Jahren nach 1945 tabuisiert worden war. Diese Haltung der Besatzungsmächte wirkte auch in der Historiographie lange nach. Die ersten deutschsprachigen Arbeiten zu diesem Thema mußten im Ausland veröffent- licht werden. Nachdem sich die Geschichtsschreibung dann zuerst um den faktischen Nachweis sowie die besondere Würdigung und Rehabilitierung des »Anderen Deutschlands« bemüht hatte, standen danach geschlossene Darstellungen und Deu- tungen des bürgerlich und militärisch-konservativ orientierten Widerstandes als Aus- druck der Gewissensentscheidung gegen das verbrecherische System der Nationalso- zialisten und die detaillierte Beschreibung der Aktion vom 20. Juli 1944 im Mittel- punkt der Untersuchungen. Der sichtbare Umsturzversuch vom 20. Juli erhielt sym- bolische Bedeutung für die Begriffsbestimmung -

Jagd Auf Die Klügsten Köpfe
1 DEUTSCHLANDFUNK Redaktion Hintergrund Kultur / Hörspiel Redaktion: Ulrike Bajohr Dossier Jagd auf die klügsten Köpfe. Intellektuelle Zwangsarbeit deutscher Wissenschaftler in der Sowjetunion. Ein Feature von Agnes Steinbauer 12:30-13:15 Sprecherin: An- und Absage/Text: Edda Fischer 13:10-13:45 Sprecher 1: Zitate, Biografien Thomas Lang Sprecher 2: An- und Absage/Zwischentitel/ ov russisch: Lars Schmidtke (HSP) Produktion: 01. /02 August 2011 ab 12:30 Studio: H 8.1 Urheberrechtlicher Hinweis Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in §§ 44a bis 63a Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © - unkorrigiertes Exemplar - Sendung: Freitag, d. 05.August 2011, 19.15 – 2 01aFilmton russisches Fernsehen) Beginn bei ca 15“... Peenemünde.... Wernher von Braun.... nach ca 12“(10“) verblenden mit Filmton 03a 03a 0-Ton Boris Tschertok (russ./ Sprecher 2OV ) Im Oktober 1946 wurde beschlossen, über Nacht gleichzeitig alle nützlichen deutschen Mitarbeiter mit ihren Familien und allem, was sie mitnehmen wollten, in die UdSSR zu transportieren, unabhängig von ihrem Einverständnis. Filmton 01a hoch auf Stichwort: Hitler....V2 ... bolschoi zaschtschitny zel darauf: 03 0-Ton Karlsch (Wirtschaftshistoriker): 15“ So können wir sagen, dass bis zu 90 Prozent der Wissenschaftler und Ingenieure, die in die Sowjetunion kamen, nicht freiwillig dort waren, sondern sie hatten keine Chance dem sowjetischen Anliegen auszuweichen. Filmton 01a bei Detonation hoch und weg Ansage: Jagd auf die klügsten Köpfe. Intellektuelle Zwangsarbeit deutscher Wissenschaftler in der Sowjetunion. Ein Feature von Agnes Steinbauer 3 04 0-Ton Helmut Wolff 57“ Am 22.Oktober frühmorgens um vier klopfte es recht heftig an die Tür, und vor der Wohnungstür stand ein sowjetischer Offizier mit Dolmetscherin, rechts und links begleitet von zwei sowjetischen Soldaten mit MPs im Anschlag. -

Luise Holzapfel
Please take notice of: (c)Beneke. Don't quote without permission. Luise Holzapfel (14.03.1900 Höxter/Weser - 21.09.1963 Berlin) Dozentin der Chemie, sowie zur Geschichte der „klingenden“ Gele (ringing gels) und der Gelkristallisation (Juni 2005) Klaus Beneke Institut für Anorganische Chemie der Christian-Albrechts-Universität D-24098 Kiel [email protected] 2 Luise Holzapfel (14.03.1900 Höxter/Weser - 21.09.1963 Berlin) Dozentin der Chemie, sowie zur Geschichte der „klingenden“ Gele (ringing gels) und der Gelkristallisation Luise Holzapfel wurde am 14. März 1900 in Höxter an der Weser geboren. Ihr Vater Wilhelm Holzapfel (1859 - 1922) war Geheimer Oberjustizrat, einer der Großväter war Kreisrichter. Ihre Mutter Elsa (geb. Schmidt; geboren 1869) war Hausfrau. Es bedeutete für die Familie, da sie gut begütert war, keine Schwierigkeit der Tochter eine angemessene höhere Mädchenschulbildung zu finanzieren. Luise Holzapfel ging neun Jahre auf das Privatlyzeum Kirstein in Charlot- tenburg, wo sie das Reifezeugnis erhielt. Von 1916 bis 1918 besuchte sie das Groß- herzogliche Viktoriapensionat Karlsruhe in Baden. Luise Holzapfel Von 1918 bis 1919 arbeitete Luise Holzapfel im Kriegspresseamt der Obersten Heeresleitung im Archiv der Abteilung für fremde Presse und begann danach ein Musikstudium das sie 1922 beendete. Danach arbeitete sie bis 1924 in der Legationskasse des Auswärtigen Amtes. Die Jahre 1924 bis 1927 verbrachte Luise Holzapfel zu Hause im Haushalt, die Umstände sind nicht bekannt (CAUER, 1963; VOGT, 1999; VOGT, 2000). In der Zeit von 1928 bis 1934 arbeitete Luise Holzapfel in der Grundstück- und Vermögensverwaltung der Wollank´schen Familienstiftung. In dieser Zeit reifte wohl der der Gedanke Naturwissenschaften zu studieren und dazu besuchte sie nebenher das 3 Abendgymnasium. -

Joshua Telser Curriculum Vitae
JOSHUA TELSER CURRICULUM VITAE Department of Biological, Physical, and Health Sciences voice: 1 312 341 3687 Roosevelt University fax: 1 312 341 4358 430 S. Michigan Ave. E-mail: [email protected] Chicago, IL 60605-1394 USA Website: http://blogs.roosevelt.edu/jtelser/ EDUCATION: Northwestern University, Evanston, IL; USPHS/NIH Postdoctoral Fellow, September 1984 – September 1986. Postdoctoral advisor: Prof. Brian M. Hoffman. University of Florida, Gainesville, FL; Ph.D. in Inorganic Chemistry, December 1984. University of Illinois, Urbana, IL; graduate student in Inorganic Chemistry, 1980 – 1983. Thesis advisor: Prof. Russell S. Drago (deceased). Cornell University, Ithaca, NY; A.B. in Chemistry (with distinction), May 1980. WORK EXPERIENCE: 9/95 – present: Associate Professor of Chemistry, Roosevelt University, Chicago/Schaumburg, IL; Chemistry Program Coordinator, 1998 – 2000. Assistant Chair, Department of Biological, Chemical and Physical Sciences, 2005 – 2012; 2016 – 2018; Assistant Chair, Department of Biological, Physical, and Health Sciences, 2018 – present. 9/90 – 9/95: Assistant Professor of Chemistry. Taught General Chemistry I and II (CHEM 201, 202), Organic Chemistry Survey (CHEM 210), Inorganic Chemistry (CHEM 341/441), Organometallic Chemistry (CHEM 319/419), Bioinorganic Chemistry (BCHM/CHEM 344/444), and Analytical, Organic, Inorganic, and Physical Chemistry Laboratory courses (CHEM 203, 210, 347, 325), Chemistry Seminar (CHEM 393/493). Research in paramagnetic resonance and magnetic properties of inorganic and biological systems. 9/89 – 9/90: Research Associate, Department of Biochemistry, University of Chicago, Chicago, IL. Research on enzyme catalysis using nitroxide spin-labeled substrates and vanadyl-nucleotide complexes. 4/88 – 9/89: Research Investigator, Contrast Media Department, Squibb Institute for Medical Research, New Brunswick, NJ. -

HEBERLE (RUDOLF) PAPERS Mss
RUDOLF HEBERLE PAPERS Mss. 1921, 2254, 2345 Inventory Compiled by Ingeborg Wald 2004 Revised by Bradley J. Wiles 2009 Louisiana and Lower Mississippi Valley Collections Special Collections, Hill Memorial Library Louisiana State University Libraries Baton Rouge, Louisiana State University HEBERLE (RUDOLF) PAPERS Mss. 1921, 2254, 2345 1918-1991 SPECIAL COLLECTIONS, LSU LIBRARIES CONTENTS OF INVENTORY SUMMARY ........................................................................................................................ 3 BIOGRAPHICAL/HISTORICAL NOTE .......................................................................... 4 SCOPE AND CONTENT NOTE ....................................................................................... 7 LIST OF SUBGROUPS, SERIES, AND SUB-SERIES .................................................... 9 LIST OF CORRESPONDENTS....................................................................................... 10 INDEX TERMS ................................................................................................................ 11 CONTAINER LIST .......................................................................................................... 12 Use of manuscript materials. If you wish to examine items in the manuscript group, please fill out a call slip specifying the materials you wish to see. Consult the Container List for location information needed on the call slip. Photocopying. Should you wish to request photocopies, please consult a staff member. Do not remove items to be photocopied. -

Hermann Cohen's Das Princip Der Infinitesimal-Methode
Hermann Cohen’s Das Princip der Infinitesimal-Methode: The History of an Unsuccessful Book Marco Giovanelli Abstract This paper offers an introduction to Hermann Cohen’s Das Princip der Infinitesimal-Methode (1883), and recounts the history of its controversial reception by Cohen’s early sympathizers, who would become the so-called ‘Marburg school’ of Neo-Kantianism, as well as the reactions it provoked outside this group. By dissecting the ambiguous attitudes of the best-known represen- tatives of the school (Paul Natorp and Ernst Cassirer), as well as those of several minor figures (August Stadler, Kurd Lasswitz, Dimitry Gawronsky, etc.), this paper shows that Das Princip der Infinitesimal-Methode is a unicum in the history of philosophy: it represents a strange case of an unsuccessful book’s enduring influence. The “puzzle of Cohen’s Infinitesimalmethode,” as we will call it, can be solved by looking beyond the scholarly results of the book, and instead focusing on the style of philosophy it exemplified. Moreover, the paper shows that Cohen never supported, but instead explicitly opposed, the doctrine of the centrality of the ‘concept of function’, with which Marburg Neo-Kantianism is usually associated. Long Draft 24/12/2015 Introduction Hermann Cohen’s Das Princip der Infinitesimal-Methode (Cohen, 1883) was undoubtedly an unsuccessful book. Its devastating reviews are customarily mentioned in the literature, but less known and perhaps more significant, is the lukewarm, and sometimes even hostile, reception the book received from Cohen’s early sympathizers. Some members of the group dissented publicly, while others expressed their discomfort in private correspondence. -

20 Jahre Helmholtz-Gemeinschaft
2 3 INHALT 49 Im Gespräch – Vorsitzende und Präsidenten von 1995–2015 50 Joachim Treusch 5 54 Detlev Ganten 58 Walter Kröll 7 Vorwort 62 Jürgen Mlynek 9 Die Helmholtz-Gemeinschaft in historischer Perspektive 121 Die Gemeinschaft und ihre 18 Forschungs zentren 66 Die Helmholtz-Gemeinschaft 122 Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum im Porträt für Polar- und Meeresforschung 124 Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 70 Forschungsbereiche auf einen Blick 126 Deutsches Krebsforschungszentrum 72 Energie 128 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 80 Erde und Umwelt 130 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 88 Gesundheit Erkrankungen (DZNE) 96 Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr 132 Forschungszentrum Jülich 104 Materie 134 GEOMAR Helmholtz-Zentrum 112 Schlüsseltechnologien für Ozeanforschung Kiel 136 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 138 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie 140 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 142 Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 144 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ 146 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung 148 Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt 150 Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ 152 Karlsruher Institut für Technologie 154 Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch 156 Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 159 Impressum 6 Liebe Leserinnen und Leser, 7 die Geschichte der Helmholtz-Gemeinschaft ist auch eine Geschichte der Forschung in der Bundesrepublik -

Cv Pascalfries.Pdf
Prof. Dr. Pascal Fries Tel: (+49) (0)69 96 769 500 Director Fax: (+49) (0)69 96 769 555 Ernst Strüngmann Institute (ESI) for Neuroscience in [email protected] Cooperation with Max Planck Society http://www.esi-frankfurt.de http://www.esi- Deutschordenstraße 46 frankfurt.de/research/fries-lab 60528 Frankfurt am Main CV Prof. Dr. Pascal Fries 10 June 2021 Citations Date of birth 28 January 1972 Education 2000 Ph.D. from Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt, Medical School. Supervisor: Prof. Wolf Singer, Max Planck Institute for Brain Research, Frankfurt, Germany. 1998 M.D. from Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt, Medical School, Frankfurt, Germany. Professional Since 2009 Director of the Ernst Strüngmann Institute (ESI) for experience Neuroscience in Cooperation with Max Planck Society, Frankfurt, Germany. Since 2008 Scientific Member of the Max Planck Society. Since 2008 Professor of Systems Neuroscience, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands. 2001 - 2009 Principal Investigator, F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands. 1999 - 2001 Postdoctoral Research Fellow with Dr. Robert Desimone, Laboratory of Neuropsychology, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland. 1998 - 1999 Postdoctoral Research Fellow with Prof. Wolf Singer, Max Curriculum Vitae | Prof. Dr. Pascal Fries 1 Planck Institute for Brain Research, Department of Neurophysiology, Frankfurt, Germany. 1998 - 1999 Residency at the Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt, Medical School, Department of Psychiatry, Frankfurt, Germany. Awards and Honors 2020 2020 Web of Science Highly Cited Researcher (formerly known as “ISI highly Cited of Thomson Reuters). 2019 2019 Web of Science Highly Cited Researcher 2018 2018 Web of Science Highly Cited Researcher 2017 2017 Web of Science Highly Cited Researcher 2016 2016 Web of Science Highly Cited Researcher 2008 Boehringer Ingelheim FENS (Federation of European Neuroscience Societies) Research Award.