Versuch Gegen Libertarismus Und Monopolismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

President for the Americas, Intercontinental Hotels Group
CCO-CHAIRSHAIRS STEVEN A. BALLMER MICHAEL R. BLOOMBERG JULIÁN CASTRO BOB IGER CEO, Microsoft Mayor, City of Mayor, City of Chairman & CEO Corporation New York San Antonio Walt Disney Co. J.W. MARRIOTT, JR. RUPERT MURDOCH JIM MCNERNEY MICHAEL NUTTER Chairman & CEO, Chairman, CEO & Founder, Chairman, CEO & Mayor, City of Marriott International News Corporation President, Boeing Philadelphia MEMBERS JIM ABRAHAMSON SAM ALTMAN SCOTT AVEDISIAN President for the Americas, CEO, Loopt Mayor, Warwick, Rhode Island InterContinental Hotels Group PABLO AMBRAM LINDA AVEY SAM ADAIR Co-Founder, Agent Piggy Co-Founder & CEO, Curious, Inc. Founding Partner, Graham Adair ERNESTO ANCIRA, JR. ROBERT BABCOCK JOE ADAME President & CEO, Ancira Enterprises, Inc. President, Babcock, Scott & Babcock Mayor, Corpus Christi, Texas RICHARD H. ANDERSON DOUGLAS M. BAKER WELBORN ADAMS CEO, Delta Air Lines, Inc. Chairman, President, and CEO, Mayor, Greenwood, South Carolina Ecolab, Inc. BRUNO ALMEIDA ANKIT AGARwaL Founder & Managing Director, MILT BAKER President & CEO, Imbed Biosciences, Inc. U.S. Media Consulting CEO, Blue Water Satellite Inc. AMIT AHARONI TARIK ANSARI RUBEN BARRALES Co-Founder & CEO, CruiseWise CEO & Co-Founder, Mojo President & CEO, San Diego Regional Chamber of Com- STEVEN AHLENIUS LÉO APOTHEKER merce President & CEO, President & CEO, Hewlett-Packard McAllen Chamber of Commerce DAVID BARGER President & CEO, JetBlue Airways JIM ARDIS MADAN AHLUwaLIA Mayor, Peoria, Illinois Managing Attorney, Ahluwalia Law P.C. DAVID BARBER President & CEO, Barber Foods -

IN the UNITED STATES BANKRUPTCY COURT for the DISTRICT of DELAWARE in Re
Case 18-11120-BLS Doc 592 Filed 11/27/18 Page 1 of 69 IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE In re: Chapter 11 VG Liquidation Inc., et al.,1 Case No. 18-11120 (BLS) Debtors. (Jointly Administered) AFFIDAVIT OF SERVICE STATE OF CALIFORNIA } } ss.: COUNTY OF LOS ANGELES } Anthony P. Robinson, being duly sworn, deposes and says: 1. I am employed by Omni Management Group, located at 5955 DeSoto Avenue, Suite 100, Woodland Hills, CA 91367. I am over the age of eighteen years and am not a party to the above- captioned action. 2. On November 21, 2018, I caused to be served the: Notice/Debtors' Motion for Allocation of Proceeds from the Sale of Substantially All of the Debtors’ Assets [Docket No. 582] By causing true and correct copies to be served as follows: I. Docket No. 582 (i) via e-mail to those parties listed on the annexed Exhibit A and (ii) via first-class mail, postage pre-paid to the names and addresses of those parties on the annexed Exhibit B, /// 1 The Debtors in these cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number, are: VG Liquidation, Inc. (f/k/a Videology, Inc.) (2191), Collider Media, Inc. (8602), VG MT Liquidation LLC (f/k/a Videology Media Technologies, LLC) (6243), LucidMedia Networks, Inc. (8566), and VG Liquidation Ltd. (f/k/a Videology Ltd.), a company organized under the laws of England and Wales. The address of the Debtors’ corporate headquarters is 1500 Whetstone Way, Suite 200, Baltimore, MD 21230. -

Warwick.Ac.Uk/Lib-Publications
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/153079 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications COMPLEX GOVERNANCE AND SEAZONES: THE FLOATING ISLAND PROJECT IN FRENCH POLYNESIA 2020 Ph.D. Thesis by Nathalie Mezza-Garcia A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of. Doctor of Philosophy at the University of Warwick Complex Governance and SeaZones: The Floating Island Project Nathalie Mezza-Garcia Supervised by Emma Uprichard & Nathaniel Tkacz A thesis submitted in partial fulfilment for the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies University of Warwick Centre for Interdisciplinary Methodologies January 2020 Esta tesis está dedicada a mi mamá y a mi papá. Por toda una vida de apoyo incondicional. This thesis is dedicated to my mum and dad, for a lifetime of love and unconditional support. II I think the next century will be the century of complexity Stephen W. Hawking III Table of Contents LIST OF APPENDIXES ......................................................................................... VIII ACKNOWLEDGEMENTS ...................................................................................... -

Idea Floated for a Startup Colony Anchored in Pacific Ocean 17 March 2013, by Jessica Guynn
Idea floated for a startup colony anchored in Pacific Ocean 17 March 2013, by Jessica Guynn Even here in the world capital of far-fetched ideas, for sweeping immigration reform. And - for the first this one is more outlandish than most. Two Silicon time - Silicon Valley leaders think they have a real Valley entrepreneurs, frustrated by the shortage of shot at getting more high-tech visas for foreign visas that keep some of the world's brightest talent. science and engineering minds from building companies on dry land, have hatched a plan to Executives have met with President Barack build a startup colony in the middle of the Pacific. Obama and lawmakers. They are planning a nationwide social media campaign, or "virtual Max Marty and Dario Mutabdzija say they plan to march," to encourage people to use the Internet - park a cruise ship 12 nautical miles off the coast of email, Facebook, Twitter - to tell lawmakers they Northern California in international waters. Foreign- want immigration reform - a grass-roots tactic that born entrepreneurs would live and work on the last year helped Silicon Valley rally opposition to ship, building startups within commuting distance proposed legislation to combat piracy and of Silicon Valley. They wouldn't need the work established the high-tech industry as a political visas that are so hard to come by. They would just force. Silicon Valley has also begun to quietly lobby need business tourism visas that would let them lawmakers in the Republican-controlled House. ferry back and forth to Silicon Valley once or twice a week. -

Enhancing American Competitiveness Through Skilled Immigration Hearing Committee on the Judiciary House of Representatives
ENHANCING AMERICAN COMPETITIVENESS THROUGH SKILLED IMMIGRATION HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON IMMIGRATION AND BORDER SECURITY OF THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED THIRTEENTH CONGRESS FIRST SESSION MARCH 5, 2013 Serial No. 113–15 Printed for the use of the Committee on the Judiciary ( Available via the World Wide Web: http://judiciary.house.gov U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 79–724 PDF WASHINGTON : 2013 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402–0001 COMMITTEE ON THE JUDICIARY BOB GOODLATTE, Virginia, Chairman F. JAMES SENSENBRENNER, JR., JOHN CONYERS, JR., Michigan Wisconsin JERROLD NADLER, New York HOWARD COBLE, North Carolina ROBERT C. ‘‘BOBBY’’ SCOTT, Virginia LAMAR SMITH, Texas MELVIN L. WATT, North Carolina STEVE CHABOT, Ohio ZOE LOFGREN, California SPENCER BACHUS, Alabama SHEILA JACKSON LEE, Texas DARRELL E. ISSA, California STEVE COHEN, Tennessee J. RANDY FORBES, Virginia HENRY C. ‘‘HANK’’ JOHNSON, JR., STEVE KING, Iowa Georgia TRENT FRANKS, Arizona PEDRO R. PIERLUISI, Puerto Rico LOUIE GOHMERT, Texas JUDY CHU, California JIM JORDAN, Ohio TED DEUTCH, Florida TED POE, Texas LUIS V. GUTIERREZ, Illinois JASON CHAFFETZ, Utah KAREN BASS, California TOM MARINO, Pennsylvania CEDRIC RICHMOND, Louisiana TREY GOWDY, South Carolina SUZAN DelBENE, Washington MARK AMODEI, Nevada JOE GARCIA, Florida RAU´ L LABRADOR, Idaho HAKEEM JEFFRIES, New York BLAKE FARENTHOLD, Texas GEORGE HOLDING, North Carolina DOUG COLLINS, Georgia RON DeSANTIS, Florida KEITH ROTHFUS, Pennsylvania SHELLEY HUSBAND, Chief of Staff & General Counsel PERRY APELBAUM, Minority Staff Director & Chief Counsel SUBCOMMITTEE ON IMMIGRATION AND BORDER SECURITY TREY GOWDY, South Carolina, Chairman TED POE, Texas, Vice-Chairman LAMAR SMITH, Texas ZOE LOFGREN, California STEVE KING, Iowa SHEILA JACKSON LEE, Texas JIM JORDAN, Ohio LUIS V. -

A Broken Immigration System at Work
The Insightful Immigration Blog Commentaries on Immigration Policy, Cases and Trends http://blog.cyrusmehta.com THE BLOCKING OF AN ENTREPRENEUR: A BROKEN IMMIGRATION SYSTEM AT WORK Author : Cyrus Mehta 3D printing technology is about to revolutionize the way we understand manufacturing, and the country that takes the lead in this new technology will be the winner ofwhat The Economist magazine has called the third industrial revolution. A state of the art hearing aid or a high tech component for a military jet can be designed through a computer and printed on an unattended 3D printer as a solid functioning object. Yet, the US Customs and Border Protection on the Canadian border recently refused admission to a dual national Canadian/British entrepreneur JF Brandon who is part of a startup called D Shape – which has developed a large-scale 3D printer that will revolutionize the way architectural design is planned, and building constructions are executed. By simply pressing the “enter” key on the keypad D Shape gives the architect the possibility to make buildings directly, without intermediaries who can add interpretation and realization mistakes. Although refused entry into the United States, Mr. Brandon participated in a panel discussion on February 13, 2012 at Brooklyn Law School in New York entitled Immigration Policy and Entrepreneurship: Challenges and Pathways for Startups. Thanks to technology that has now become so routine, he could participate through Skype from overseas, and told a riveted audience that he had been refused entry under a NAFTA TN visa to work for D Shape in New York, which is limited to certain occupational categories and applies to Canadian and Mexican citizens. -
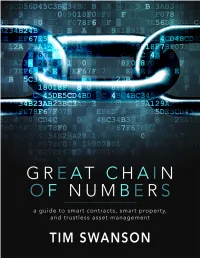
Smart Contracts, Smart Property and Trustless Asset Management
Great Chain of Numbers: A Guide to Smart Contracts, Smart Property and Trustless Asset Management By Tim Swanson 1 © Copyright 2014 by Tim Swanson Cover art credit: Matt Thomas and Invisible Order This manuscript is released under the Creative Commons - Attribution 4.0 International license: to copy, transmit, share, adapt, remix, make commercial use of and freely distribute this work. 2 Contents Foreword ....................................................................................................................................................... 6 Preface .......................................................................................................................................................... 8 Acknowledgements ..................................................................................................................................... 10 Glossary ....................................................................................................................................................... 11 Chapter 1: Introduction .............................................................................................................................. 12 Keeping an Open Mind ........................................................................................................................... 12 Altcoins.................................................................................................................................................... 13 Chapter 2: Smart Contracts........................................................................................................................ -

Conclusions and Solutions John H
CHAPTER SEVEN Conclusions and Solutions John H. Cochrane, Lee E. Ohanian, George P. Shultz Part 1: John H. Cochrane Why and How We Care about Inequality Wrapping up a wonderful conference about facts, our panel is sup- posed to talk about “solutions” to the “problem” of inequality. We have before us one “solution,” the demand from the left for confi scatory income and wealth taxation and a substantial enlarge- ment of the control of economic activity by the state. Note I don’t say “redistribution,” though some academics dream about it. We all know there isn’t enough money, especially to address real global poverty, and the sad fact is that government checks don’t cure poverty. President Obama was refreshingly clear, calling for confi scatory taxation even if it raised no income. “Off with their heads” solves inequality, in a French-Revolution sort of way, and not by using the hair to make wigs for the poor. Th e agenda includes a big expansion of spending on govern- ment programs, minimum wages, “living wages,” government control of wages, especially by minutely divided groups, CEO pay regulation, unions, “regulation” of banks, central direction of all fi nance, and so on. Th e logic is inescapable. To “solve inequality,” don’t just take money from the rich. Stop people, and especially the “wrong” people, from getting rich in the fi rst place. HH6781.indb6781.indb 114747 110/22/150/22/15 77:40:16:40:16 AAMM 148 John H. Cochrane, Lee E. Ohanian, George P. Shultz In this context, I think it is a mistake to accept the premise that inequality, per se, is a “problem” needing to be “solved,” and to craft “alternative solutions.” Just why is inequality, per se, a problem? Suppose a sack of money blows in the room. -
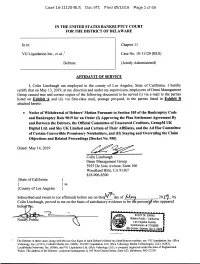
Case 18-11120-BLS Doc 971 Filed 05/14/19 Page 1 of 69 Case 18-11120-BLS Doc 971 Filed 05/14/19 Page 2 of 69
Case 18-11120-BLS Doc 971 Filed 05/14/19 Page 1 of 69 Case 18-11120-BLS Doc 971 Filed 05/14/19 Page 2 of 69 EXHIBIT A Case 18-11120-BLS Doc 971 Filed 05/14/19 Page 3 of 69 VG Liquidation Inc., et al. - Service List to e-mail Recipients Served 5/13/2019 ARENT FOX LLP ARENT FOX LLP ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP JORDANA RENERT ROBERT M. HIRSH BRIAN J. LOHAN [email protected] [email protected] [email protected] ASSISTANT ATTORNEY GENERAL OF MI BALLARD SPAHR LLP BALLARD SPAHR LLP KATHERINE KERWIN CHANTELLE D. MCCLAMB MATTHEW G. SUMMERS [email protected] [email protected] [email protected] BARNES & THORNBURG LLP BARNES & THORNBURG LLP BARNES & THORNBURG LLP DAVID POWLEN KEVIN COLLINS PAUL LAURIN [email protected] [email protected] [email protected] BAYARD, P.A. BAYARD, P.A. BIALSON, BERGEN & SCHWAB DANIEL N. BROGAN JUSTIN R. ALBERTO THOMAS GAA [email protected] [email protected] [email protected] BUCHALTER, APC BUCHALTER, APC CAREFIRST BLUECROSS BLUESHIELD ARIEL A. BERRIOS WILLIAM S. BRODY DIANE FLOWERS [email protected] [email protected] [email protected] CHIPMAN, BROWN, CICERO & COLE, LLP CIARDI CIARDI & ASTIN COLE SCHOTZ PC MARK L. DESGROSSEILLIER JOHN D. MCLAUGHLIN, JR IRVING E. WALKER [email protected] [email protected] [email protected] COLE SCHOTZ PC COOLEY LLP COOLEY LLP PATRICK J. REILLEY EVAN LAZEROWTIZ MAX SCHLAN [email protected] [email protected] [email protected] COOLEY LLP COOLEY LLP DAVIS & GILBERT LLP MICHAEL KLEIN SETH AALTEN CURT MYERS [email protected] [email protected] [email protected] DAVIS & GILBERT LLP DECHERT, LLP DECHERT, LLP. -

Technologyquarterly December 3Rd 2011
Fooling the body’s Superconductors, Hybrids reinvent defence systems 100 years on the wheel TechnologyQuarterly December 3rd 2011 Cities on the ocean Libertarians dream of creating self-governing fl oating colonies. Will the idea sink or swim? TQCOV-December03-2011.indd 1 21/11/2011 17:30 The Economist Technology Quarterly December 3rd 2011 Monitor 1 Contents On the cover Libertarians dream of creating self-governing, ocean-going cities. To do so they must work out how to build seasteads in the rst place; nd a way to escape the legal shackles of sovereign states; and give people a good reason to move in. What are More than just digital quilting their chances? Page 8 Monitor 1 The rise of the maker movement, multispectral document scanning, humans as computers, computerised Technology and society: The maker movement could change how science is pathology, a new way to monitor corrosion, measuring taught and boost innovation. It may even herald a new industrial revolution the viscosity of tomato sauce, HE scene in the park surrounding New York’s Maker Faire was a pavilion labelled and who won our innovation TYork’s Hall of Science, on a sunny with an obscure Italian name: Arduino awards this year weekend in mid-September, resembles a (meaning strong friend). Inside, visitors futuristic craft fair. Booths displaying were greeted by a dozen stands displaying Dierence engine handmade clothes sit next to a pavilion credit-card-sized circuit boards. These are 7 The devil in the details full of electronics and another populated Arduino micro-controllers, simple com- The mathematics of buying a by toy robots. -

Financial Literacy and Numeracy
Statement of John R. Dearie Executive Vice President The Financial Services Forum Testimony before the Subcommittee on Contracting and Workforce of the Committee on Small Business United States House of Representatives September 11, 2014 Table of Contents Introduction………………………………………………………………………………...3 Not Just Small Businesses—New Businesses……………………………………………...4 On the Road with America’s Job Creators………………………………………………....9 “Not Enough People with the Skills We Need”…………………………………………..11 “Our Immigration Policies Are Insane”…………………………………………………..18 “Not All Good Ideas Get Funded Anymore”……………………………………………..28 “Over-Regulation is Killing Us”………………………………………………………….40 “Tax Payments Can Be the Difference Between Survival and Failure”………………….47 “There’s Too Much Uncertainty—and It’s Washington’s Fault”………………………..52 Policy Recommendations………………………………………………… ……………..61 Conclusion………………………………………………………………………………..66 Endnotes………………………………………………………………………………….69 2 Introduction Chairman Hanna, Ranking Member Meng, thank you very much for the invitation to participate in this important hearing. During the Great Recession of 2008-2009 and the difficult year that followed, nearly nine million American jobs were eliminated. The damage to U.S. labor markets was the most extensive, in both absolute and percentage terms, since the Great Depression, destroying all employment base growth over the previous decade. Just as alarming—and in stark contrast to the historical pattern of deep recessions being followed by sharp rebounds—more than five years after the Great Recession, annualized economic growth remains a subpar 2 percent and nearly 20 million Americans remain either out of work, underemployed, or have left the workforce discouraged. Indeed, August was the 50th month in the past 51 in which more unemployed Americans left the workforce discouraged than found jobs. According to the Brookings Institution’s Hamilton Project, America will likely not return to pre-recession levels of employment until 2018. -
Entrepreneur Inspiration 2017
ENTREPRENEUR INSPIRATION ##### ##### ##### Roger James Hamilton !1 www.geniusu.com Edition 2 Welcome Hello, A few years ago, I began writing and posting images and stories on Facebook that inspired me as an Entrepreneur. Early in 2015, I put them into a Facebook album. The album went viral and has now been shared over 400,000 times and the different stories within the album had also been shared a combined 1,000,000+ times across different social media channels. In 2016 I published the stories into an ebook. With the number of new stories in the last year, it was time for a second issue. That’s what you’re reading right now. Here is the link to the Facebook album. Here is the link to the download page. If you have chosen to subscribe by email, you’ll get links to my stories. And you can subscribe to my FB profile, to get my new posts on your FB newsfeed. As the Founder of Entrepreneurs Institute, Entrepreneur Resorts and GeniusU, and as the Creator of Wealth Dynamics and Talent Dynamics, my mission is to support the entrepreneur movement. I’ve made this book free so it’s simple to share. If you are inspired by the stories within it, share the album and stories on Facebook, and share the link to this download with your entrepreneur friends. Keep shining brightly, Roger James Hamilton www.rogerjameshamilton.com !2 www.geniusu.com Table of Contents RESILIENCE 10 How tough is your journey? 11 The Monk Moment 13 Will Smith’s story 15 Are you between a rock and a hard place? 17 A story of what's possible 20 How resilient are you? 23 Would you