Schulkreisplanung Bucheggberg Primarschule + Kindergarten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
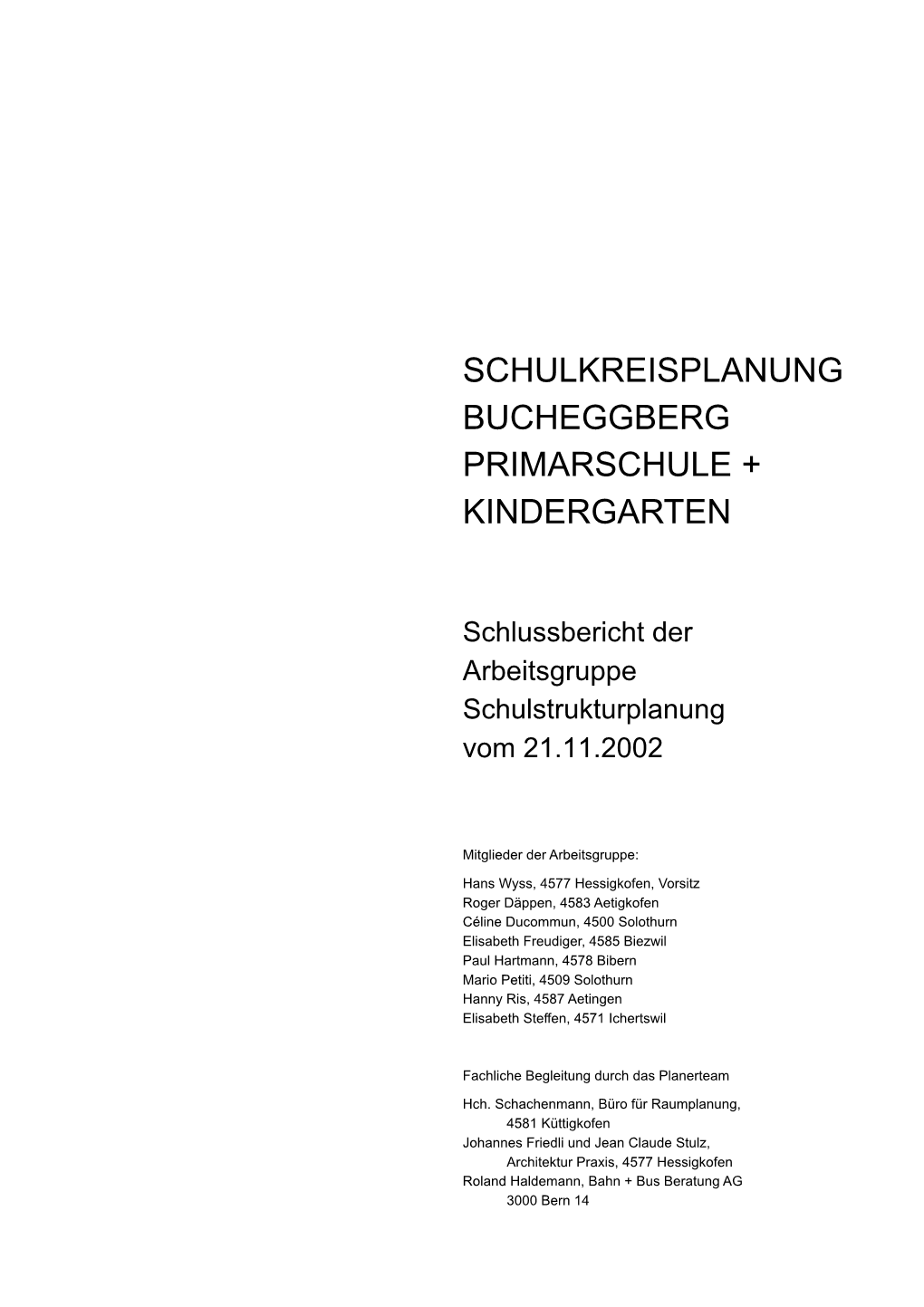
Load more
Recommended publications
-

Info Buchegg 03.21.Indd
INFOS APRIL 2021 Gossliwil – Im ehemaligen Gasthof Sternen entstehen Wohnungen. Der «Sternen» ist auf Antrag der Eigentümer unter Schutz gestellt worden und behält sein gewohntes, uns allen lieb gewordenes Aussehen. Die Gemeinde Buchegg verändert sich Bevölkerungsstatistik Kyburg-Buchegg – Es entstehen neue Wohneinheiten mit Blick auf die Alpen. Stichtag Aetigkofen Aetingen Bibern Brittern Brügglen Gossliwil Hessigkofen Küttigkofen Kyburg-Buchegg Mühledorf Tscheppach Total 31.12.2014 2514 31.12.2015 190 219 246 74 199 189 268 268 332 351 181 2517 31.12.2016 189 239 252 75 198 188 257 263 328 364 182 2535 31.12.2017 204 248 240 72 196 187 265 265 341 348 186 2552 31.12.2018 210 246 241 74 198 187 275 268 348 363 175 2585 31.12.2019 212 228 255 71 199 180 258 265 355 355 183 2561 31.12.2020 206 211 246 69 198 177 256 263 366 348 181 2521 ie Statistik zeigt, dass Buchegg nach der Fusion wuchs, in den letzten zwei Jahren jedoch einen leichten Rückgang der Bevölkerung zu ver- Dzeichnen hat. Wir haben nun im Bausektor in einigen Dörfern dafür gesorgt, dass es in Zukunft wieder neu zuziehende Familien geben wird. Mit dem Unterschutzstellen einiger Gebäude wurde eine bessere Nut- 1 2 3 4 5 6 1 Gossliwil – im Restaurant Kreuz sollen Wohnungen entstehen, aber auch das Restaurant soll bald wieder für die Bevölkerung zum Treffpunkt werden. zung des Volumens möglich, so geschehen in eingefügt. Auch so kann ohne Neueinzonung 2 Mühledorf – Schlosserei Hugi, Arbeits- Tscheppach, in Aetingen beim Aebi-Haus, etc. -

Überbauung Bänimatt, Gemeinde Buchegg / Ortsteil Mühledorf Verkaufsdokumentation
Überbauung Bänimatt, Gemeinde Buchegg / Ortsteil Mühledorf Verkaufsdokumentation Die Aarplan Architekten AG, Solothurn, hat auf der Parzelle Bäni- matt, GB Nr. 286, der Gemeinde Buchegg, Ortsteil Mühledorf, ein Vorprojekt für deren Überbauung erarbeitet. Das Grundstück steht im Eigentum von Christian Zimmermann aus Baden. In der vorliegende Verkaufsdokumentation wird interessierten aufge- zeigt, wie die 6 geplanten Wohneinheiten, zwei freistehende Einfa- milienhäuser und zwei Doppel-Einfamilienhäuser mit grosszügigem Umschwung, ausgestaltet werden sollen. Zudem wird die Organisa- tion des Verkaufs beschrieben. Aarplan Architekten AG Hermesbühlstrasse 67 T 032 628 25 25 Postfach 160 [email protected] CH-4502 Solothurn www.aarplan.ch Projektbeschrieb Überbauung Bänimatt, Buchegg / Ortsteil Mühledorf 10 Wohneinheiten geplant im MINERGIE-P® Standard 1 Dokument1 Druck: 25.04.19 1128-Baubeschrieb_Verkauf Amt für Geoinformation geo.so.ch/map 0 0 0 3 0 6 2 1221000 1221000 Gemeinde Buchegg / Ortsteil Mühledorf Die Parzellen liegen am Rande des historisch gewachsenen Orts- teil Mühledorf. Das Gelände ist ansteigend und bietet von allen Wohneinheiten gegen Südosten eine schöne Aussicht ins Tal und auf das Dorf. Westlich grenzt das Grundstück an die Landwirt- schaftszone, im Norden an den Wald. Mühledorf war bis am 31.12.2013 eine eigenständige politische Gemeinde im Bezirk Bucheggberg des Kanton Solothurn. Auf den 1.1.2014 schlossen sich die zehn Gemeinden Aetigkofen, Aetingen (inklusive Brittern), Bibern, Brügglen, Gossliwil, Hessig- kofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf und Tscheppach zur Gemeinde Buchegg zusammen. Die Gemeindeverwaltung mit integrierter Poststelle für alle Ortsteile befindet sich in Mühledorf selbst. Mühledorf liegt auf 557 m.ü.M, neun Kilometer südwestlich des Kantonshauptortes Solothurn (Luftlinie). Das langgestreckte Stras- sendorf erstreckt sich in der Mulde des oberen Mühletals, im Zentrum des Bucheggberges, im Solothurner Mittelland. -

Konf-Unterricht Aetingen-Mühledorf 2020/21
Konf-Unterricht Aetingen-Mühledorf 2020/21 Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden des Konfjahres 2021, liebe Eltern, mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Übersicht über die Kursdaten des Konfjahres 2020/21. Ziel des Konfunterrichts ist, verschiedene Aspekte des christlichen Glaubens und Lebens der Kirchgemeinde kennenzulernen und einen eigenen Zugang zu bekommen. Dazu wollen wir eine gute, interessante und sinnvoll gefüllte Zeit miteinander verbringen. Um manche Kursmodule durchführen zu können, haben wir ab und zu einen Samstag und Mittwochnachmittage eingeplant. Die Termine sind mit der Schule (Schulverband Bucheggberg) abgesprochen. Die Kantonsschule wird auch von uns informiert. Im ersten Semester und im Konflager sind wir als Gesamtgruppe unterwegs. Ab Januar 2021 treffen wir uns in den Gruppen, die dann auch gemeinsam (in Aetingen oder Mühledorf) konfirmiert werden. Bitte notiert diese Termine gleich in der «Familienagenda». Merci ! Datum Gruppe 1 Aetingen Gruppe 2 Mühledorf Gemeinsam Mittwoch, Eltern-Konf-Abend: 19. August, 19 Uhr Kennenlernen Vorstellen des Konzepts Samstag, Seilpark Balmberg – Thema: 19. September, Vertrauen 9 – ca. 13.30 Uhr Kosten: 10,- CHF Samstag, Waldtag – Thema: Nachhaltig 31. Oktober, leben 9 – 13.30 Uhr Mitarbeit: Natur- und Vogelschutzverein, Paul Storchenegger Mittwoch, Besuch des Friedhofs – 11. November, Thema: Sterben, Tod und 13.30 – 16.30 Uhr Auferstehung Vorbereitung und Samstag, Mitgestaltung des 21. November, Gottesdienstes am 9 – 12 Uhr Ewigkeitssonntag Mitarbeit: Friedhofsgärtner Sonntag, 22. Roland Marti November, 9.30 Uhr Mittwoch, Diakonie – Begegnung 9. Dezember, wagen: Besuch des 13.30 – 16.30 Uhr Blumenhauses Mitarbeit: Ursi Marti, HPRU Dorothea Neubert Schulgässli 5 – 4587 Aetingen – 032 661 10 27 [email protected] – www.aetingen-muehledorf.ch Datum/ Inhalt Gruppe 1 Aetingen Gruppe 2 Mühledorf Gemeinsam Dienstag, Finden des Finden des 12. -

Der Reformierte Gottesdienst Zu Aetingen Und Mühledorf
Der reformierte Gottesdienst zu Aetingen und Mühledorf Autor(en): Walliser, Peter Objekttyp: Article Zeitschrift: Jurablätter : Monatsschrift für Heimat- und Volkskunde Band (Jahr): 16 (1954) Heft 3 PDF erstellt am: 26.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-861643 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch der -

Schülerfahrplan Nach Lüterkofen Gültig Ab 16
Schülerfahrplan nach Lüterkofen Gültig ab 16. August 2021 Linie 885 Mühletal Diese Schulkurse fahren neu ab Buchegg, Post. Ort Vormittag Nachmittag PS* KG** Lüterkofen, Schulhaus ab 07:44 14:01 Gächliwil, Wendeplatz ab 07:34 13:51 Gächliwil, Alte Post ab 07:33 07:53 13:50 Aetigkofen, Dorf ab 07:31 07:54 13:48 Mühledorf SO, Kirche ab 07:29 07:56 13:46 Mühledorf SO, Sternen ab 07:28 07:57 13:45 Brügglen SO, Ochsenbeinschmiede ab 07:27 07:59 13:44 Brügglen SO, alte Post ab 07:26 08:00 13:43 Buchegg, Post ab 07:25 08:01 13:42 Buchegg, Schloss / Dorf ab 07:32 08:01 13:46 Buchegg, Blumenhaus ab 07:33 08:02 13:47 Küttigkofen, Schulhaus ab 07:35 08:04 13:49 Küttigkofen, Dorf ab 07:36 08:05 13:50 Küttigkofen, Bismarck ab 07:37 08:06 13:51 Lohn-Lüterkofen, Bahnhof ab 07:43 08:12 13:57 Lüterkofen, Schulhaus an 07:46 08:15 14:00 Schulbeginn 07:55 08:25 14:10 Schulschluss 11:55 11:55 15:55 16:55 Mo–Fr Mo–Fr Mo / Fr Mo/Di / Do/Fr Mo–Fr Lüterkofen, Schulhaus ab 12:05 12:02 16:03 16:02 17:03 Lohn-Lüterkofen, Bahnhof an 12:08 16:06 15:59 17:06 Küttigkofen, Bismarck an 12:10 16:08 17:08 Küttigkofen, Dorf an 12:11 16:09 17:09 Küttigkofen, Schulhaus an 12:13 16:11 17:11 Buchegg, Blumenhaus an 12:14 16:12 17:12 Buchegg, Schloss / Dorf an 12:14 16:12 17:12 Buchegg, Post an 12:14 12:09 16:12 16:09 17:12 Brügglen SO, alte Post an 12:15 12:10 16:13 16:10 17:13 Brügglen SO, Ochsenbeinschmiede an 12:16 12:11 16:14 16:11 17:14 Mühledorf SO, Sternen an 12:12 16:15 16:12 17:15 Mühledorf SO, Kirche an 12:13 16:16 16:13 17:16 Aetigkofen, Dorf an 12:15 16:18 16:15 17:18 Gächliwil, Alte Post an 12:17 16:20 16:17 17:20 Gächwil, Wendeplatz an 12:18 16:18 *PS Primarschule Kurs verkehrt in der Gegenrichtung **KG Kindergarten Änderungen vorbehalten per Fahrplanwechsel 12.12.2021 PostAuto AG Bahnhofstrasse 61 5000 Aarau Telefon +41 58 667 13 60 Schülerfahrplan nach Lüterkofen Linie 886 Biberntal – gültig ab 16. -

Info Buchegg September 2020
INFOS SEPTEMBER 2020 ACHTUNG: Häckselblatt integriert Wo liegt das? (Lösung auf der letzten Seite) Räumliches Leitbild Buchegg 2040 Seit 2014 bilden elf Dörfer die neue Gemeinde Buchegg. Bis heute Ortsbildschutz wurden nur gerade die Zonenreglemente zusammengeführt, hin- ISOS Nationale Bedeutung ISOS Regionale Bedeutung Kein Schutzstatus gegen gelten nach wie vor in jedem Dorf die bisherigen Ortspla- Aetingen Aetigkofen Brügglen nungen. Nun haben wir die Möglichkeit, mit einem gemeinsamen Gossliwil Küttigkofen Bibern Leitbild raumwirksame Tätigkeiten und die Entwicklung der Ge- Hessigkofen Brittern meinde Buchegg über die Dorfgrenzen hinaus zu gestalten. Ein Kyburg-Buchegg Mühledorf Leitbild ist keine Ortsplanung. Tscheppach ISOS = Inventar schützenswerter Ortsbilder Schweiz as Leitbild legt die behördenverbindlichen Rahmenbedingungen fest, auf welchen die Ortsplanung basieren muss. Mit dem revidier- Jahre. Zum Leitbild gehören auch drei Leitbildpläne. Eine Dorfanalyse mit Dten Raumplanungsgesetz und dem überarbeiteten kantonalen Richt- Siedlungsentwicklungskonzept ist ein weiterer Bestandteil des Leitbildes. plan wurden die Grenzen für kommunale Entwicklungen eng gesteckt. Der gesamte Gemeinderat, unterschiedlichste Interessengruppen, die Be- Innenentwicklung und Verdichtung sind Schlagworte, die auf den ersten völkerung und alle Generationen haben am Leitbild mitgearbeitet. Blick zeitgemäss erscheinen, auf den zweiten Blick aber mit den grössten- teils geschützten Ortsbildern häufig schwierig umzusetzen sind. Die Bau- Was wollen wir? -

Geschäftsbericht GEBNET AG 2017
Geschäftsbericht 2017 Jahresbericht und Jahresrechnung Unser Versorgungsgebiet: Buchegg Biezwil Lüterswil-Gächliwil Wengi Aetigkofen Bibern Gossliwil Hessigkofen Küttigkofen Kyburg-Buchegg Mühledorf Tscheppach Inhaltsverzeichnis Adressen und Organe der GEBNET AG 4 – 5 Berichte des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Geschäftsführers 6 – 7 Facts & Figures 8 – 9 Bilanz 10 – 11 Erfolgsrechnung 12 Anhang 13 Erläuterungen zur Bilanz 14 – 15 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16 – 18 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 19 4 | Adressen und Organe Adresse GEBNET AG Telefon 032 677 16 96 Hauptstrasse 21 Telefax 032 677 16 54 4583 Aetigkofen E-Mail [email protected] Website www.gebnet.ch Verwaltungsrat Präsident Guido Frenzer 4576 Tscheppach Vizepräsidentin Sabine Leuthold 3253 Schnottwil Mitglied Hans Neuenschwander BKW Energie AG 3013 Bern Sekretärin Astrid Jordi Frenzer 4576 Tscheppach Revisionsstelle BDO AG, Solothurn Adressen und Organe | 5 Organigramm Verwaltungsrat Geschäftsführer Peter Woodtli Kundendienst/ Leitung Netz Leitung Energie Administration Peter Hug Peter Woodtli Tiziana Mancino (80%) Personaladministration (40%) Sachbearbeiter Messwesen Daniela Burki Fritz Fankhauser Elektroinstallateur/ Kundendienst (40%) Sachbearbeiter Luzia Christen Jonas Klaus Sachbearbeiter Zählerableser Zähler- u. Datentechnik 8 MA (nach Bedarf) Dominic Mollet (ab 1.4.2018) 6 | GeschäftsleitungBericht des Präsidenten des Verwaltungsrats 2017 Unser Engagement für die Region Nachhaltig und erfolgreich führen wir unseren Weg fort – Starkes Betriebsergebnis -

Liniennetz Bern
www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 30.000 Region Bern Liniennetz Bern Liniennetz Bern Münchenbuchsee Hüslimoos Seedorf–Lyss Wahlendorf Zollikofen 105 104 Bahnhof Jetzikofen- KirchlindachKirchlindach Oberlindach Webergut- Schäferei Blinden- Wydacker strasse Kirche Friedhof Käserei strasse schule Weissenstein Abzw. 107 Säriswil 106 Hirzenfeld 36 102 34 Biel/Bienne Möriswil Abzw. Schützenrain Solothurn Burgdorf 113 101 Schulhaus Kreuz Schulhaus GeisshubelErlachplatz Schüpfenried Ortschwaben Betagten- Oberzollikofen Gehracker heim 34 Alte Post Bahnhof Post Postgasse Unterzollikofen 41 Breitenrain Aarberg Uettligen Dorf KänelgasseGrubenwegReichen- Bahnhof Altikofen Nord Heimenhaus bach Aeschebrunnmatt Steinibach West 100 Schule Aarmattweg Herrenschwanden Bahnhof Illiswil Riedhaus Ausserort- Oeschenweg Altikofen Süd Fischrainweg schwaben Dorf Aarestrasse Schaufelacker Friedhagweg 33 Talgut Zentrum Oberdettigen BremgartenKunoweg Bremgarten Bremgarten 36 Breitenrain Oberwohlen 21 Post Worblaufen Sandhof Schloss Bahnhof Wylergut Wohlen Gemeindehaus Mööslimatt Kalchacker 26 Bennenboden Chutze Scheibenrain Thalmatt Jaunweg Stauffacher- brücke 36 M‘buchsee Hüslimoos Hinterkappelen Fährstr. Pillonweg Wylerbad West Post Aumatt Ländli Sustenweg Schulhaus Wyler- Felsenau- Tiefenau Wylergut Winkelriedstr. Kappelenring Nord 101 Schlossmatt strasse huus Seftau Dändliker- 20 33 Breitfeld Rossfeld Felsenau weg 41 Ost Hinterkappelen Bernstrasse Halenbrücke Äussere Enge Bahnhof Aare kirche Wankdorf Innere Enge Schützen- Markus- Eymatt Camping 11 Haldenstr. -

Zonenplan Bern Libero
Zonenplan Waldenburg Langenbruck Egerkingen Passwang 282 Breitenbach Zwingen Mümliswil Holderbank Ramiswil Industrie Olten Oberbuchsiten Laupersdorf Matzendorf Balsthal Thalbrücke 281 Aedermannsdorf Neuendorf 280 Klus Olten Herbetswil Nieder- Unterdorf 279 Oensingen buchsiten Moutier Welschenrohr Zone 250: Niederbipp Industrie Kestenholz Niederbipp Rain Nur für Abonnemente Vorder- Wolfwil Olten sowie Tageskarten Oberbalmberg Balmberg Wolfisberg Oberbipp Gänsbrunnen Farnern Holzhäusern ALLE ZONEN gültig Balm Längmatt Rumisberg Olten b. Günsberg Wiedlisbach 215 Günsberg Oberdorf SO Bannwil Murgenthal Grenchenberg Moutier 201 Niederwil Aarwangen Rüttenen Attiswil Vorstadt Roggwil – Wynau Im Holz Langendorf Hubersdorf Flumenthal Walliswil b.W. 193 Hard-Mumenthal Kaltenherberg Lommiswil St. Niklaus SO Wangen Roggwil Dorf Holzerhütte Allmend Riedholz an d. Aare Gaswerk Hubel Amthaus- Heimenhausen IndustrieLangenthal Nord St. Urban platz Däderiz Studen Baseltor Feldbrunnen Wangenried Breitenfeld Allmend Ziegelei 216 Bützberg Lingeriz Selzach West Deitingen Röthenbach b.H. 190 191 250 Solothurn Süd Obersteckholz Bellach Zuchwil Luterbach- Lotzwil Grenchen Attisholz Sonnmatt Brühl Inkwil Am Wald Nord Bettlach Gutenburg Lengnau 201 Wanzwil Rotwald Monbijou Grenchen 200 Subingen Etziken Bolken Bleienbach Niederönz Madiswil Biel/Bienne Industrie Altreu Lüsslingen Horriwil ThunstettenThörigen Derendingen Hüniken Herzogenbuchsee Melchnau Grenchen Süd Ost Nennigkofen Lindenholz Biberist RBS Aeschi 192 BBZ 201 Oekingen Oberönz Oberdorf Altbüron Flughafen -

Steuerverordnung Nr. 15: Bemessung Des Mietwertes Der Eigenen Wohnung
614.159.15 Steuerverordnung Nr. 15: Bemessung des Mietwertes der eigenen Wohnung Vom 28. Januar 1986 (Stand 1. Januar 2007) Der Regierungsrat des Kantons Solothurn Der Regierungsrat des Kantons Solothurn gestützt auf §§ 28 Absatz 3, 118 Absatz 2 und 264 Absatz 2 des Gesetzes über die Staats- und Gemeinde- steuern vom 1. Dezember 19851) beschliesst: § 1 I. Gebäude durchschnittlicher Bauart 1. Pauschalansätze 1 Als Gebäude durchschnittlicher Bauart gilt ein Gebäude dann, wenn die Katasterschätzung, welche auf die selbst benützte Wohnung entfällt, nicht mehr als 240‘000 Franken beträgt.* 2 Der Mietwert von Wohnungen in Gebäuden durchschnittlicher Bauart wird in der Regel pauschal nach folgenden Prozentsätzen der auf die Woh- nung entfallenden Katasterschätzung für Gebäude und normalen Um- schwung bemessen:* Gemeindegruppe Prozentsatz I 10,63 II 10,02 III 9,42 IV 9,11 V 8,80 § 2 2. Gemeindegruppen 1 Die Gemeinden werden den Gruppen wie folgt zugeteilt: a)* Gruppe I: Solothurn; Feldbrunnen-St.Niklaus, Grenchen (ausser Staad); Olten. b)* Gruppe II: Bellach, Bettlach, Langendorf; Biberist, Derendingen, Ger- lafingen, Zuchwil; Balsthal, Egerkingen, Oensingen; Schönenwerd, Starrkirch-Wil, Wangen bei Olten; Trimbach; Dornach; Breitenbach. 1) BGS 614.11. GS 90, 384 1 614.159.15 c)* Gruppe III: Grenchen (nur Staad), Lommiswil, Niederwil, Oberdorf, Riedholz, Rüttenen, Selzach (ausser Altreu, Haag, Oberes Moos und Känelmoos); Lüsslingen, Lüterkofen-Ichertswil (ausser Ichertswil), Nennigkofen; Aeschi (ausser Burgäschi), Deitingen, Etziken, Kriegs- tetten, Lohn-Ammannsegg, Luterbach, Subingen; Härkingen, Kes- tenholz, Neuendorf, Niederbuchsiten, Oberbuchsiten; Däniken, Dul- liken, Gretzenbach (ausser Grod), Gunzgen (ausser Allmend), Hägen- dorf, Kappel, Rickenbach; Erlinsbach (nur Niedererlinsbach), Lostorf (ausser Mahren), Niedergösgen, Obergösgen, Winznau; Gempen, Hochwald, Hofstetten (ausser Flüh); Büsserach, Kleinlützel, Nunnin- gen. -

30.886 Lohn-Lüterkofen - Bibern - Gächliwil - Schnottwil - (Linie 886) Schnottwil - Messen - Oberramsern - Bätterkinden - (Linie 882) Stand: 9
FAHRPLANJAHR 2021 30.886 Lohn-Lüterkofen - Bibern - Gächliwil - Schnottwil - (Linie 886) Schnottwil - Messen - Oberramsern - Bätterkinden - (Linie 882) Stand: 9. November 2020 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage 88201 88203 88603 88601 88205 88605 88207 36307 88611 88211 88209 Bern ab 06 20 06 20 Lohn-Lüterkofen an 06 49 06 49 Solothurn ab 06 34 06 34 Lohn-Lüterkofen an 06 41 06 41 Lohn-Lüterkofen, Bahnhof 06 51 06 51 Lüterkofen, Dorf 06 52 06 52 Ichertswil, alte Post 06 54 06 54 Tscheppach, Post 06 56 06 56 Hessigkofen, Post 06 58 06 58 Bibern SO, Post 07 00 07 00 Gossliwil, Dorf 07 03 07 03 Gächliwil, Wendeplatz 07 05 07 05 Gächliwil, Wendeplatz 07 05 07 05 07 22 07 55 Lüterswil, Dorf 07 07 07 07 07 24 07 57 Biezwil, Dorf 07 09 07 09 07 26 07 59 Schnottwil, Schulhaus 07 12 08 02 Schnottwil, Post 07 12 07 14 07 29 08 04 Schnottwil, Post 06 12 06 42 07 27 07 31 08 04 Balm b. Messen, Wendeplatz 06 18 06 48 07 33 07 37 08 10 Messen, Post 06 21 06 51 07 36 07 40 08 13 Messen, Post 06 21 06 51 07 36 07 40 08 05 08 13 Messen, Dorfplatz 06 22 06 52 07 37 07 41 07 43 08 14 Messen, Schulhaus 07 39 07 43 08 16 Oberramsern 06 26 06 56 08 11 Unterramsern, Post 06 28 06 58 08 13 Brittern, Wirtschaft 06 29 06 59 08 14 Aetingen, Post 06 32 07 02 08 17 Kyburg Bad 06 34 07 04 08 19 Bätterkinden, Bahnhof 06 42 07 12 07 55 08 27 Bätterkinden ab 06 45 07 15 08 00 08 30 Bern an 07 11 07 41 08 26 08 56 Bätterkinden ab 06 45 07 15 08 00 08 30 Solothurn an 06 57 07 27 08 12 08 42 1 / 8 FAHRPLANJAHR 2021 30.886 Lohn-Lüterkofen - Bibern - Gächliwil - Schnottwil - (Linie 886) Schnottwil - Messen - Oberramsern - Bätterkinden - (Linie 882) Stand: 9. -

Liste Zu Übersichtsplan Gemeinde Buchegg Legende X.X Bänkli X.X Robidog X.X Sammelstellen Abfall/Recycling
Kanton Solothurn Liste zu Übersichtsplan Gemeinde Buchegg Legende X.X Bänkli X.X Robidog X.X Sammelstellen Abfall/Recycling Nummer Ortsteil Ort / Lage 1.1 Bibern Archwägli / Obermoos Waldecke 1.2 Bibern Archwägli / Untermoos Waldecke 1.3 Bibern Buechtürliweg Waldrand 1.4 Bibern Niderholzgraben Biotop 1.5 Bibern Abzweigung Wilermatt 1.6 Bibern Jörwäldli Waldrand 1.1 Bibern Neufeld Waldecke 1.2 Bibern Abzweigung Bodenacker 1.3 Bibern Abzweigung ARA 1.4 Bibern Brügmatten (Friedhof) 1.5 Bibern Wiler vor Wald 1.1 Bibern Gegenüber altes Schulhaus Nummer Ortsteil Ort / Lage 2.1 Hessigkofen Hauptsrasse höhe Rest. Sternen 2.2 Hessigkofen Kreuzung Schulhausweg / Weierweg 2.3 Hessigkofen Unter-Bockstein Waldrand 2.4 Hessigkofen Aspli im Wald 2.5 Hessigkofen Aspli Waldrand Seite Erlenhof 2.6 Hessigkofen Aspli Waldrand Seite Erlenhof 2.7 Hessigkofen Grosswald Wegkreuzung / Waldhaus 2.1 Hessigkofen Aspli Waldrand Seite Erlenhof 2.2 Hessigkofen Chrüzacker 2.3 Hessigkofen Neumatt Wegkreuzung 2.1 Hessigkofen Begegnungsplatz Nummer Ortsteil Ort / Lage 3.1 Mühledorf Oberhalb Quartier Widi 3.2 Mühledorf Herrenweg Waldrand 3.3 Mühledorf Stockacker Waldecke 3.4 Mühledorf Dählrain Waldrand 3.5 Mühledorf 2x Dählrain Waldrand Aspli 3.6 Mühledorf Abzweigung Ober-Bockstein/Bocksteinstrasse 3.7 Mühledorf Hinter Quartier Berghöfli bei Feldweg 3.8 Mühledorf Zwischen Martiloorain und Eichiberg 3.9 Mühledorf Abzweigung Wolftürli / Murli 3.10 Mühledorf Tannischlag Waldecke 3.11 Mühledorf Herrenweg Waldrand 3.12 Mühledorf Wolftürli im Wald 3.1 Mühledorf Widi richtung Wallisberg