Englgartgutacht4.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
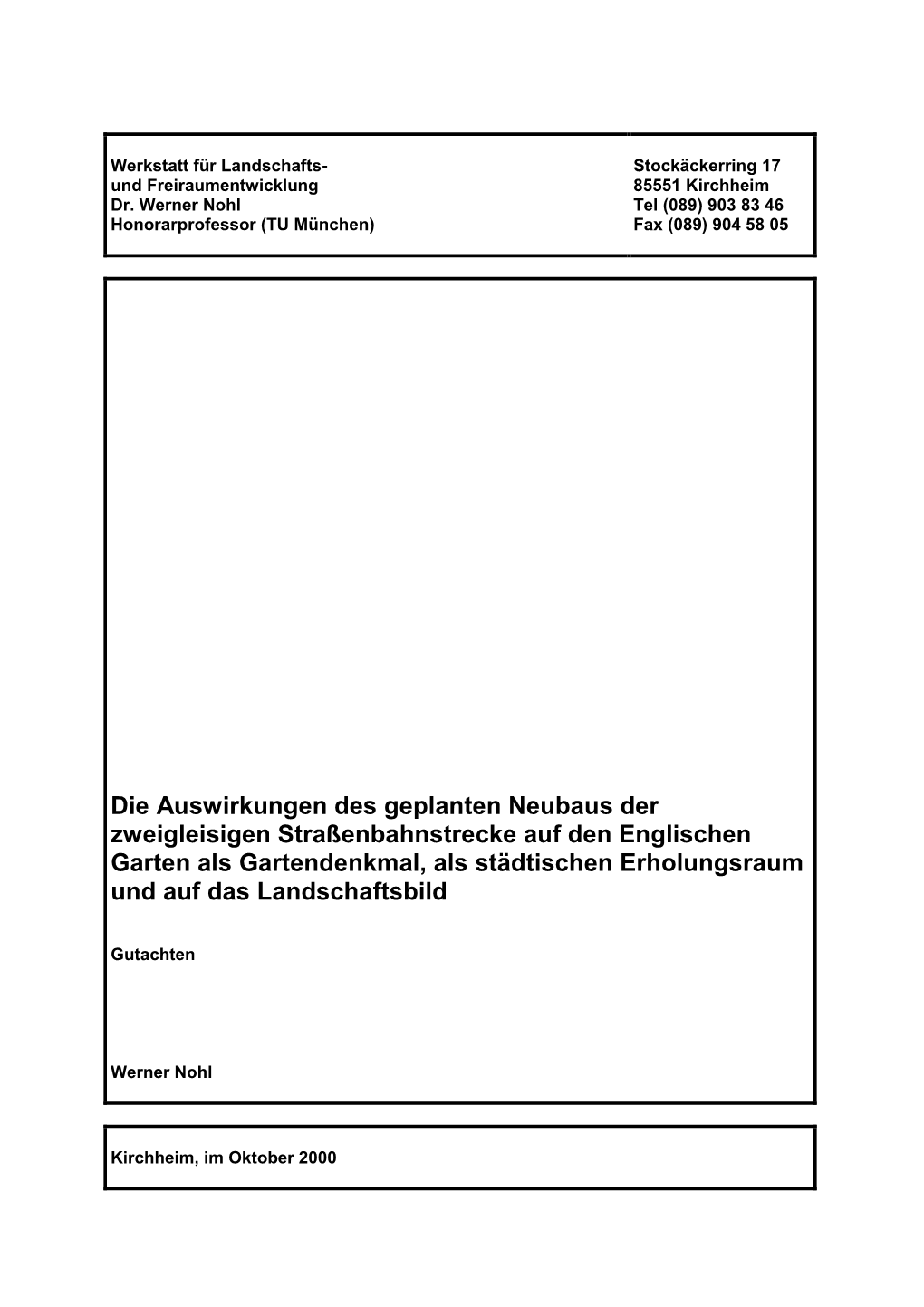
Load more
Recommended publications
-

Information Packet
13th EIPIN Congress Munich February 3 to February 5, 2012 Information Packet Overview Munich 4 1 5 2 3 6 1 A&O Hotel 5 Hofbräuhaus 2 Hotel „Motel One“ 6 Wirtshaus in der Au 3 European Patent Office public transportation 4 Max Planck Institute – MIPLC Accomodation A & O Hotel Hotel Motel One – Students – Lecturers, Institutional Representatives, Doctoral Candidates Motel One München Sendlinger Tor A & O Hotel München Hauptbahnhof Herzog-Wilhelm-Straße 28 Bayerstraße 75 80331 München 80335 München Phone: 0049 89 5177 725 0 Phone: 0049 89 4523 5757 00 http://www.motel-one.com/de/hotels/hotels-muenchen/hotel- http://www.aohostels.com/de/munich/city-hotel-munich/ muenchen-sendl-tor.html How to get there from the train station: How to get there from the train station: The hotel is next to the train station. Take either the U1 (Mangfallplatz) or the U2 (Kolumbusplatz), If you leave the train station through the main entrance, you’ll get off at “Sendlinger Tor” (1 stop). Leave the station into the enter “Bahnhofsplatz”. Turn right, walk down the direction of “Sendlinger Tor Platz”, cross the square, turn left “Bahnhofsplatz”, then turn right into “Bayerstraße” into “Herzog-Wilhelm-Straße” Availability: Day of arrival: from 3pm onwards you can leave your Availability: luggage at the Hotel before the conference and check in until Day of arrival: 24 hours 10 pm; please ask whether your room is already available Day of departure: until 12 am before 3pm Day of departure: until 10 am Conference Venue European Patent Office (EPO) Max Planck Institute (MPI) - MIPLC European Patent Office - Isargebäude Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Erhardtstr. -

Endless Shades of Green
Page 1 Munich's Parks and Gardens: Endless Shades of Green (March 1, 2017) Munich is sprawling. Munich is lively. And Munich is very green. Parks, gardens and the Isar river present the perfect counterpoint to the pulsing city beat, to sightseeing and shopping. The city can look back on a long tradition of historical gardens. The park of Nymphenburg Palace was established already in the 17th century and the English Garden in the 18th century. Today the locals and their guests can enjoy their time out in public parks extending over roughly 5,680 acres. Munich’s Most Royal Park You can’t help but feel princely when taking a stroll through the park of Nymphenburg Palace. In the gardens dating from the 18th century, small splendid buildings such as Amalienburg, Badenburg and Pagodenburg are waiting to be discovered. Basins, fountains, lakes, bridges, pavilions, enclosed and decorative gardens are perfectly suited to stimulate the visitor’s imagination. In the mood for a baroque garden? The historical canals, fountains and boscages in the park of Schleißheim Palace will take you back to a courtly past. Munich’s Greatest Park The English Garden with its 990 acres of parkland is said to be even larger than Central Park in New York. At any rate, it offers abundant space for sports activities and bicycling. The quiet and idyllic northern part with its vast meadows is the ideal Contact: Department of Labor and Economic Development München Tourismus, Trade & Media Relations Sendlinger Str. 1, 80331 München, Tel.: +49 89 233-30345 Email: [email protected], www.simply-munich.com Page 2 destination for those in search of rest and relaxation. -

Destination Factsheets 2021
HEART OF Altötting BAVARIA TOP SIGHTSEEING SEASONAL HIGHLIGHTS TOP DAY HIGHLIGHTS 2021–22 EXCURSIONS 01 Chapel of Grace – with the “Black May: Pentecost weekend sees the 01 Burghausen – with the world’s Madonna” on the Baroque Chapel arrival of thousands of pilgrims on longest medieval castle (1.051 m) Square (Kapellplatz) foot May/June: Traditional beer-festi- 02 Munich – capital of Bavaria with Neobaroque papal Basilica val “Hofdult” with 2 local brewer- the Oktoberfest, museums … 02 St. Anna – Altötting’s largest ies, traditional Bavarian music and church and built due to the increase costumes (beginning 1 week after 03 Lake Chiemsee – with the fairytale of pilgrims pentecost) castle “Herrenchiemsee”, commis- July: Altötting Monastery Market sioned by Ludwig II 03 Museum: Jerusalem Panorama at the Chapel Square –one of three crucifixion panorama Nov./Dec.: Altötting Christmas paintings world-wide and protected Market (on weekends) with DID YOU by UNESCO numerous Christmas concerts in KNOW THAT … traditional style of the alps 04 Treasury & Pilgrimage Museum the bridal wreath of the world-fa- – wealth of artistic votive offerings mous Austrian Empress “Sissi” is to Altötting, the Place of Mercy, CITY’S on display in the Altötting-Trea- including famous “Golden Horse” HISTORY sury? Altötting and Oberammergau can 05 Incense Museum – reveals the 1489 marks the beginning of the be combined in a religious round myth and the 3,000 year history of pilgrimage to Altötting in venera- trip through Bavaria? incense tion of the Virgin Mary. Two healing © Heiner Heine (2) © miracles are reported from that year with the first one being described as follows: A young boy fell into a nearby river. -

How to Reach Us Munich Office Directions
Munich Office Directions Theresienhof Theresienstraße 1 80333 Munich Germany Tel: +49 89 244 459800 Fax: +49 89 244 459801 How to reach us We are based at Contora Office Solutions in the Theresienhof e ß a r t building on Theresienstraße 1 in the Maxvorstadt area of Munich. s T g h i ere sie w nst d The office and reception are located on the first floor. raß u e Entrance L BSB There are two nearby underground stations: Odeonsplatz (lines Bayerische Staatsbibliothek U3/U6 or U4/U5) and Universität (lines U3/U6). Both stations are F approximately five minutes’ walk from the office. ü r s t e Franz Josef Strauss International Airport is located 30 km (19 miles) n Rh s einb t er r ge a rstra north east of the city centre. The airport is connected to the city by ß ße e Mewburn Ellis LLP Munich suburban railway (S-Bahn) lines S1 and S8. Take line S1 (50 Deutsche e ß Theresienhof a Os Bundesbank r kar- t minutes) or S8 (38 minutes) to Marienplatz. At Marienplatz take von s Theresienstraße 1 -M g il i ler-R 80333 Munich skar-von-M ing w underground lines U3/U6 to Odeonsplatz. Alternatively, the journey O iller- d Ring u Germany from the airport by car or taxi takes approximately 30 minutes. L M S Universität che l e L Th Neue ling U3 U6 inp er str ß ru e e aß a n si Pinakothek ß e r s D e t n a t ra s r e ß ac tr s e e aß t ß ß e s a g r i a h n t r e t a s w k s n u Technische r d e e d ü i e l u n T ß r Universität a L a a r S S m München t t A Ludwigskirche s r TUM h . -

Rosental 4 80331 Munich Germany
Englischer Rosental 4 Garten 80331 Munich Germany Von-der-Tann-Straße Brienner Straße Odeonsplatz U Brienner Straße Odeonsplatz Barer Straße Hofgarten Elisenstraße Residenz Franz-Josef-Strauß-Ring Maximiliansplatz Karl-Scharnagl-Ring Hauptbahnhof U S Bayerische Staatsoper Karlsplatz Bayerstraße Karlsplatz (Stachus) U S Frauenkirche Neues Rathaus © Deka Immobilien GmbH g Maximilianstraße n i map R U S - r Marienplatz e + e m ß m T 49 (0)89 69312 2950 a i r r t s W + n - e s F 44 (0)89 69312 2999 n a n m o o S h T e ß a r Viktualienmarkt t s f r o d www.dyoung.com Isartor s Frauenstraße in Z te w S S Isar e [email protected] i b r ü c Sendlinger Tor k U M Corneliusstraße e n st Blumenstraße ra ße Deutsches Patent- und Markenamt ße Gärtnerplatz ra Lindwurmstraße st dt ar Deutsches rh E Museum Directions Our Munich office is located on Rosental, the street that connects Rindermarkt and the famous Viktualienmarkt. Air The office is best reached by the S-Bahn. Take the S1 or S8 line to Marienplatz. Take exit E and turn right onto Rindermarkt. Walk past the Löwenturm on the left and turn left onto Rosental. Rosental 4 is situated on the left hand side with a sign reading “LEOMAX”. S-Bahn The nearest S-Bahn station is Marienplatz. Take exit E and turn right onto Rindermarkt. Walk past the Löwenturm on the left and turn left onto Rosental. Rosental 4 is situated on the left hand side with a sign reading “LEOMAX”. -

Christmas Markets of Munich & Vienna
Christmas Markets 8 DAYS of Munich & Vienna December 5–12, 2020 Speak to a travel expert today 1-800-438-7672 © 2018 EF Education First Christmas Markets of Munich & Vienna 8 DAYS Feel the holiday magic in Germany and Austria. YOUR TOUR PACKAGE INCLUDES Whether it's because of the twinkling lights or the colorful storefront window displays, 6 nights in handpicked hotels 6 breakfasts the beauty of Munich and Vienna shines brightest in December. Join fellow Group 1 lunch Coordinators and Go Ahead Tours staff as you explore the best Christmas markets and 3 dinners with beer or wine Guided sightseeing tours soak in the seasonal cheer in each destination. In between listening to festive music and Expert Tour Director & local guides sipping mulled wine, you’ll enjoy plenty of time to talk all things travel. Private deluxe motor coach INCLUDED HIGHLIGHTS Convention Tour meeting and networking, Munich’s Christmas markets, artisan toy shop visit, Christmas carol performance, Viennese orchestra concert, Vienna’s Christmas markets, Kunsthistorisches Museum, Spanish Winter Riding School show TOUR PACE On this guided tour, you’ll walk for about 1 hour daily across moderately uneven terrain, including cobblestone streets and paved roads, with few hills or stairs. Speak to a travel expert today 1-800-438-7672 © 2018 EF Education First Itinerary Overnight flight | 1 NIGHT Day 6 (Thursday, December 10): Sightseeing tour of Vienna & evening Christmas market visit Day 1 (Saturday, December 5): Travel day Included meals: breakfast Board your overnight flight to Munich today. Get transported back to the Age of Empires on a guided tour of Vienna, filled with bright holiday lights and seasonal specialties at its many Christmas markets. -

National Socialism in Munich“ in Socialism National – Remembrance P
TGP_4_plan_engl:TGP_2_plan_engl 14.10.2010 10:41 Uhr Seite 1 37 41 ቕ Informa tion board ቕ 45 46 43 47 21 ቕ 44 Tram 20 16 47 ቕ 22 40 24 ቕ 39 42 23 15 ቕ 29 Memorial to the victims ቕ 25 35 30 of National 13 ቕ 14 34 Socialism Memorial 38 to the 33 27 resistance to 32 National 28 Socialism ቕ 19 18 31 ቕ ቕ 36 17 26 ቕ 12 Tram 11 5 10 ቕ 4 9 6 ቕ 48 Tram Tram Tram 7 49 Pre-1933 Church organisations 8 “City of art” Party organisations 1 ቕ 3 Nazi cult Reich central offices 2 Persecution Branch offices ThemenGeschichtsPfad Professional Local/regional associations government Main route ቕ Audio point National Socialism Detour in Munich Source: Amtlicher Stadtplan der Landes haupt stadt München, © 2005 Landeshauptstadt München Munich City Kommunalreferat Vermessungsamt 50 Museum List of places mentioned in the ThemenGeschichtsPfad Square brackets denote pre-1945 adresses 1 New Town Hall; Marienplatz 8 p. 9 16 Widening of Von-der-Tann-Straße to lead up 26 Chamber of Commerce and Industry; 39 Bavarian Protestant Church; to the Haus der Deutschen Kunst p. 39 Max-Joseph-Straße 2 [Maximiliansplatz 8] p. 58 Katharina-von-Bora-Straße 13 [Arcisstraße 13] p. 72 2 Old Town Hall; Marienplatz 15 p. 11 Memorial to the resistance to 27 Reich leadership of the National Socialist Association 40 Former Papal nunciature (until 1934); staff of Hitler’s 3 Marienplatz p. 9 National Socialism (1996); Hofgarten of German Lecturers; Max-Joseph-Straße 4 [6] p. -

JAHRESBERICHT 2017 JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT Inhalt
JAHRESBERICHT 2017 JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT Inhalt 6 Kontinuum und Kaleidoskop der Museumsarbeit 122 05 Fördervereine Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Jahre 2017 | Bernhard Maaz 123 Pinakotheks-Verein | Mirjam Neumeister 124 PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne / Stiftung Pinakothek der Moderne | Bernhart Schwenk 18 01 Projekte und Ereignisse 125 International Patrons of the Pinakothek e. V. / American Patrons of the Pinakothek Trust | Corinna Thierolf 19 #MusMuc17, Online-Sammlungen und die Kunstwerke der Moderne | Antje Lange 22 Die Restaurierung von Sandro Botticellis Beweinung Christi | Eva Ortner und Andreas Schumacher 128 06 Stiftungen 23 Bestandskatalog der Florentiner Malerei | Andreas Schumacher und Patrick Dietemann 129 Stiftung Ann und Jürgen Wilde | Simone Förster 27 Anselm Kiefer – Ein neuer Künstlerraum für die Pinakothek der Moderne | Corinna Thierolf 130 Fritz-Winter-Stiftung | Anna Rühl 131 Max Beckmann Archiv und Max Beckmann Gesellschaft | Eva Reich 34 02 Ausstellungen, Erwerbungen, Leihverkehr, Publikationen 134 Theo Wormland-Stiftung | Oliver Kase 35 Ausstellungen 135 Olaf Gulbransson Gesellschaft e. V. Tegernsee | Sandra Spiegler 42 Erwerbungen 62 Leihverkehr 137 07 Institutionsgeschichte und Provenienzforschung 64 Publikationen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 138 Fortgesetzter Rückblick 68 Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Provenienz- und institutionsgeschichtliche Beiträge | Bernhard Maaz 140 Van Eyck in Neuschwanstein 74 03 Doerner Institut Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, -

Germany - Munich ID Description Duration Ch Category 1 Bookshop Ambience: Int
Soundeffects.ch City Sounds - Germany - Munich ID Description Duration Ch Category 1 Bookshop Ambience: Int. Quiet Bookshop Ambience With Few Visitors PART 1, Few Voices, Some Noise From Cash Register, Some German Voices, Location: Munich, Germany 02:00.005 6 Bookshop, Ambience 2 Bookshop Ambience: Int. Quiet Bookshop Ambience With Few Visitors PART 2, Few Voices, Some Noise From Cash Register, Some German Voices, Location: Munich, Germany 02:00.005 6 Bookshop, Ambience 3 City Ambience, Munich: Ext. Munich City Traffic, Day, Summer, PART 1, Ambulance Siren Approaches From Distance And Passing By At 0:14, Cars And Tram, Tram Passing By At 0:54, Some Pedestrians, 02:00.005 6 City, Ambience Location: Munich, Germany 4 City Ambience, Munich: Ext. Munich City Traffic, Day, Summer, PART 2, Constant City Traffic, Far Distant Church Bells, Some German Voices, Car Signal Horn, Footsteps, Location: Munich, Germany 02:00.005 6 City, Ambience 5 City Ambience, Munich: Ext. Munich City Place 'Max Joseph Platz' Day, Summer, PART 1, Quiet City Place Atmosphere, Distant Traffic, Reverberant Voices, Children, Footsteps, Distant Tram Passing By 02:00.005 6 City, Ambience At 1:26, Location: Munich, Germany 6 City Ambience, Munich: Ext. Munich City Place 'Max Joseph Platz' Day, Summer, PART 2, Quiet City Place Atmosphere, Distant Traffic, Voices From Children, Teenagers, Pedestrians, Distant Aircraft 02:00.005 6 City, Ambience Rumbles, Tram Passing By At 1:06, Location: Munich, Germany 7 City Ambience, Munich: Ext. Munich City Park 'Hofgarten', Day, Summer, PART 1, Quiet City Park Atmosphere With Very Distant Traffic Noise, Distant Voices, Some Birds, Location: Munich, Germany 02:00.005 6 City, Ambience 8 City Ambience, Munich: Ext. -
![Directions to JLL Munich [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/3455/directions-to-jll-munich-pdf-4073455.webp)
Directions to JLL Munich [PDF]
JLL Munich Directions From the airport • Take the S1 or S8 train into the city. It will take you about 40 minutes to get to Marienplatz or the main train station “Hauptbahnhof” From Marienplatz • Change at Marienplatz to the U3 subway, direction Moosach, or the U6 subway to Garching for one stop to Odeonsplatz;.Take the exit to the north. • After 250 m to your right, you will find JLL From main train station • Take the Bus No. 100 to Ostbahnhof, and get off at the 4th stop Von-der-Tann-Straße – JLL is just across the street • Or take the subway (U-Bahn) U4 (to Arabellapark) or U5 (to Neuperlach Süd) to the 2nd stop Odeonsplatz. Exit to the north, and 250 meters to your right you will find JLL A9 from Nürnberg • At the end of the autobahn take the exit Schwabing and stay on the right lane (not into the tunnel!) • After 300 m at the first traffic light turn left into Leopoldstraße • Follow this street for about 5 km, to the intersection Ludwig-/Von-der-Tann-Straße • The building at the left corner is Ludwigstraße 8. Access to underground parking is at the northside of the building, via Schönfeldstraße A8 aus Richtung Salzburg • At the Autobahnkreuz Brunnthal head for München Zentrum (A8) to the end of the autobahn • Follow the Rosenheimer Straße always straight on, cross the river Isar and in front of the Isartor turn right to Thomas-Wimmer-Ring • follow this street and keep left into Von-der-Tann-Straße, then take the right lane to the next corner (not into the tunnel!) – this is Ludwigstraße 8. -

Enjoyment Tour
Page 1 Enjoyment Tour Route Map Sights Start at Marienplatz square, archway of ►1 Old town Hall - documented for the the old town hall first time in 1310 through the Tal to Isartor and continue ►2 Deutsches Museum - the world's straight via Ludwigsbrücke bridge, largest museum of technology and then make a sharp right turn, pass science under the bridge and follow the Müllersches Volksbad - opened in Isarradweg bike path downriver 1901, it's magnificent art nouveau design makes it one of Europe’s most beautiful indoor pools pass Maximilianeum and ►3 Maximilianeum - seat of the Friedensengel and continue through Bavarian parliament; Friedensengel Herzogpark to the Oberföhring barrage - Angel of Peace of the Isar river, at the barrage follow the middle Isar canal on the right in an outbound direction until the wooden bridge of St.-Emmeram cross the bridge and bike through the ►4 in the quiet northern part of the English Garden following the signs to park, which is one of the world's the “Aumeister” beer garden largest urban public parks, there is the beer garden "Aumeister", Contact: Department of Labor and Economic Development München Tourismus, Trade & Media Relations Sendlinger Str. 1, 80331 München, Tel.: +49 89 233-xxx Email: [email protected], www.einfach-muenchen.de Page 2 where you might take a break continue along the Schwabinger Bach ►5 Chinesische Turm - listening to brook, simply follow the signs live music at the “Chinaturm” as the “Chinesischer Turm”, passing the beer 25 m high wooden construction is gardens in Hirschau and the Seehaus lovingly called by the locals, you at Kleinhesseloher See lake, you come can indulge in a typical Bavarian to the Chinese Tower snack, the beer garden that extends around the park’s landmark offers 7,000 seats, it is the city’s second largest beer garden and a popular destination for weekend excursions walk to Monopteros, the rotunda on a small hill was finished in 1836 and offers a breathtaking view of the southern part of the city park and the old town continue to the city center, after approx. -

Anfahrtsplan Zu JLL München Im
JLL München Anfahrtsplan Vom Flughafen • S-Bahn S1 oder S8 Richtung Innenstadt, bis zum Marienplatz oder Hauptbahnhof Vom Marienplatz mit ÖPNV • Am Marienplatz in die U3 Richtung Moosach oder U6 Richtung Garching umsteigen, bis zum Odeonsplatz, Ausstieg in Fahrtrichtung, ca. 250 m Richtung Norden • Die Ludwigstraße 8 ist auf der rechten Seite Vom Hauptbahnhof mit ÖPNV • Mit dem Bus 100 bis zur Ecke Oskar-von-Miller-Ring/Ludwigstraße, Haltestelle Von-der-Tann-Straße, dort über die Kreuzung bis zur Ludwigstraße 8 • Mit der U4 oder U5, Richtung Arabellapark bzw. Neuperlach Süd, 2 Stationen bis Odeonsplatz, Ausstieg Richtung Norden, ca. 250 m, über die Von-der-Tann-Straße, auf der rechten Seite ist die Ludwigstraße 8 Mit dem Auto • Bis zum Autobahnende, Ausfahrt Mittlerer Ring West, Schwabing A9 aus Richtung Nürnberg • An der Tunnelabfahrt vorbei und die erste Abzweigung links in die Leopoldstraße • Geradeaus, bis zum Altstadtring/Von-der-Tann-Straße (Entfernung ca. 5 km) • Die Ludwigstraße 8 ist auf der linken Seite an der Ecke A8 aus Richtung Salzburg • Autobahnkreuz Brunnthal in Richtung München (nicht Richtung Giesing) • Am Autobahnende geradeaus entlang der Rosenheimer Straße • Am Ende links abbiegen, über die Ludwigsbrücke • Vorbei am Deutschen Museum bis zum Isartor • Rechts in den Thomas-Wimmer-Ring einbiegen und bis zur Von-der-Tann-Straße • Links abbiegen bis zur Ecke Ludwigstraße, hier ist es das Eckhaus Jones Lang LaSalle SE | Ludwigstraße 8 | 80539 München | tel: +49 89 290088 0 1/3 A95 aus Richtung • Am Autobahnende A95 in Sendling weiter Richtung Stadtmitte Garmisch-Partenkirchen • Über den Luise-Kiesselbach-Platz • Halbrechts in die Albert-Roßhaupter-Straße bis zum Ende Harras • Links Richtung Stadtmitte • 2.