Der Sippenf Hrer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Schedule of the Day by Session
SCHEDULE OF THE DAY BY SESSION CHECK-IN AND VENDOR TABLES OPEN 7:15 TO 8:00 AM .................................................................................................................... 2 OPENING CEREMONY 8:00 - 8:15 AM ........................................................................................................................................ 2 SESSION 1 - 8:20 – 9:10 AM ....................................................................................................................................................... 2 SESSION 2 - 9:15 – 10:00 AM ..................................................................................................................................................... 6 SESSION 3 - 10:10 – 11:00 AM ................................................................................................................................................... 9 SESSION 4 11:05 – 11:55 AM ................................................................................................................................................... 12 LUNCH - 12:00PM - 12:30PM .................................................................................................................................................... 16 PROGRAM - 12:30 PM - 1:45 PM ............................................................................................................................................. 16 SESSION 5 1:00 – 1:50 AM ...................................................................................................................................................... -

JOTA-JOTI 2017 .Pdf
60th Jamboree-On-The-Air® - 21st Jamboree-On-The-Internet®, 20-22 October 2017 Dear Scouting colleagues, The 60th Jamboree-On-The-Air® (JOTA) and the 21st Jamboree-On-The-Internet® (JOTI) will be held the third weekend of October – 20 to 22 October 2017. Please share this information with all the Scout groups in your country so they may participate in this exciting event. The Largest Scouting Event In The World Each year it remains the largest Scouting event in the world, with over a million Scouts participating across 150+ countries. JOTA-JOTI® is the only event offering every Scout the experience that he or she really belongs to a worldwide Movement. What Is Jamboree-On-The-Air And Jamboree-On-The-Internet? JOTA-JOTI is the annual event in which Scouts and Guides all over the world engage in conversations with each other by means of amateur radio and the Internet. Short-wave radio signals carry their voices to nearly every corner of the world while text chat, social media, and live video enhance their experience via the Internet. 2017 Theme — 60 Years Connecting Scouts The theme “60 Years Connecting Scouts” recognizes the start of the event in 1957 and commemorates its growth in participation and in the expanding communication channels that are activated during the event. Those channels include amateur radio via radio frequencies and Internet-based channels as well as many other Internet-based options including social media, ScoutLink and IRC chat services, Skype, and more. It also recognizes the goal of the event – connecting Scouts so that they can engage in conversations with other Scouts across town and around the world. -

Jamboree on the Internet
Jamboree on the Internet RIDEAU TRAIL Safety Note: Plan: Citizenship When communicating with strangers • When is JOTI held? How can you find out? online, what information is okay to • Where will your Troop meet for the event? What equipment do you need? share, and what should you keep The Adventure: • What do you know about online etiquette? private? Relatively few Scouts are lucky enough to attend a World Jamboree. These jamborees only take place How can you find out more? every four years, and they are often held very far from Canada. Traveling to a World Jamboree can • What would you like the world to know about be expensive and challenging for some. Even if you can attend a World Jamboree, it’s fun to stay your Scout Troop? connected with Scouts around the world between jamborees. • What would you like to learn about Scouting Online Resources: in other parts of the world? • Talk to the World However, none of these disadvantages hamper Jamborees on the Internet (JOTI). A Jamboree on the Internet costs almost nothing, doesn’t limit the number who can take part and can be enjoyed by Do: • Jamboree on the Air—Jamboree almost any Scouting member without leaving the neighbourhood. • Get online and take part in Jamboree on the on the Internet (WOSM) Internet! • Jamboree on the Internet Review: • What do you know now that you did not know before? • What did others want to know about Canada and your Scout Troop? • With what parts of the world did you make contact? N • How did you feel before, during and after this adventure? • What would you do differently next time? Canadianpath.ca Jamboree on the Internet RIDEAU TRAIL Safety Note: Plan: Citizenship When communicating with strangers • When is JOTI held? How can you find out? online, what information is okay to • Where will your Troop meet for the event? What equipment do you need? share, and what should you keep The Adventure: • What do you know about online etiquette? private? Relatively few Scouts are lucky enough to attend a World Jamboree. -
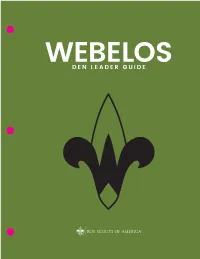
Webelos Leader Guide
The BSA’s Commitment to Safety We want you to know that the safety of our youth, volunteers, staff, and employees is an important part of the Scouting experience. Youth develop traits of citizenship, character, fitness, and leadership during age-appropriate events when challenged to move beyond their normal comfort level and discover their abilities. This is appropriate when risks are identified and mitigated. The Scouting program, as contained in our handbooks and literature, integrates many safety features. However, no policy or procedure will replace the review and vigilance of trusted adults and leaders at the point of program execution. Commit yourself to creating a safe and healthy environment by: Knowing and executing the BSA program as contained in our publications Planning tours, activities, and events with vigilance using the tools provided Setting the example for safe behavior and equipment use during program Chief Scout Executive Engaging and educating all participants in discussions about hazards and risks Michael Surbaugh Reporting incidents in a timely manner Thank you for being part of Scouting and creating an exciting and safe experience for every participant. BOY SCOUTS OF AMERICA SCOUTER CODE OF CONDUCT On my honor, I promise to do my best to comply with this Boy Scouts of America Scouter Code of Conduct while serving in my capacity as an adult leader: 1. I have completed or will complete my registration with the Boy Scouts of America, answering all questions truthfully and honestly. 2. I will do my best to live up to the Scout Oath and Scout Law, obey all laws, and hold others in Scouting accountable to those standards. -

Scouts NSW JOTA-JOTI Handbook
JOTA & JOTI Information Booklet JOTA/JOTI INFORMATION: The following information is provided to assist you with setting up and running a JOTA/JOTI event. Not all of the information required is contained within this booklet and a number of links to recognized Scout websites have been provided to further assist you with program ideas and event registration. International: http://jotajoti.info is the Official World Organization of the Scout Movement’s webpage for all things about Jamboree on the Air (JOTA) and Jamboree on the Internet (JOTI). This website is where you can register your group, activity for JOTA/JOTI. Australia: Additional information is available on the Australian International JOTA/JOTI site at http://www.international.scouts.com.au/programs-in-australia/jotajoti NSW: Further information is available on the NSW International JOTA/JOTI page at http://scoutsnsw.com.au or on Facebook NSW jota Joti. https://www.facebook.com/Jotajotinsw?fref=ts or the nsw jota/joti web site at http://nswjotajoti.org JOTA-JOTI Australia mailing list: Subscribe to JOTA-JOTI Australia mailing list and we'll keep you up to date by email with the latest news and announcements about JOTA-JOTI, internet, radio, National and International Scouting, plus lots of other exciting opportunities throughout the year to contact Scouts all over Australia and the world. To subscribe send a blank email to [email protected] Australia Radio and Internet Scouting Forum: This is the forum to exchange news, views and to share related information with likeminded people from Australia and other nations. Major topics include the World Scout Jamboree on The Air and Jamboree on The Internet (JOTA/JOTI), a monthly World Scout Net on Echolink, Scoutlink all year round, plus your own activities. -

Goose Creek District Newsletter
Goose Creek District Newsletter September 2016 Volume 8, Issue 2 from Bobwhite Blather, http://bobwhiteblater.com/learning-to-lead/ Learning to lead While some people seem to be natural leaders, it’s generally held that leadership is something that can be learned. The esteemed football coach Vince Lombardi believed that Special Interest: District Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price Webelos-o-ree – pg 2 which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. Join Scouting Night – pg 2 Our Scouts, most likely, are not great leaders. In fact, they probably don’t know the SFF – pg 3 first thing about leadership when they take on their first leadership position of Rechartering – pg 4 responsibility – most often as a patrol leader. It is through Scouting that they begin the process of learning about leadership. During their time as a Scout, they most likely Advancement won’t become accomplished leaders – even those who serve in multiple positions of Boy Scout pre 2016 responsibility or as senior patrol leader – but they will develop many leadership traits requirement ending – pg 8 through their Scouting experience that will give them an advantage outside Scouting and later in college and adult life. Council/National What are some of the ways we can see if good leadership traits are taking hold? JOTA/JOTI – pg 10 We can begin by examining some of the qualities that a great leader possesses. Eagle Scholarships – pg 11 Leadership consultant Lolly Daskal provides us with a test of leadership skills. -
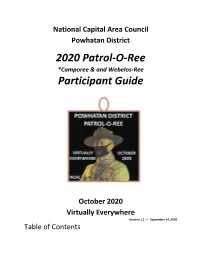
2020 Powhatan Camporee Participant Guide V1.1
National Capital Area Council Powhatan District 2020 Patrol-O-Ree *Camporee & and Webelos-Ree Participant Guide October 2020 Virtually Everywhere Version 1.1 –– September 24, 2020 Table of Contents Powhatan District Patrol-O-Ree Participant Guide October 2020 Version 1.1 Change Log – All details are subject to change ............................................................................................ 2 Welcome! ..................................................................................................................................................... 3 Location ........................................................................................................................................................ 3 Joint Activities .............................................................................................................................................. 4 Camping ........................................................................................................................................................ 4 First Aid and Emergencies ............................................................................................................................ 4 Patrol-O-Ree Events and Schedule (Scouts BSA/Venturing Participants) .................................................... 4 Webelos-Ree Events and Schedule ............................................................................................................ 10 Webelos-Ree Location, Joint Activities, Camping and First Aid and Emergencies -

JOTA & JOTI 2014 Information Booklet
SCOUTS AUSTRALIA, QUEENSLAND BRANCH INC. JOTA & JOTI 2014 Information Booklet 2014 JOTA/JOTI Event Badge 57th Jamboree on the Air & 18th Jamboree on the Internet 18 – 19 October 2014 Everyone can take part, an international Event! A message from Branch Advisor – JOTA/JOTI & Electronics: “Jamboree on the Air and Jamboree on the Internet on the third weekend of October is the largest Scouting event in the world, with nearly 1 million Scouts from 160+ countries engaged in conversations across town and around the world. Scouts communicate with one another via amateur radio and the Internet, providing a fun and educational Scouting experience and promoting their sense of belonging to a worldwide Scout Movement.” Some important hints for a successful activity: • Do your research. Start at www.scoutsqld.com.au – “Events” and select JOTA/JOTI. Check often for new information. • Decide on your venue. Plenty of good high trees to support antennas are desirable, but lack of trees can be overcome with a bit of ingenuity. • Publicise your activity. Make sure that every youth member and leader knows about it. • Engage an Amateur Radio Operator. If you cannot find one, contact the Queensland Advisor – JOTA/JOTA at [email protected] and I will assist with locating an amateur operator or radio club in your area that may be willing to assist you. I need to know WHERE (suburb/town/state) you will be running your activity. This needs to be done NOW, not a few days before the event. • Make sure you have a good internet connection. • Build a program around the activity. -

On the Horizon – May 2021 ======
1 On The Horizon – May 2021 ============================================================================================================================================================================================ Sign up to have On The Horizon emailed to you at http://eepurl.com/Z-9Vr https://www.facebook.com/newhorizonsdistrictgslac DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC, PLEASE VISIT https://stlbsa.org/, https://stlbsa.org/newhorizons/, AND http://www.shawneelodge.org/ FREQUENTLY FOR IMPORTANT UP-TO-DATE INFORMATION, AS EVENTS MAY CHANGE!! SOME EVENTS MAY BE LIVE STREAMED, OTHERS MAY BE CANCELED OR POSTPONED. EVERYONE, PLEASE STAY SAFE! KEEP YOUR UNITS GOING STRONG BY HOLDING LIVE STREAM EVENTS AND KEEP IN CONTACT WITH YOUR YOUTH AND PARENTS! Latest COVID Operational Guidance may be found here: https://stlbsa.org/covid-operational-guidance/ Contents Important Dates at a Glance: ....................................................................................................................... 2 ================> SPECIAL ANNOUNCEMENTS <================ ......................................................... 3 ================> COMMISSIONER’S CORNER <================ .......................................................... 4 ================> ACTIVITIES <================ .................................................................................. 4 ================> ADVANCEMENT <================ ........................................................................... 4 ================> STEM (Science, Technology, Engineering -

Chairman's Challenge: Attaining Vision 2023
ISSUE NO.7 21 OCTOBER 2018 MESSAGE My fellow Scouts from the Asia-Pacific Region, there are only two words I can offer you with: thank you! After the long wait, we came to conclude this much awaited event. The cooperation of each National Scout Organization in the Region proved that Scouting is really in the heart of most of the people. Indeed, this event summed up our collective endeavour to engage the youth in worthwhile undertaking that would help them grow up to become better citizens of the world. Ambassador Ahmad Rusdi Photo: Lorwin B. Sayco Let me assure you that, we, in the Asia-Pacific Support Centre, are always here to extend our help to whoever needs them. While we are separated Chairman’s challenge: by the oceans, there are many ways by which we could reach out to each other. Attaining Vision 2023 Come and we will abide. by Aaron Bryan A. Lopez J. RIZAL C. PANGILINAN Regional Director ith the world tackling several these problems are always present and, “if Asia-Pacific Region problems of its own and with the we ever commit mistakes, we shall never World Organization of the Scout Movement Wimplementation of the Sustaina- forget the lesson we learned from those ble Development Goals (SDGs) in 2015 at mistakes.” stake, the last triennium has been one of the To attain unity, Rusdi said Scouts can be MESSAGE most challenging periods in Scouting in the movie actors where each one plays respec- Asia-Pacific Region. Being part of the global tive important role. “We have different My heart is filled with community, Scouts took part in addressing talents and skills to contribute to make this gladness when you these problems as they continued ensuring world a better place. -

JOTA/JOTI 2010: “The Right to Be Heard”
JOTA/JOTI 2010: “The right to be heard” On October 16 and 17, up to half a million Scouts and Girl Guides from around the world will join together by radio and the internet in what has become known as JOTA – the Jamboree on the Air – and now JOTI, the Jamboree on the Internet. n Scouting parlance, the word “Jamboree”, first coined encourages members to educate them in radio techniques by Lord Baden Powell, means a large gathering of Scouts, so that they may operate their own station. Iengaged in a range of activities which can be as diverse The IARU Region 1 Conference 2008 in Cavtat, Croatia as pottery to caving to abseiling to . amateur radio! passed the following resolution CT08_C3_Rec 24: (Paper JOTA/JOTI brings together, electronically, up to half a CT08_C3_39): In recognizing the importance of the JOTA million Scouts (and of course Girl Guides) from theoreti- (Jamboree-On-the-Air) for radio amateur recruiting, it is cally just about every country on the planet. recommended that Member Societies encourage radio The 2010 event is of special significance – it’s the 100th amateurs to assist boy Scouts and girl Guides to participate anniversary of the Guiding movement (the Scouts had their in the annual JOTA the third full weekend of October each centenary back in 2007) and at the same time, the 20th year, organized by the World Organization of the Scout anniversary of the International Convention of the Rights Movement (WOSM) and to use this opportunity to present of the Child. In fact, this year’s theme, “The Right to Be amateur radio recruiting possibilities to the Scouts/Guides. -

Commissioner Resource Trove
1/12/2016 Commissioner Resource Trove Submitted in partial fulfillment for the Degree of Doctor of Commissioner Science James T. Stewart Assistant Council Commissioner National Capital Area Council Boy Scouts of America November 2015 National Capital Area Council College of Commissioner Science 1 1/12/2016 Table of Contents Acknowledgements. 4 Abstract . 5 Manuals, Forms & Publications . 6 Commissioner Manuals . 7 Roundtable Commissioner. 8 Commissioner Resources. 9 Forms for Commissioners. 11 Training Award Forms. 13 DVDs with Commissioner Interest. 14 Miscellaneous Resources for Commissioners or District Committee 16 District Committee Support Items . 17 Forms . 18 Cub Scout Forms . 21 Program Aides . 24 Boy’s Life Promo . 25 ScoutingWire Website . 27 Scouting.Org Website . 31 www.scouting.org Blue tabs . 33 o Youth . 33 o Parent . 33 o Volunteer . 34 o Alumni. 34 o Visitor . 34 o Donate . 34 www.scouting.org White tabs . 35 o ScoutSource . 35 o Media . 35 o Donate . 35 o Get Involved . 36 o Shop . 36 o Sponsors . 36 o Youth Protection . 36 o My.scouting . 36 ScoutSource Blue tabs . 37 o Marketing . 37 o Program Updates . 37 o Cub Scouts . 37 2 1/12/2016 o Boy Scouts . 37 o Venturing . 37 o Commissioners . 37 o Scouting Safely . 37 o Outdoor . 37 o Membership . 38 Miscellaneous o Awards . 39 o Training (and training awards) . 39 o Forms . 39 o About the BSA . 39 o Publications . 40 U.S. Scouting Service Project Website . 41 Website Encyclopedia . 53 • General . 55 • Cooking . 65 • Official BSA . 55 • Camping Gear . 66 • Unofficial with Lots of • Outdoor Information . 66 Resources . 56 • Games, Skits, & Songs 66 • Recruiting / Membership / • Knots .