Obere Und Mittlere Fuldaaue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
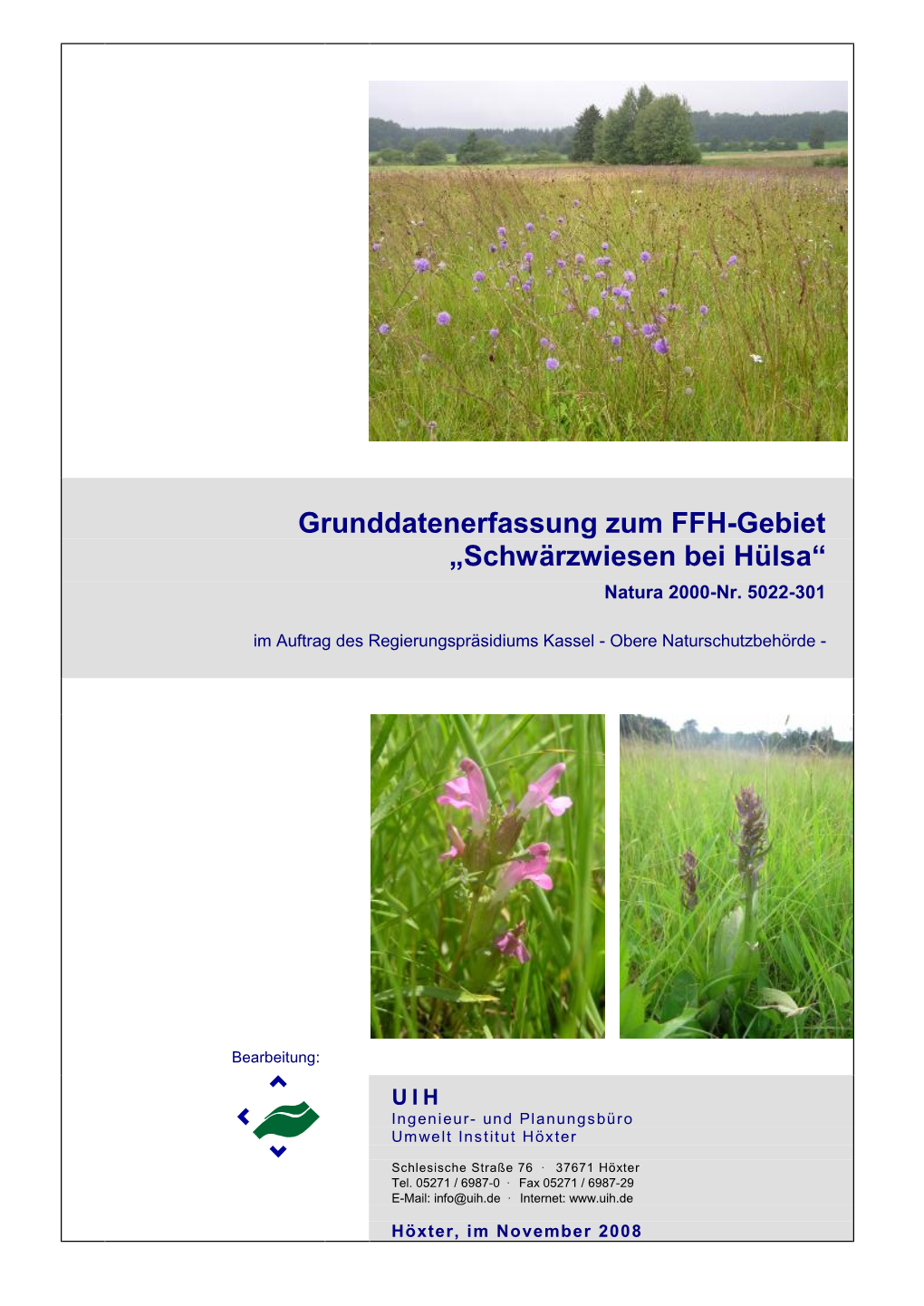
Load more
Recommended publications
-

Knüllwald Schwarzenborn
Gewässerzustand Gewässerentwicklung Darstellung der Verteilung der Abweichungsklassen Bereits umgesetzte Maßnahmen von den morphologischen Umweltzielen (MUZ) Efze zwischen Holzhausen je Wasserkörper bezogen auf 100 m - Abschnitte und Völkershain Strukturelle Maßnahmen Maßnahmenumsetzung bereits erfolgt ' 0; keine Daten vorhanden ' 1; schlechter Zustand (Markierung zur besseren Auffindbarkeit) ' Rin_1 Standortübungsplatz Homberg/Efze 2; unbefriedigender Zustand ' ' ' 3; mäßiger Zustand Rin_2 Maßnahmen in der Planung / Umsetzung 4; guter Zustand Strukturelle Maßnahmen 5; sehr guter Zustand ' ' ' ' Maßnahmenumsetzung geplant / in Umsetzung Rin_3' ' Ziel der EG-WRRL ist der "gute ökologische Zustand". Rin_4 Der gute ökologische Zustand ist dann erreicht, wenn in Rin_5 ca. einem Drittel eines Wasserkörpers hochwertige Struk- (Markierung zur besseren Auffindbarkeit) ' Efze zwischen Holzhausen '' turen vorhanden sind und diese möglichst gleichmäßig inner- '' und Völkershain halb des Gewässerverlaufs verteilt sind, so dass sie als Tritt- ' ' steinhabitate der Gewässerfauna zur Verfügung stehen. Weitere erforderliche Maßnahmen Im Rahmen des Projekts wurde das Maßnahmen- programm Hessen 2009 - 2015 konkretisiert. Die verorteten Maßnahmen sind in den Maßnahmen- ' karten dargestellt. Erkennbarer Entwicklungstrend Hier sind lediglich die Maßnahmenbereiche R i n n e b a c h dargestellt, die im Rahmen durchgeführter Darstellung des Entwicklungstrends für die im Rahmen Gewässerschauen abgestimmt wurden und für Roßbachtal bei Völkershain -

Originaldokument Als PDF-Datei
20. Wahlperiode Drucksache 20/3536 HESSISCHER LANDTAG 26. 11. 2020 Kleine Anfrage Günter Rudolph (SPD) vom 01.09.2020 Zustand von Straßen und Brücken im Schwalm-Eder-Kreis – Teil I und Antwort Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Vorbemerkung Fragesteller: Eine gute infrastrukturelle Versorgung eines ländlich geprägten Schwalm-Eder-Kreis ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Zukunftschancen einer gesamten Region. Hierbei ist es wichtig, die Zustandsbe- schreibung der einzelnen Straßen und Brückenbauwerke genau zu kennen und hieraus Erfordernisse für Sanie- rung und ggf. Neubau ableiten zu können. Dabei ist die abstrakte Summe der Investitionen nur ein Indikator. Wichtiger Indikator der Beurteilung nach einer guten Infrastruktur ist der ins Verhältnis gesetzte Anteil an guten, sanierungsbedürftigen und dringend sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken und dessen Verände- rung. Vorbemerkung Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: Bei Regierungsantritt der Landesregierung in der 19. Legislaturperiode im Jahre 2014 befand sich über ein Fünftel des Landesstraßennetzes in einem sehr schlechten Zustand. Der Sanierungsstau hatte sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut. Als Reaktion startete die Landesregierung die Sa- nierungsoffensive 2016 bis 2022, die schrittweise in Einzelmaßnahmen investiert und den Grund- satz „Sanierung vor Neubau“ verfolgt. Hierfür wurde anhand einer Prioritätensetzung nach fach- lichen, objektiven und transparenten Kriterien, wie Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Ver- kehrsqualität, Umfeldsituation und Straßenzustand ein Straßenbauprogramm für sieben Jahre auf- gestellt. Mit diesem Programm werden mittlerweile rund 600 Mio. € für gut 700 Einzelmaßnahmen auf- gewendet. Dadurch konnte der Anteil von Sanierungs- und Erhaltungsausgaben an den Investiti- onsmitteln von ca. 72 % im Jahr 2014 auf ca. 90 % im Jahr 2019 gesteigert werden. Insgesamt konnten die Investitionen in die Landesstraßen erheblich gesteigert werden. -

Klimaschutzkonzept Der Stadt Homberg (Efze)
Klimaschutzkonzept der Stadt Homberg (Efze) 2 Klimaschutzkonzept der Stadt Homberg (Efze) KLIMASCHUTZKONZEPT HOMBERG (EFZE) Stand: 08. Dezember 2015 Auftraggeber Stadt Homberg (Efze) Rathausgasse 1 34576 Homberg (Efze) Auftragnehmer KEEA Klima und Energieeffizienz Agentur UG haftungsbeschränkt Esmarchstraße 60 34121 Kassel Tel.: 0561 2577 0 E-Mail: [email protected] www.keea.de Bearbeiter Andreas Fröhlich Armin Raatz Matthias Wangelin Eine Vorbemerkung zum Sprachgebrauch Mit Rücksicht auf die gute Lesbarkeit des Textes wird auf die gleichberechtigte Nennung der männli- chen und weiblichen Form verzichtet. In der Regel wird das männliche Genus verwendet, gemeint sind beide Geschlechter. Nachdrucke, auch auszugsweise, und Weitergabe an Dritte sind ausschließlich mit Genehmigung durch den Verfasser zulässig. Die Inhalte der vorliegenden Ausarbeitung erheben keinen Anspruch auf Ak- tualität, sachliche Korrektheit oder Vollständigkeit. Insofern nicht anders angegeben gilt für alle im vorliegenden Dokument verwendeten Abbildungen als Quelle: Klima und Energieeffizienz Agentur 2009–2015. 3 Klimaschutzkonzept der Stadt Homberg (Efze) INHALTSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ..................................................................................................................... 7 ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................................. 8 EINLEITUNG ......................................................................................................................................... -

Drucksache 18/5841
'HXWVFKHU%XQGHVWDJ 'UXFNVDFKH :DKOSHULRGH $QWZRUW GHU%XQGHVUHJLHUXQJ DXIGLH.OHLQH$QIUDJHGHU$EJHRUGQHWHQ1LFROH0DLVFK2OLYHU.ULVFKHU0DWWKLDV *DVWHOZHLWHUHU$EJHRUGQHWHUXQGGHU)UDNWLRQ%h1'1,6',(*5h1(1 ±'UXFNVDFKH± =XVWDQGGHU6WUDHQEUFNHQLQ+HVVHQ 9RUEHPHUNXQJGHU)UDJHVWHOOHU $Q %XQGHVIHUQVWUDHQ JLEW HV GHXWVFKODQGZHLW %UFNHQ XQG 7HLOEDXZHUNH'HU=XVWDQGGHU%UFNHQYHUVFKOHFKWHUWVLFK]XQHKPHQG%H VRQGHUVEHNDQQWVLQGGLH)lOOHGHU5KHLQEUFNHDQGHU%XQGHVDXWREDKQEHL /HYHUNXVHQXQGGHU5DGHU+RFKEUFNHDQGHU%XQGHVDXWREDKQGLHDXIJUXQG LKUHUPDURGHQ6XEVWDQ]IUGHQ/NZ9HUNHKUJHVSHUUWZHUGHQPXVVWHQ$QGHU 6FKLHUVWHLQHU%UFNHGHU$NDPHVLP)HEUXDUDXIJUXQGHUKHEOLFKHU 6FKlGHQVRJDU]XHLQHU]ZHLPRQDWLJHQ9ROOVSHUUXQJIUGHQJHVDPWHQ9HUNHKU 1HEHQGLHVHQSURPLQHQWHQ)lOOHQLVWGHU*HVDPW]XVWDQGGHU%UFNHQEHGHQN OLFK,QGHQOHW]WHQ-DKUHQKDWGHU%HVWDQGDQ%UFNHQLQVHKUJXWHPE]ZJX WHP=XVWDQGDEJHQRPPHQZlKUHQGGLH%UFNHQLQJHUDGHQRFKDXVUHLFKHQ GHP=XVWDQGVLFKIDVWYHUGRSSHOWKDEHQ %HULFKWGHVGDPDOLJHQ%XQGHVPLQLV WHULXPVIU9HUNHKU%DXXQG6WDGWHQWZLFNOXQJYRP0DLÄ6WUDWHJLH ]XU(UWFKWLJXQJGHU6WUDHQEUFNHQLP%HVWDQGGHU%XQGHVIHUQVWUDHQ³ $XIJUXQGGHU$OWHUVVWUXNWXU±HLQJURHU7HLOGHU%UFNHQLVWEHU-DKUHDOW± VWHLJWGHU%HGDUIDQ(UKDOWXQG0RGHUQLVLHUXQJGHU%DXZHUNHVWHWLJ0LWHLQHP 6RQGHUSURJUDPPYRQEHU0UG(XURLQGHQ-DKUHQELVZLOOGLH %XQGHVUHJLHUXQJJHJHQVWHXHUQ ZZZEPYLGH'(9HUNHKU8QG0RELOLWDHW 9HUNHKUVWUDHJHU6WUDVVH6LFKHUKHLW9RQ%UXHFNHQV\VWHPDWLVFKH EUXHFNHQHUWXHFKWLJXQJBQRGHKWPO (VLVWIUDJOLFKREGLH0LWWHODXVUHLFKHQ XPZHLWHUH6SHUUXQJHQ]XYHUPHLGHQ 9RUEHPHUNXQJGHU%XQGHVUHJLHUXQJ D =XU %HDQWZRUWXQJ GHU .OHLQHQ $QIUDJH VLQG QXU $QJDEHQ ]X %DXZHUNHQ P|JOLFKGLHVLFKLQGHU%DXODVWGHV%XQGHVEHILQGHQXQGIUGLH+HVVHQ0R -

Artgutachten Gelbbauchunke 2011 (Genetik)
HESSEN-FORST Artgutachten 2011 Genetische Analyse von Speichelproben und Analyse von Fußabstrichen auf Befall mit dem Amphibien- Chytridpilz Batrachochytrium dendrobatidis bei der Gelbbauchunke (Bombina variegata) in Nordhessen (Art des Anhangs II & IV der FFH-Richtlinie)“, Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Genetische Analyse von Speichelproben und Analyse von Fußabstrichen auf Befall mit dem Amphibien-Chytridpilz Batrachochytrium dendrobatidis bei der Gelbbauchunke (Bombina variegata) in Nordhessen (Art des Anhangs II & IV der FFH-Richtlinie)“, Kurz: „Gelbbauchunke Nordhessen 01“: Erfassung der Daten und Probennahme im Gelände 2011 Bearbeitung: Dipl.-Ing. Claus Neubeck Universität Kassel, Fachgebiet Gewässerökologie/Gewässerentwicklung Nordbahnhofstr. 1a, 37213 Witzenhausen Überarbeitete Fassung, Stand: 13. Februar 2013 Im Auftrag von - Fachbereich Naturschutz - Europastraße 10-12 35394 Gießen Gelbbauchunke Nordhessen 01– Bericht 1 Teilprojekt 3 des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Michael Otto Stiftung und anderen Institutionen geförderten Kooperationsprojektes „Gelbbauchunke Nordhessen“. Titelbild: Gelbbauchunke in „Kahnstellung“, Melsungen-Kirchhof 2011 (Bild: C. Neubeck) Gelbbauchunke Nordhessen 01– Bericht 2 INHALTSVERZEICHNIS 1. Hintergründe und Ziele................................................................................ 8 2. Methoden .................................................................................................... 8 3. -

Hochwasserrisikomanagementpl
Regierungspräsidium Kassel Abteilung III, Umwelt- und Arbeitsschutz Hochwasserrisikomanagementplan für das hessische Einzugsgebiet der Fulda Stand: 15. Dezember 2010 Bearbeitet durch: Universität Kassel, Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Oberirdische Gewässer und Hochwasserschutz BEARBEITER: Universität Kassel Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stephan Theobald Kurt-Wolters-Straße 3 34125 Kassel Internet: http://www.uni-kassel.de/cms/wawi Tel.: +49 (0)561 804-2749 Fax: +49 (0)561 504-3952 Regierungspräsidium Kassel Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz Dezernat 31.2 – Oberirdische Gewässer und Hochwasserschutz Steinweg 6 34117 Kassel Internet: http://www.rp-kassel.de Tel.: +49 (0)561 106-3607 Fax: +49 (0)561 106-1663 Hochwasserrisikomanagementplan Fulda Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 Hochwasserrisikomanagement (allgemein) 4 1.2 Räumlicher Geltungsbereich des HWRMP 7 1.3 Zuständige Behörden 11 2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETES 12 2.1 Geographie 12 2.2 Geologie 13 2.3 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 14 2.4 Oberflächengewässer 16 2.5 Siedlungsgebiete, bedeutende Verkehrswege, sonstige Flächennutzung 18 2.6 Schutzgebiete 20 2.7 Kulturerbe 23 3 VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS 25 3.1 Beschreibung der Entstehung von Hochwasser im Einzugsgebiet 26 3.2 Beschreibung vergangener Hochwasser mit signifikant nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter 28 3.3 Beschreibung des bestehenden Hochwasserschutzes 34 3.3.1 Hochwasser-Flächenmanagement -

Pflegeräume Und Freizuhaltende Räume Im Schwalm-Eder-Kreis 1
Pflegeräume und Freizuhaltende Räume im Schwalm-Eder-Kreis Beibehaltung bestehender Änderung Allgemeine Angaben zum Raum Pflegeraum erster Priorität: P I Nutzungen und Erhalt, Pflege und Entwicklung der der Pflegeraum zweiter Priorität: PII Bewirtschaf- Offenhaltung landschaftsgliedernden Elemente Nutzungs- Freizuhaltender Raum: F tungsformen und Pflege und Strukturen art Natur- Lfd. räuml. Nr. Gemeinde/Stadt Lage Einheit Besonderheiten/ Beeinträchtigungen Acker Grünland Laubwald Magerrasen Waldwiesentäler Moore Streuobst Gehölze in der Feldflur (Hecken, Feldgehölze, Bäume, etc.) Bachbegleitende Ufergehölze Waldinseln BereicheNaturnahe (verbuschte Abbauflächen, Hangkanten,etc.) Umwandlung von Acker in Grünland in den Auen, möglich soweit Planungskategorie Raumtyp (s. Kap. 7.5.2.1, Teil 1) Tal der Fulda im gesamten breite Niederung, mäßig strukturiert (meist nur 1 Guxhagen, Körle, Kreisgebiet, außer den Ufergehölzsaum), Acker-/Grünlandnutzung, P II, Melsungen, Malsfeld, Fuldaschleifen bei periodisch überschwemmt; NSG; Beeinträchtigungen: 401 F Morschen Büchenwerra Tw 343, 357 Brückenbauwerke, ICE-Trasse, Ortsumgehung X X X X enges Tal; durch bewaldete, steile Hänge begrenzt, Fuldaschleifen bei landschaftsprägend; in der Niederung mäßig 402 P I, F Guxhagen Büchenwerra Tw 343 strukturiert X X X X Tal der Trockenen schmales Bachtal, strukturreich, Ufergehölze, Hecken 403 P I, F Körle, Guxhagen Mülmisch Tk 357 in den Hängen, Oberlauf in Waldwiesental X X X X grünlandgeprägte Niederung, mäßig strukturiert (Ufergehölze), strukturreiche, überw. ackerbaul. genutzte Talhänge (Hecken, Feldgehölze); 404 P I, F Körle Tal der Mülmisch Tk, As 357 Beeinträchtigung: ICE-Trasse (Brückenbauwerk) X X X strukturreiches Bachtal (Ufergehölze, Hecken, 405 P I, F Melsungen Tal des Breitenbachs Tk 357 Oberlauf Waldwiesental) X X X X strukturreiche Bachauen (Grünland, Nassbrachen, Ufergehölze, Erlenbruchbestände); strukturreiche Täler des Ohebachs und des Talhänge (Mosaik unterschiedlicher landwirtschaft. -

Gewässerberatungsleistungen Und Erstellung Einer Umsetzungskonzeption Für WRRL- Strukturmaßnahmen Der Schwalm-Zuflüsse
Gewässerberatungsleistungen und Erstellung einer Umsetzungskonzeption für WRRL- Strukturmaßnahmen der Schwalm-Zuflüsse oben: Naturnaher Abschnitt der Gilsa nördlich von Moischeid (Foto: UIH) Auftraggeber Regierungspräsidium Kassel Abteilung III – Umwelt und Arbeitsschutz Dez. 31.3/KS – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz Bearbeiter Höxter, im April 2016 Gewässerberatungsleistungen und Erstellung einer Umsetzungskonzeption für WRRL- Strukturmaßnahmen der Schwalm-Zuflüsse Auftraggeber Regierungspräsidium Kassel Abteilung III – Umwelt und Arbeitsschutz Dez. 31.3/KS – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz Steinweg 6, 34117 Kassel Projektbetreuung: Dr. Martin Marburger; Stephanie Liebscher Bearbeiter Projektleitung: Dipl.-Ing. Wolfgang Figura (Tel. 05271-6987-13, [email protected]) Projektbearbeitung: Dipl.-Uwi. Astrid Peters (Tel. 05271-6987-27, [email protected]) unter Mitarbeit von: B. Sc. Gennadij Harms, Dipl.-Biol. Ulrike Möhring. sowie Gabriela Reh Höxter, im April 2016 Gewässerberatungsleistungen und Erstellung einer Umsetzungskonzeption für WRRL-Strukturmaßnahmen der Schwalm-Zuflüsse INHALTSVERZEICHNIS 1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG ................................................................4 1.1 Anlass und Aufgabenstellung .................................................................................4 1.2 Allgemeiner Projektablauf........................................................................................5 2 BEARBEITUNGSKULISSE ....................................................................................5 2.1 -

Fischotter in Nord
HESSEN-FORST Artgutachten 2014 Kartierung von Fischottervorkommen in Nord- und Osthessen Untersuchungen 2015 an Weser, Werra, Fulda, Eder, Schwalm, Ohm, Nidda, Kinzig, Lohr, Sinn und deren Zuflüssen Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) Kartierung von Fischottervorkommen in Nord- und Osthessen Untersuchungen 2015 an Weser, Werra, Fulda, Eder, Schwalm, Ohm, Nidda, Kinzig, Lohr, Sinn und deren Zuflüssen Im März 2015 wurden auf einer Fläche von 7.600 km2 615 Brücken auf die Anwesenheit des Fischotters untersucht, 22 davon wiesen Nachweise auf. Sie befanden sich an den Gewässersystemen von Eder, Schwalm, Ohm, Lohr und Sinn. Diese Funde können zwei getrennten Vorkommen zugeordnet werden, einem zwischen Vogelsberg und Eder, dem anderen im Spessart, letzteres erstreckt sich auch auf Unterfranken. Beide Vorkommen sind sehr klein und diverse Ausfälle, z. B. durch den Straßenverkehr können schnell zum Rückgang und Erlöschen des Vorkommens führen. Vergleichserhebungen aus den Jahren 2013 bzw. 2014 deuten darauf hin, dass das Vorkommen im Norden eher kleiner, jenes im Spessart hingegen in dieser Zeit größer geworden ist. Auftraggeber: Landesbetrieb HESSEN-FORST Forsteinrichtung und Naturschutz FENA Naturschutz Europastraße 10-12 35394 Gießen Deutschland Auftragnehmer: DI Dr. Andreas Kranz alka-kranz Ingenieurbüro für Wildökologie und Naturschutz e. U. Am Waldgrund 25, 8044 Graz, Österreich [email protected] Tel.: 0043 664 2522017 Zitiervorschlag: Kranz, A., & Poledník, L., 2015: Kartierung von Fischottervorkommen in Nord- und Osthessen. Untersuchungen 2015 an Werra, Weser, Ulster, Fulda, Eder, Ohm, Nidda, Kinzig, Lohr und Sinn und deren Zuflüssen. Bericht im Auftrag von HESSEN-FORST FENA. 51 Seiten. Titelbild: Kontrollpunkte der Kartierung vom März 2015 in Hessen (rot mit Nachweisen des Fischotters) Fotos im Bericht: alle A. -

Knüll“ (Schwalm-Eder-Kreis, Hessen)
SPA-Monitoring-Bericht für das EU-Vogelschutzgebiet 5022-401 „Knüll“ (Schwalm-Eder-Kreis, Hessen) Stand: Dezember 2016 1 LÖSEKRUG, R.-G., BAUMANN, B., DEMANT, B., HAPPEL, A., HOFFMANN, M., THORN, H.-O. & M. HORMANN (2016): SPA-Monitoring-Bericht für das EU-Vogelschutzgebiet 5022-401 „Knüll“ (Schwalm-Eder-Kreis, Hessen).- Gutachten der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Gießen, 97 S. Gutachten der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland Steinauer Str. 44 60386 Frankfurt/M (Fachbetreuung: Dipl.-Ing. agr. Martin Hormann) Bearbeitung Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Abteilung Naturschutz Diplom-Forstwirt Ralph-Günther Lösekrug Dipl.-Forsting. Bernd Baumann Dipl.-Forsting. Botho Demant Dipl.-Forsting. Albin Happel Dipl.-Forsting. Michael Hoffmann Dipl.-Forsting. Hans-Otto Thorn Europastr. 10 35394 Gießen Bearbeitungsstand: Dezember 2016 Endfassung: Titelbild: Blick von Weißenborn zum Rimberg (Foto: H.-O. Thorn) 2 Inhaltsverzeichnis Kurzinformation zum Gebiet (verändert nach GDE) ............................................................ 5 1 Aufgabenstellung ............................................................................................................ 8 2 Einführung in das Untersuchungsgebiet (aus GDE 2014) ............................................ 9 2.1 Geografische Lage, Klima, Entstehung des Gebietes ................................................. 9 2.2 Aussagen der FFH-Gebietsmeldung und Bedeutung des Untersuchungsgebietes ....