Die Schussen Bilanz Der Belastung Eines Bodenseezuflusses
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bericht Überwachungsergebnisse Fische 2006 Bis 2014
Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie Überwachungsergebnisse Fische 2006 bis 2014 Biologisches Monitoring der Fließgewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie BEARBEITUNG LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Postfach 100163, 76231 Karlsruhe Referat 41 – Gewässerschutz Uwe Bergdolt STAND Dezember 2015 Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Zustimmung der LUBW unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. ZUSAMMENFASSUNG 5 1 EINLEITUNG 7 2 AUSGANGSLAGE 8 2.1 Das fischbasierte Bewertungsverfahren fiBS 8 2.1.1 Fischökologische Referenzen 8 2.1.2 Fischereiliche Bestandsaufnahme 9 2.1.3 Bewertungsalgorithmus 10 2.1.4 Bewertungsergebnisse im Bereich von Klassengrenzen 12 2.2 Vorarbeiten bis 2010 13 2.2.1 Allgemeine Hinweise 13 2.2.2 Entwicklung des Messnetzes und des Fischmonitorings 14 3 FISCHBASIERTE FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG 16 3.1 Monitoringstellen-Bewertung 16 3.1.1 Zeitraum der fischBestandsaufnahmen 16 3.1.2 Plausibilisierung der Rohdaten 16 3.1.3 Monitoringstellen in erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern 19 3.1.4 Ergebnisse 19 3.2 Wasserkörper-Bewertung 21 3.2.1 Aggregationsregeln 21 3.2.2 Ergebnisse 24 4 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BEWERTUNGSERGEBNISSEN 27 4.1 Umgang mit hochvariablen Ergebnissen 27 5 KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN 28 5.1 Feinverfahren zur Gewässerstrukturkartierung 28 5.2 Monitoringnetz 28 5.3 Zeitraster der Fischbestandsaufnahmen 30 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 31 ANHÄNGE 34 Zusammenfassung Im vorliegenden Bericht werden die von der Fischereiforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg im Auftrag der LUBW bis zum Sommer 2014 in Baden-Württemberg durchgeführten Arbeiten zur ökologischen Fließ- gewässerbewertung auf Grundlage der Biokomponente Fischfauna gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erläutert und dokumentiert. -

The German Teacher's Companion. Development and Structure of the German Language
DOCUMENT RESUME ED 285 407 FL 016 887 AUTHOR Hosford, Helga TITLE The German Teacher's Companion. Development and Structure of the German Language. Workbook and Key. PUB DATE 82 NOTE 640p. PUB TYPE Guides - Classroom Use - Guides (For Teachers) (052) -- Reference Materials General (130) EDRS PRICE MF03/PC26 Plus Postage. DESCRIPTORS Comparative Analysis; Contrastive Linguistics; Diachronic Linguistics; English; *German; *Grammar; Language Teachers; Morphology (Languages); *Phonology; Reference Materials; Second Language Instruction; *Syntax; Teacher Elucation; Teaching Guides; Textbooks; Workbooks ABSTRACT This complete pedagogical reference grammar for German was designed as a textbook for advanced language teacher preparation, as a reference handbook on the structure of the German language, and for reference in German study. It systematically analyzes a d describes the language's phonology, morphology, and syntax, and gives a brief survey of its origins and development. German and English structures are also compared and contrasted to allow understanding of areas of similarity or difficulty. The analysis focuses on insights useful to the teacher rather than stressing linguistic theory. The materials include a main text/reference and a separate volume containing a workbook and key. The workbook contains exercises directly related to the text. (MSE) *********************************************************************** * Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made * * from the original document. * *********************************************************************** THE GERMAN TEACHER'S COMPANION Development and Structure of the German Language Helga Hosford University of Montana NEWBURY HOUSE PUBLISHERS, INC. ROWLEY, MASSACHUSETTS 01969 ROWLEY LONDON TOKYO 1 9 8 2 3 Library of Congress Cataloging in Publication Data Hosford, Helga, 1937 - The German teacher's companion Bibliography p Includes index. -

Bewirtschaftungsplan Hochrhein, Aktualisierung 2015
Bewirtschaftungsplan Hochrhein Aktualisierung 2015 (Baden-Württemberg) gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) – Stand: Dezember 2015 – BEARBEITUNG: Regierungspräsidium Freiburg – Referat 51 Bissierstraße 7 79083 Freiburg REDAKTION: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Chapeau-Kapitel der Flussgebietsgemeinschaft Rhein Koordinierung und Abstimmung der Vorgehensweisen zur Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach Wasserrahmenrichtlinie Stand: 12. November 2015 Impressum: Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- Württemberg Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher- schutz Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima- schutz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Saarland Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor- sicherheit Redaktion: FGG Rhein - Geschäftsstelle - Am Rhein 1 67547 Worms Tel.: 06131/6033-1560 Fax: 06131/6033-1570 [email protected] www.fgg-rhein.de -

Essays on the Sustainable Transition of the German Energy Sector
Citizen participation, project management, and behaviorally informed policy – essays on the sustainable transition of the German energy sector vorgelegt von Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt Özgür Yildiz geboren in Berlin von der Fakultät VII – Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Wirtschaftswissenschaften – Dr. rer. oec. – genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzender: Prof. Dr. Christian von Hirschhausen (TU Berlin) Gutachter: Prof. Dr. Georg Meran (TU Berlin) Gutachter: Prof. Dr. Jens Lowitzsch (Europa-Universität Viadrina) Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 21.07.2016 Berlin 2016 Danksagung Diese Dissertationsschrift wäre ohne die Mithilfe vieler Personen nicht möglich gewe- sen, daher möchte ich die Gelegenheiten nutzen, mich an dieser Stelle bei diesen Unterstützern zu bedanken. Ein erster großer Dank gebührt Prof. Dr. Georg Meran, der mir nicht nur die Möglich- keit eröffnete, dieses Dissertationsvorhaben überhaupt zu realisieren, sondern mir ebenfalls umfangreiche inhaltliche Freiheiten einräumte, mit seinem Rat bei inhaltli- chen Fragen stets beiseite stand und mit seiner Offenheit gegenüber neuen Themen und Forschungsansätzen mich dazu inspirierte, das Themenfeld der Verhaltensöko- nomik aufzugreifen und in dieser Arbeit zu vertiefen. Beispielhaft ist seine persönli- che und inhaltliche Unterstützung bei der Akquise des von der Volkswagen Stiftung geförderten Forschungsprojektes zu nennen, das die Grundlage für zwei Arbeiten dieser Dissertationsschrift bildete. Ich hoffe, dass meine Arbeit am Fachgebiet nur der Auftakt für weitere gemeinsame Forschungsarbeiten und Projekte war. Ein großes Dankeschön möchte ich ebenfalls dem gesamten Team des Fachgebiets für Umweltökonomie der TU Berlin aussprechen. Prof. Meran und Eva Aust haben mit ihrer Fürsorge für alle Mitarbeiter eine familiäre Atmosphäre geschaffen, so dass man sich sofort wohl fühlte und trotz der anspruchsvollen inhaltlichen Aufgaben bei persönlichen Anliegen immer jemanden zum Zuhören hatte. -

Long-Term Changes in the Water Level of Lake Constance and Possible Causes
Hydrology of Natural and Manmade Lakes (Proceedings of the Vienna Symposium, August 1991). IAHS Publ. no. 206, 1991. Long-term changes in the water level of Lake Constance and possible causes G. LUFT Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wiirttemberg, Abt. 4: Wasser, Benzstrafie 5, D-7500 Karlsruhe 21 (F.R.G.) G. VAN DEN EERTWEGH Agricultural University Wageningen, Department of Hydrology, Soil Physics, and Hydraulics, NL-6709 PA Wageningen, formerly Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wiirttemberg ABSTRACT Lake Constance is a natural reservoir system consisting of two parts, Obersee and Untersee. River Rhine flows through the lake. At the lakeside and in shallow shore zones, erosion and vegeta tion damages have been observed. Long-term changes in the water-level can be one of the causes of erosion processes and were investigated in this study. Also possible causes of these changes were taken into consideration. The results of frequency and trend analysis and Gaussian low pass filtering show that the water level of Lake Constance and its regime has changed. Mean annual water levels (Untersee), discharges (Alpenrhein and Hochrhein), and areal precipitation depths have remained nearly constant. Peak water levels and discharges have dropped, low water levels and discharges have increased. On the contrary, the mean annual water level of Obersee has dropped, low water levels have remained constant. The changes in water level have probably been caused by changes of hydraulic conditions in the outflow-regions of the lake. This process has been superposed by development and operation of storage reservoirs (hydropower purposes) in the catchment area of the Alpenrhein. Its seasonal runoff regime has been strongly influenced by an increase of low discharge, predominantly in the winter and a decrease of peak discharge in the summer. -

BUND-WRRL-Gewässerschutz-Engagement Vor Ort
BUND-WRRL-Gewässerschutz-Engagement vor Ort Was können die Orts- und Kreisgruppen des BUND unternehmen, um die Zielerreichung nach der EG-WRRL konkret vor Ort zu fördern? Zunächst lohnt sich ein Blick auf die Arbeitspläne und die Steckbriefe zu den einzelnen Wasserkörpern. In den Arbeitsplänen werden zumindest für die südbadischen Wasserkörper alle Maßnahmen visualisiert, die für den jeweiligen Fließgewässerabschnitt vorgesehen sind – oder auch schon als erledigt abgehakt werden konnten. 1 Die BUND-Gruppierungen können auf der Basis der Arbeitspläne entscheiden, für welche Maßnahmen sie sich besonders stark machen wollen. Dabei ist auch ein höchst praktisches Engagement möglich – beispielsweise bei Arbeitseinsätzen zur naturnahen Gestaltung von Bächen und Flussufern. Alle Einsätze sind mit den Gewässerunterhaltungspflichtigen – bei Gewässern 2. Ordnung 2 die Gemeinden – abzustimmen. Bei Einsätzen, die über Pflegemaßnahmen hinausgehen, ist mit der Unteren Wasserbehörde abzuklären, ob eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Die Arbeitseinsätze können vom Land auch finanziell gefördert werden. Denn mit der Richtlinie des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (Landschaftspflegerichtlinie ) unterstützt das Land Baden-Württemberg Maßnahmen und Projekte des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landeskultur, um die Ziele des Naturschutzgesetzes zu verwirklichen und internationale ökologische Regelungen und Vorgaben durchzuführen. 1 Leider sind die Arbeitspläne im Internet maximal gut versteckt – obwohl sie ganz vorn auf der baden- württembergischen WRRL-Homepage platziert werden müssten. Erreichbar sind die Arbeitspläne über folgenden Link: https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/WRRL/Seiten/TBG-Karte.aspx Öffnet man diesen Link, erscheint eine Baden-Württemberg-Karte mit den Teilbearbeitungsgebiete. BUND-Gruppierungen können dann ihr jeweiliges Teilbearbeitungsgebiet anklicken. -
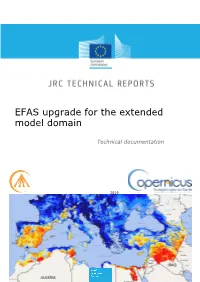
EFAS Upgrade for the Extended Model Domain
EFAS upgrade for the extended model domain Technical documentation 2019 This publication is a Technical report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this publication. JRC Science Hub https://ec.europa.eu/jrc JRC Ispra: European Commission, 2019 © European Union, 2019 Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). For any use or reproduction of photos or other material that is not under the EU copyright, permission must be sought directly from the copyright holders. How to cite this report: L. Arnal, S.-S. Asp, C. Baugh, A. de Roo, J. Disperati, F. Dottori, R. Garcia, M. Garcia- Padilla, E. Gelati, G. Gomes, M. Kalas, B. Krzeminski, M. Latini, V. Lorini, C. Mazzetti, M. Mikulickova, D. Muraro, C. Prudhomme, A. Rauthe-Schöch, K. Rehfeldt, P. Salamon, C. Schweim, J.O. Skoien, P. Smith, E. Sprokkereef, V. Thiemig, F. Wetterhall, M. Ziese, EFAS upgrade for the extended model domain – technical documentation, EUR 29323 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92- 79-92881-9, doi: 10.2760/806324, JRC111610. All images © European Union 2019 Contents Acknowledgements ................................................................................................ 2 1 Introduction ..................................................................................................... -

Potenziale Der Wasserkraftnutzung Im Bodenseekreis
[Text eingeben] Potenziale der Wasserkraftnutzung im Bodenseekreis Amt für Wasser- und Bodenschutz April 2012 Seite 1 [Text eingeben] Inhalt 1 Einleitung und Anlass ................................................................................................... 3 2 Bedeutung der Wasserkraftnutzung im Bodenseekreis ................................................ 3 3 Datengrundlagen .......................................................................................................... 5 3.1 Wasserwirtschaftliche Daten .................................................................................. 6 3.1.1 Anlagenkataster Wasserbau (AKWB) .............................................................. 6 3.1.2 Hydrologische Daten ........................................................................................ 6 3.2 Gewässerökologie, Natur- und Artenschutz und Fischerei ..................................... 7 3.2.1 Natur- und Artenschutz .................................................................................... 7 3.2.2 Wasserrahmenrichtlinie .................................................................................... 7 3.2.3 Fischerei........................................................................................................... 7 3.3 Energiewirtschaftliche Daten .................................................................................. 8 3.3.1 Potenzialermittlung ........................................................................................... 9 3.3.2 Arbeitsvermögen am Standort -

Fischereiabgabe 2008-2018 27.3.2019
Kleine Anfrage des Abg. Klaus Hoher FDP/DVP Anlage Frage 3 - Legende Erhebung und Verwendung der Fischereiabgabe, Drucksache 16/5878 MLR Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz FFS Fischereiforschungsstelle beim Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg LFV Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. RPS Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart - Fischereibehörde RPK Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe - Fischereibehörde RPF Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg - Fischereibehörde RPT Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen - Fischereibehörde LFV SWHz Landesfischereiverband Südwürttemberg-Hohenzollern e.V. VFG Verband für Fischerei und Gewässerschutz e.V. Zuweisung*: nach Beratung des Landesfischereibeirats der zuständigen Stelle zugewiesene Mittel. Zugewiesene Mittel entsprechen nicht zwingend den abgerufenen und ausbezahlten Mitteln Kleine Anfrage des Abg. Klaus Hoher FDP/DVP Anlage Frage 3 - 2008 Erhebung und Verwendung der Fischereiabgabe, Drucksache 16/5878 Projektträger Projekt Zuweisung* MLR-Mittel Übergeordnete fischereifachliche Fragestellungen (IBKF, Jahresbericht Binnenfischerei) 3.303,00 € FFS Entnahme aus FA für Fischereiforschung nach § 36 Abs. 1 FischG 100.000,00 € FFS Verstärkung der Fischereiforschung 50.000,00 € FFS Monitoring FFH-WRRL Gemeinschaftsprojekt 16.000,00 € FFS Bewirtschaftung von Fließgewässern 64.000,00 € FFS Fischereiliches Gesamtkonzept B-W alt und neu 66.000,00 € FFS Bedeutsame Fischgewässer 64.000,00 € FFS Ablaufwasser aus Fischzuchten 47.500,00 € LFV -

Klimaanalyse Für Die Stadtplanung Climate Analysis for Urban Planning Proceedings of a Japanese German Meeting Karlsruhe, September 22-23, 1994
Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt Wissenschaftliche Berichte FZKA 5579 Klimaanalyse für die Stadtplanung Climate Analysis for Urban Planning Proceedings of a Japanese German Meeting Karlsruhe, September 22-23, 1994 K. Höschele, M. Moriyama, H. Zimmer mann (Eds.) Institut für Meteorologie und Klimaforschung April1995 Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt Wissenschaftliche Berichte FZKA 5579 Klimaanalyse für die Stadtplanung Climate Analysis for Urban Planning Proceedings of a Japanese-German Meeting Karlsruhe, September 22-23, 1994 K. Höschele, M. Moriyama, H. Zimmermann (Eds.) Institut für Meteorologie und Klimaforschung Forschungszentrum Karlsruhe/Universität Karlsruhe Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 1995 Als Manuskript gedruckt Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Postfach 3640, 76021 Karlsruhe ISSN 0947-8620 "Klimaanalyse für die Stadtplanung" - A small Japanese-German Meeting - TABLE OF CONTENTS PREFACE ........................................................................................................................... 1 SPECIAL LECTURES: "Klimaanalyse für die Stadtplanung" in various regions Urban Planning in the upper Rhine Valley- The Importallee ofClimatic Aspects .................. 3 K. Höschele The Climatic Analyses in the Ruhr Area ................................................................................ 9 P. Stock Urban Climate and Urban Planning - The Example of Stuttgart - ....................................... 13 J. Baumüller -

Histologische Diagnostik Und Biotransformationsleistung Bei Forellen, Döbeln Und Schneidern
Biologische Erfolgskontrolle des Ausbaus der Kläranlage Langwiese an der Schussen: Histologische Diagnostik und Biotransformationsleistung bei Forellen, Döbeln und Schneidern Dissertation der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) vorgelegt von Diana Maier aus Hadamar Tübingen 2016 Gedruckt mit Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen. Tag der mündlichen Qualifikation: 04.03.2016 Dekan: Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel 1. Berichterstatter: Prof. Dr. Rita Triebskorn 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Ewald Müller Ein Gelehrter in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker; er steht auch vor den Naturgesetzen wie ein Kind vor der Märchenwelt. (Marie Curie) Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung .................................................................................................................... 1 1. Promotionsthema ................................................................................................................ 1 2. Graphische Darstellung des Promotionsthemas ................................................................. 1 3. Einleitung ............................................................................................................................ 2 4. Material und Methoden .................................................................................................... 10 5. Ergebnisse und Diskussion .............................................................................................. -

Hybridations Inter-Spécifiques Chez Le Pommier Et Co-Évolution Hôte-Pathogène Alice Feurtey
Hybridations inter-spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène Alice Feurtey To cite this version: Alice Feurtey. Hybridations inter-spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène. Géné- tique des populations [q-bio.PE]. Université Paris Saclay (COmUE), 2016. Français. NNT : 2016SACLS446. tel-01941395 HAL Id: tel-01941395 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01941395 Submitted on 1 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Introduction générale de la section 1 NNT : 2016SACLS446 THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, préparée à l’Université Paris-Sud ÉCOLE DOCTORALE N° 567 Sciences du Végétal : du Gène à l’Ecosystème Biologie Par Madame Alice Feurtey Hybridations inter -spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène Thèse présentée et soutenue à Orsay, le 29 novembre 2016 : Composition du Jury : M. Dominique de Vienne Professeur, Université Paris-Sud Président du jury Mme Véronique Decroocq DR, INRA Rapporteur M. Rémy Petit DR, INRA Rapporteur M. Pascal Frey DR, INRA Examinateur Mme Tatiana Giraud DR, CNRS Directrice de thèse - 1 - Remerciements : - 2 - Introduction générale de la section 1 Seen in the light of evolution, biology is, perhaps, intellectually the most satisfying and inspiring science.